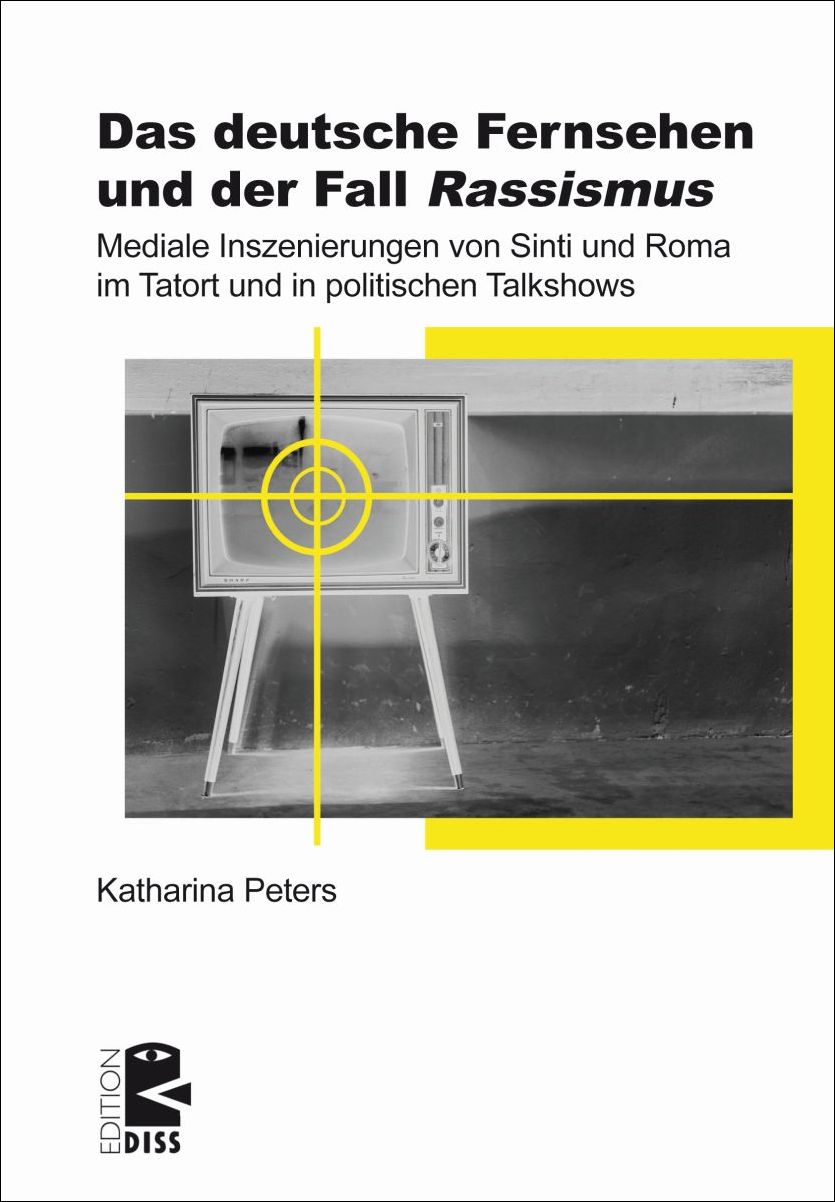Slovakia, formerly a part of Czechoslovakia, became an independent state in 1993. At that time, the transition to a market economy which started after the “Velvet Revolution” of 1989 was already under way. One of the first effects of the process was mass unemployment, which started at a meager 1.6% in 1990, but grew to almost 12% by 1991 and reached a historic high of 19.2% in 2001.
The Roma minority, which has been living in present-day Slovakia for centuries, was especially affected by the economic transformation. Under the Stalinist regime (1948 – 1989), many of them occupied unskilled positions in agriculture, manufacturing and construction. The regime pursued various paternalistic social policies intended to fully integrate them into the economy and forcibly assimilate them into the Stalinist version of a “civil society”.
On the one hand, these authoritarian policies included forcible dispersion of the Roma communities among the population, compulsory wage work, the promoting of sterilization as a form of planned parenthood among Roma women, and the education of many of their children, irrespective of their abilities, in “special schools” intended for intellectually disabled children. On the other hand, the policies led to increases in urbanization, literacy rates and life expectancy. The single-party state also suppressed open racism in employment relations or public culture. One of the goals of the Stalinist regime was to completely do away with Roma settlements in the countryside (some of which lacked sanitation) by 1990 and to provide their former inhabitants with the kind of standardized housing that had become symbolic of the former Eastern bloc.
With the fall of the regime, such centrally planned policies were abandoned. Collectivized agriculture and state businesses were quickly privatized or went bankrupt. Roma workers, many of them unskilled or less qualified, were some of the first to face mass layoffs. Racism and discrimination (including from the police), which went hand in hand with rising Slovak nationalism that led to the dissolution of Czechoslovakia, came back with a vengeance.
Many Roma people found themselves out of work, unable to find any new jobs, and in a more and more precarious housing situation. Therefore, the population of Roma settlements, including ones that are geographically segregated and lack basic amenities, swelled during the 1990s. By 2004, the unemployment rate was 51% among Roma women and a staggering 72% among Roma men. Put briefly, most of the Roma were among the defeated in the transformation process.
The welfare cuts of 2003
After a period of nepotist transition under Vladimír Mečiar, Slovakia resumed the process of integration into the world market and transnational political structures. In the 1998 election, a left-right coalition government led by Mikuláš Dzurinda toppled Mečiar with broad popular support. It opened the country to foreign investment and introduced some reforms, including in the labor market. In 2002, it was replaced by a more openly right-wing government (led, again, by Mikuláš Dzurinda), which introduced a flat tax and implemented a series of “neoliberal” reforms in welfare, health care, education, the pension system, public transportation, and labor legislation.
The reform of the welfare system (passed in 2003, effective since February 2004) included elements of “workfare” and steep cuts in welfare provisions to the unemployed. These could reduce an unemployed family’s income by 22 to 53%. Poor Roma families were among the most affected by these measures.
The protests
At the beginning of February 2004, as the unemployed all over Slovakia received official notices from the government informing them of the changes, demonstrations broke out in the southeastern and eastern parts in Slovakia. On February 11, the first supermarket was looted by about 80 people in the historical town of Levoča. In the following days, the protests quickly spread to at least 42 towns and villages. Some took the form of peaceful assemblies and demonstrations, others involved the looting of supermarkets and grocery stores and clashes with the police.
The media quickly reported on the alcohol and cigarettes that the looters allegedly were most keen on. Less reported were banners like “We want work, not food stamps” and “We’ve had enough of capitalism”, or the fact that some of the early, peaceful protests were also attended by unemployed members of the “white” majority. Unfortunately, the media operation succeeded in establishing the image of hordes of barbarians asking for “free stuff”. After all, such a view was fully in line with the dominant racist discourse. As a result, the protesters had little support, if any, from the general population – even though the total unemployment rate stood at about 18% and the various reforms were generally disliked and opposed by trade unions.
The reaction
At first, the government denied any link between the unrest and the welfare reform. Only as the protests spread did officials admit that some of the municipalities were inadequately prepared to provide “activation jobs” (i.e., mostly unskilled jobs, often in community service, as part of “workfare”) to the unemployed. As the protests turned into looting, the government quickly became nervous and decided to clamp down.
In the largest police and armed forces operation since 1989, over 2000 troops were mobilized and sent to the affected regions. Army helicopters patrolled some of the demonstrations. The most significant confrontation occurred on 23 February 2004 in Trebišov (southeastern Slovakia), where police attacked an “unauthorized” Roma demonstration, attended by about 400 people. Using teargas and, in the freezing February cold, water cannons (reportedly for the first time since 1989), they pushed the protesters out of the town center.
Early next morning, around 240 policemen attacked a settlement the protesters were suspected to live in. Conducting house-to-house searches without providing any form of warrant or authorization, they beat people (including pregnant women, children, and persons with disabilities) using batons and electric cattle prods, leaving burns on their skin. During the 12-hour raid, up to 40 people were detained, only to be further abused while in custody.
Using force where necessary, the unrest was subdued in all of Slovakia by March 2004. In total, 200 Roma people were arrested (111 of them women), of which 42 were later convicted.
The impact
Although the protests failed to develop into a real movement and were swiftly defeated by brute force, they shook the country and had a lasting impact. Soon afterwards, the government made important concessions. It increased the so-called activation benefits by 50%, introduced scholarships and various subsidies for pupils and students from poor families, and increased funding for placement opportunities for the unemployed.
These changes affected all of the unemployed in Slovakia, regardless of their ethnicity. By putting up a fight and bearing the brunt of inevitable repression, the Roma unemployed, these losers of the transformation process, managed to secure at least somewhat better conditions for all.
This article is dedicated to the more than 70 000 of our working class brothers and sisters living in segregated settlements across Slovakia (as of 2013).
Source: Libcom.org
Date: 11.05.2023
]]>Anfang Mai war es wieder soweit, in Duisburg sollte ein Mehrfamilienhaus geräumt werden. Das Jobcenter informierte Betroffene vorab, um die Leistungen einzustellen und nahm das Ergebnis der brandschutztechnischen Überprüfung vorweg.
Worum geht es?
In der ersten Maiwoche 2022 stand im Duisburger Stadtteil Hochfeld eine bau- und brandschutztechnische Überprüfung eines Mehrfamilienhauses an. Diese führt in den meisten Fällen zu einer vollständigen Nutzungsuntersagung, d.h. zu einer sofortigen Zwangsräumung der weitgehend migrantischen Bewohnerschaft durch die Stadtverwaltung. Das örtliche Jobcenter hatte bereits über zwei Wochen davor Sozialleistungsberechtigte mit amtlichem Bescheid darüber informiert, dass zum 4. Mai 2022 die Leistungseinstellung erfolgt, da der Wohnungsverlust ansteht. Damit wurde das Ergebnis der brandschutztechnischen Überprüfung vorweggenommen.
Bei einer bau- und brandschutztechnischen Überprüfung eines Wohnhauses geht es darum, Gefahr für Leib und Leben der Bewohnenden abzuwenden. Es handelt sich dem Grunde nach um ein umsichtiges und verantwortungsvolles, ja rechtlich gebotenes Handeln der zuständigen Behörde, um Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit auszuschließen. Die Überprüfungen können zu dem Ergebnis führen, das eine unmittelbare und unabwendbare Gefahr besteht, die ein sofortiges Handeln erfordern. Als Ultima Ratio steht die direkt Nutzungsuntersagung, die zum unmittelbaren Wohnungsverlust führt.
„2016 bis 2021 wurden durch die zuständige Behörde ca. 77 Wohngebäude überprüft, wovon 66 unmittelbar geräumt werden mussten. D.h. ca. 3.000 Menschen haben in den zurückliegenden fünf Jahren in Duisburg die Wohnung aufgrund des mangelhaften bau- und brandschutztechnischen Zustandes ihrer Wohnhäuser verloren.“
Die Duisburger Dimension des Themas verdeutlicht die Bilanz für die Jahre 2016 bis 2021. Danach wurden durch die zuständige Behörde ca. 77 Wohngebäude überprüft, wovon 66 unmittelbar geräumt werden mussten. D.h. ca. 3.000 Menschen haben in den zurückliegenden fünf Jahren in Duisburg die Wohnung aufgrund des mangelhaften bau- und brandschutztechnischen Zustandes ihrer Wohnhäuser verloren. Die Zahlen lassen erahnen, vor welchen Aufgaben die örtlichen Sozial-, Jugend- und Wohnungsbehörden stehen müssen. Ganz zu schweigen von dem Ordnungsamt als unterster Polizeibehörde, die bei fehlendem Ersatzwohnraum die Menschen ordnungsrechtlich unterbringen muss.
Worum könnte es noch gehen?
Die ordnungsrechtliche Unterbringungsverpflichtung gilt auch gegenüber EU-Zugewanderten. Damit rückt die notwendige Perspektive auf die spezifische Duisburger Problemlage in den Fokus. In der Stadt waren laut Ausländerzentralregister zum Jahresende 2021 23.260 aus Bulgarien und Rumänien stammende Personen gemeldet (14.035 BG/9.225 RO), womit sie ca. 4,7 Prozent der Stadtbevölkerung stellen. Wobei sich die Gesamtgruppe sehr heterogen zusammensetzt und insbesondere durch eine große Zahl an Familien geprägt ist. Viele gehören der Roma-Minderheit an.
Im Unterschied zu Städten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln oder München ist in Duisburg trotz der dokumentierten Armutslagen keine auffällige Obdachlosigkeit aus diesen beiden Zuwanderungsgruppen zu verzeichnen. Folgerichtig ist die andernorts drängende Frage der ordnungsrechtlichen Unterbringung von EU-Zugewanderten in Duisburg nicht Gegenstand der öffentlichen Debatte. Vielmehr ist die hohe Zahl einfach ausgestatteter und sanierungswürdiger Wohnungen ein wesentlicher Grund für die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien in die Stadt. Diese strukturelle Voraussetzung wird in der städtischen Politik und Verwaltung seit inzwischen zehn Jahren als ein zu minimierendes Risiko und nicht als langfristige Gestaltungschance und -aufgabe gesehen.
Unerwünschte Zuwanderung
Duisburg hat sich als einer der wichtigen Zuwanderungsorte für Menschen aus Bulgarien und Rumänien etabliert. Die Stadt ist ein Verkehrsknotenpunkt von überregionaler Bedeutung, auch durch die Nähe zu Belgien und den Niederlanden. Entsprechend weit erstreckt sich der von Duisburg aus erreichbare Arbeitsmarkt, der u.a. Tätigkeiten in der Verpackungs- und Logistikbranche, der Fleischindustrie, dem Bau- sowie dem Reinigungsgewerbe auch in den Nachbarländern bietet. Die niedrigen Mieten und informelle Wohnangebote in der Stadt machen ein tägliches Pendeln über die Ruhrgebietsgrenzen auch für Beschäftigte im Niedriglohnsektor möglich.
Gleichzeitig bietet der Duisburger Arbeitsmarkt fließende Übergänge vom Bereich nicht-dokumentierter Arbeit hin zu legaler Beschäftigung, allerdings oft unter prekären Bedingungen, wozu auch die Doppelfunktion von Arbeit- und Wohnungsgeber zählt. Die Lebenssituation vieler Zugewanderter aus Bulgarien und Rumänien in Duisburg zeigt im Brennglas die Konsequenzen ungehinderter Marktlogik für ressourcenarme Menschen.
„Der Duisburger Oberbürgermeister erläutert im August 2021 seine Sicht darauf: ‚Ich bleibe bei meinem Standpunkt: Ein Großteil der etwa 9.000 rumänischen und 14.000 bulgarischen Staatsangehörigen in Duisburg hält sich hier illegal auf.’“
Der Duisburger Oberbürgermeister erläutert im August 2021 seine Sicht darauf: „Ich bleibe bei meinem Standpunkt: Ein Großteil der etwa 9.000 rumänischen und 14.000 bulgarischen Staatsangehörigen in Duisburg hält sich hier illegal auf. Sie erfüllen einfach nicht die Voraussetzungen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Vielen fehlen die grundlegenden Skills, Sprachkenntnisse, Schulabschluss oder eine Berufsausbildung. Es ist bekannt, dass Schlepper die Notlage vieler Menschen in den Herkunftsländern ausnutzen und die Menschen mit Scheinarbeitsverträgen ausstatten, um so Aufstockungsleistungen zu erhalten. Nur wenige können mit ihrer Arbeit ihre Familien ernähren.“
Die Verhältnisse auf dem Duisburger Arbeits- und Wohnungsmarkt zeigen sich mitunter konfliktreich in einzelnen Stadtteilen. Überbelegung und damit einhergehend Ruhestörung sowie unsachgemäße Müllentsorgung gelten auch als wichtige Indizien für die Einordnung von Wohnhäusern als Schrott- oder Problemimmobilien. Die bestehenden Problemlagen werden ethnokulturell überzeichnet und ein sozial unerwünschtes Verhalten gilt als Roma-spezifisch.
„Taskforce Problemimmobilien“
Die Landesregierung NRW reagierte im Jahr 2014 auf die Wohnungsnotstände, die sich im Zuge der EU-Zuwanderung in den Ruhrgebietsstädten zeigten, mit einem Wohnaufsichtsgesetz. Zu dessen lokaler Durchsetzung bildete die Duisburger Stadtverwaltung unter Führung des Ordnungsamtes eine „Taskforce Problemimmobilien“ mit breiter Zusammensetzung – über TÜV, Feuerwehr, Wohnungsaufsicht, Sozialamt, Finanzamt, die kommunalen Ver- und Entsorgungsbetriebe bis hin zum Gesundheits- und Jugendamt. Sie setzte ein Wohngebäudemonitoring um und führte monatlich Hausbegehungen insbesondere in den Stadtteilen Hochfeld und Marxloh durch. Bis zum Herbst 2016 kam es auf dieser Grundlage zu insgesamt drei Schließungen von Wohngebäuden, da Gefahr für die Bewohnerschaft und die öffentliche Ordnung festgestellt wurde. Nach Möglichkeit wurde den Bewohnenden von städtischer Seite Ersatzwohnraum angeboten.
Hausräumungen bei „Problemimmobilien
Zum Herbst 2016 erfolgte unter der damals frisch berufenen Ordnungs- und Rechtsdezernentin eine Neuausrichtung der „Taskforce Problemimmobilien“. Diese wurde in ihrer Arbeitsweise nach dem Wohnaufsichtsgesetz als ineffektiv eingeschätzt. Hauptansatzpunkt wurde nunmehr der Brandschutz als Instrument des Sonderordnungsrechts. Auf dieser Grundlage sind seither u.a. in den Stadtteilen Beeck, Bruckhausen, Hochfeld, Marxloh, Meiderich und Ruhrort die benannte Vielzahl mehrgeschossiger Wohngebäude unmittelbar geräumt worden. Ihre Bewohnerschaft besteht vorrangig aus bulgarischen und rumänischen Familien mit einer Vielzahl Kinder. Das Jugendamt ist nunmehr nicht von vornherein eingebunden.
„Finden sich Mängel, wird die sofortige Schließung des Hauses verfügt. Die Bewohnenden erhalten die Möglichkeit, ihre Habe innerhalb von fünf Stunden heraus zu bringen und sich um eine neue Bleibe zu kümmern.“
Der schematische Ablauf ist der: Wohngebäude werden überprüft, zu denen es eine bestimmte Beschwerdelage geben soll. Ein Team u. a. aus Ordnungsamt, TÜV, Feuerwehr, Energieversorgung, Entsorgungsunternehmen und auch Jobcenter unter Amtshilfe durch die Polizei, die keine aktive Rolle einnimmt, betritt ohne Voranmeldung am Begehungstag morgens die Häuser. Die Personalien der Bewohnenden werden in ihren Wohnungen überprüft. Finden sich Mängel, die aus Brandschutzgründen eine unabwendbare Gefahr darstellen, wird die sofortige Schließung des Hauses verfügt. Die Bewohnenden erhalten die Möglichkeit, ihre Habe innerhalb von fünf Stunden heraus zu bringen und sich um eine neue Bleibe zu kümmern.
Quelle: MIGazin
Stand: 14.06.2022
]]>Ganz am Anfang, beim Einchecken, sei auf dem Wald-Campingplatz in Bad Zwesten (Schwalm-Eder) noch alles normal gewesen, erinnert sich Robert Unger. Die Familie zeigte in der vergangenen Woche ihre Ausweise, bekam einen Schlüssel fürs Tor und den Stromanschluss. Dann der plötzliche Rauswurf. Auch ein Hinweis auf die weinenden Kinder fruchtete nicht. Die Familie musste den Platz verlassen. Der Grund: Die Familie zählt zur Minderheit der Sinti in Deutschland.
Bürgermeister: Dulde keine Diskriminierung
Grundlage des Rausschmisses war ein Beschluss des Betreibers Camping Club Kassel (CCK), der Sinti und Roma den Zutritt zu dem Gelände verwehrte – angeblich habe es in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gegeben. Der Fall sorgte für Empörung.
„Wir sind schockiert. Hier werden jahrhundertealte Ausgrenzungen vollkommen unverhohlen fortgeführt“, kritisierte Adam Strauß, der Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma, am Dienstag in einer Mitteilung den Vorfall. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hatte die Vorgänge gegenüber der Frankfurter Rundschau als „beschämend“ bezeichnet.
Auch der Bürgermeister von Bad Zwesten, Michael Köhler (FDP), kündigte gegenüber dem hr an, ein klärendes Gespräch mit den Verantwortlichen des Campingplatzes zu führen. Er dulde solche Diskriminierung nicht.
Campingplatzbetreiber: „Wir haben gelernt“
Nun rudert auch der Camping Club zurück. Vorstandsmitglied Michael Zollmann räumte gegenüber dem hr ein, man habe einen Fehler gemacht. Die Kritik und das Geschehene sei nicht spurlos an ihm und den Vorstandskollegen vorbeigegangen. Es sei ein „unsäglicher Vorfall“.
Mit einem Brief wolle man beim Landesverband der Sinti und Roma und der betroffen Familie Unger um Entschuldigung bitten, erklärte Zollmann dem hr. Auch habe man festgelegt, künftig keinerlei diskriminierende Beschlüsse mehr zu fassen zu wollen. Der Brief endet mit den Worten „Wir haben gelernt!“.
Familienvater Unger: „Das ist mir noch nie passiert“
Für seine Familie sei der rassistische Vorfall eine schlimme Erfahrung gewesen, sagt Robert Unger: „Das ist mir noch nie passiert“, sagt Unger, er lebe immer schon in Deutschland, genauso wie der Rest seiner Familie: „Meine Vorfahren sind seit mehr als 100 Jahren hier“, sagt er. Er habe seinen drei und sechs Jahre alten Kindern erklären müssen, warum sie nicht willkommen sind, auch seiner Mutter und Cousins, die auch auf den Campingplatz kommen wollten.
„Mein Sohn geht bald in die zweite Klasse, was soll er dort erzählen über seinen Urlaub – dass er nicht auf den Campingplatz durfte?“, fragt Unger. Er selbst habe als Kind in der Schule Vorurteile und Antiziganismus erlebt, sagt der Familienvater. Aber jetzt sei er 32 Jahre alt und habe gehofft, solche Erfahrungen seien vorbei.
Den Urlaub setzte die Familie schließlich an der Nordsee fort. Er werde jedenfalls alle seine Bekannten vor dem Platz in Bad Zwesten warnen, sagt Unger – „Ich will nicht, dass irgendwer noch so eine schlechte Erfahrung machen muss.“
Diskriminierung und Verfolgung
Der Begriff „Antiziganismus“ bezeichnet die Diskriminierung und Verfolgung von Menschen, die der Minderheit der Sinti und Roma angehören. Da er selbst die abwertende Bezeichnung „Zigeuner“ enthält, ist der Begriff nicht unumstritten, wird aber auch von einigen Organisationen der Sinti und Roma bewusst verwendet. Andere bevorzugen den Ausdruck Rassismus. (Zu einem Dossier der Bundeszentrale für polische Bildung geht es hier.) Die damit verbundenen Vorurteile begegnen den Betroffenen immer noch, wie der Fall in Bad Zwesten zeigt – und sie haben eine furchtbare Tradition in Deutschland.
Die vernichtende Rassen-Ideologie in der NS-Zeit richtete sich gerade auch gegen Sinti und Roma, sie konnte auf ein uraltes Feindbild zurückgreifen. Die genaue Opferzahl ist schwer zu bestimmen. Aber sie geht in die Hundertausende. Es könnten bis zu 500.000 ermordete Sinti und Roma in den von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten Europas gewesen sein, wie unter anderem der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages festgehalten hat.
Quelle: hessenschau
Stand: 01.11.2021
]]>Tausende Romnija – weibliche Angehörige der Roma-Minderheit – mussten sich in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik einer Sterilisation unterziehen. Die meisten Zwangsoperationen wurden in den 1970er und 1980er Jahren durchgeführt; aber auch nach dem Fall des Kommunismus 1989 und nach Auflösung des gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowaken 1992 kam es in den Nachfolgestaaten Tschechische Republik und Slowakei weiter zu Zwangssterilisationen.
Nach mehreren erfolglosen Versuchen hat die tschechische Abgeordnetenkammer am 10. März 2021 endlich in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Entschädigung der Opfer genehmigt. Darin ist eine einmalige Zahlung von rund 12.000 Euro pro zwangssterilisierter Frau vorgesehen.
Nun muss der Entwurf des Entschädigungsgesetzes vor den im Oktober 2021 anstehenden Parlamentswahlen von beiden Kammern der tschechischen Volksvertretung – Abgeordnetenkammer und Senat – gebilligt werden. Gelingt das nicht, muss die Vorlage nach der Wahl vom neuen Parlament erneut verhandelt werden.
Helena Válková von der Regierungspartei „Aktion unzufriedener Bürger“ (ANO) ist sicher, dass die Entschädigung für Zwangssterilisation in dem EU-Land vorher Gesetz sein wird. Die Ex-Justizministerin und Kommissarin für Menschenrechte der tschechischen Regierung hat die Gesetzesvorlage ins Parlament gebracht.
Die Zeit drängt
„Nachdem ich mein Amt als Menschenrechts-Kommissarin übernommen hatte, habe ich eine Liste von Punkten erstellt, die dringend angegangen werden müssen – und diese Angelegenheit war eine davon“, erklärt Válková gegenüber der DW. Tatsächlich gelang es der ANO-Politikerin, im gesamten politischen Spektrum Unterstützung für ihren Entschädigungsvorschlag zu gewinnen – mit Ausnahme der rechtsextremen Bewegung „Freiheit und direkte Demokratie“ (Svoboda a přímá demokracie).
Válková verweist nicht nur auf die Geschwindigkeit, mit der ihr Entwurf von der Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde, sondern auch auf die große Mehrheit von 77 der 99 anwesenden Abgeordneten, die mit Ja gestimmt hatten: „Diese Tatsache gibt mir Hoffnung, dass das Gesetz vor den Wahlen verabschiedet werden kann. Das ist wichtig, denn die betroffenen Frauen sind heute im Alter zwischen sechzig und siebzig Jahren. Ich will nicht, dass sie noch weitere Jahre warten müssen.“
Schätzungsweise vierhundert Berechtigte
Der Entwurf des Entschädigungsgesetzes sieht vor, dass Frauen, die gegen ihren Willen sterilisiert wurden, zuerst ihren Anspruch nachweisen müssen. Den soll dann eine Sonderkommission des Gesundheitsministeriums beurteilen. „Dieses Vorgehen war nötig, um den Entwurf durchsetzbar zu machen“, erklärt Válková gegenüber der DW.
„Zudem war es wichtig anzumerken, dass nicht etwa einige Tausend Menschen Anspruch haben, sondern schätzungsweise vierhundert“, so die tschechische Menschenrechtskommissarin weiter. „Die Entschädigung wird also nicht Milliarden von Kronen kosten, wie zuvor manchmal behauptet wurde.“
Eugenische Monstrosität
Válková zufolge wurde die Höhe der einmaligen Entschädigung auf der Grundlage eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 2011 festgelegt. Dort hatten slowakische Romnija gegen die Slowakei wegen ihrer Zwangssterilisationen geklagt und ähnliche Beträge bekommen.
Obwohl sich der tschechische Staat 2009 für die Zwangssterilisation entschuldigt hat, steht er nach Ansicht vieler tschechischer Politiker immer noch in der Schuld gegenüber den Opfern. „Eine Entschädigung für Opfer illegaler Sterilisation würde sehr schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen ausgleichen – und gleichzeitig ein klares Signal für unsere Gesellschaft sein, damit ähnliche eugenische Monstrositäten nicht wiederholt werden“, so Pavla Golasowská, Abgeordnete der „Christlichen und Demokratischen Union – Tschechoslowakische Volkspartei“ (KDU-ČSL) in der Abgeordnetenkammer.
Staatspolitik des kommunistischen Regimes
Bisher gibt es keine genauen Statistiken darüber, wie viele Romnija von der Zwangssterilisation betroffen waren. 2005 veröffentlichte das Büro des tschechischen Bürgerbeauftragten einen Bericht, in dem es heißt, dass „die tschechoslowakische Regierung von 1970 bis 1990 Roma-Frauen methodisch sterilisiert hat, um die unerwünscht hohe Geburtenrate der Minderheit zu senken“.
 Anna Šabatová, von 2014 bis 2020 Bürgerbeauftragte der Tschechischen Republik, in Brno im August 2020
Anna Šabatová, von 2014 bis 2020 Bürgerbeauftragte der Tschechischen Republik, in Brno im August 2020
Im Jahr 2016 berichtete die damalige tschechische Bürgerbeauftragte Anna Šabatová auf einer von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) organisierten Konferenz zur Zwangssterilisation, die Opfer hätten unter dem kommunistischen Regime nach dem Eingriff eine besondere Sozialleistung erhalten.
Zwangssterilisationen bis 2007
Das Büro des Bürgerbeauftragten hat in der Vergangenheit mehr als fünfzig Fälle von Zwangssterilisation untersucht – und Verstöße gegen die Menschenrechte festgestellt. „Mütter, die mehr als zwei Kinder hatten, berichteten, dass Ärzte versuchten, sie zu einer Abtreibung zu überreden, weil sie bereits ‚viele Kinder‘ hätten“, so Šabatová.
Die Praxis der Zwangssterilisation endete 1990 nicht vollständig. Zwar wurden die entsprechenden kommunistischen Gesetze aufgehoben – aber es kam immer wieder zu einzelnen Fällen, und das sogar nach dem Jahr 2000. Laut dem tschechischen Roma-Nachrichtenportal romea.cz stammt der letzte bekannte Fall einer gegen ihren Willen sterilisierten Romni aus dem Jahr 2007.
Wie auf der bereits erwähnten OSZE-Konferenz 2016 festgestellt, sind Fälle von Zwangssterilisation von Romnija aus den vergangenen Jahrzehnten „in der Tschechischen Republik, Ungarn, der Slowakei, Schweden, Norwegen, Deutschland und Usbekistan dokumentiert“. Schon damals forderte die Konferenz Tschechien auf, die Opfer zu entschädigen. Nun endlich scheint es dort den Willen zu geben, wenigstens einen symbolischen Schritt zu tun.
Quelle: DW
Stand: 29.06.2021
Antiziganistischer Rassismus ist eine „allumfassende Alltagserfahrung für Sinti_ze und Rom_nja“, so die Kommission. Der Bericht konstatiert ein „Versagen deutscher Politik, deutscher Gesetzgebungen und deren Rechtsanwendung“. Untersucht wurde Antiziganismus beispielsweise in kommunaler Verwaltung, Schulbüchern und Polizei. Mehrere empirische Studien weisen hier institutionellen Antiziganismus nach.
Die Kommission fordert eine umfassende Strategie gegen Antiziganismus. „Wir brauchen einen grundlegenden Perspektivwechsel in der deutschen Gesellschaft, der die strukturellen Ursachen des Problems in den Blick nimmt.“ Entscheidend sei in diesem Kontext auch eine „Politik der nachholenden Gerechtigkeit“, „die das seit 1945 begangene Unrecht gegenüber Überlebenden und deren Nachkommen ausgleicht“.
Zudem fordert die Kommission, „effektive und nachhaltige Partizipationsstrukturen für die Communitys der Sinti_ze und Rom_nja auf allen Ebenen zu schaffen“. Diese müssten verbindlich und auf Dauer angelegt sein.
Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt Bund und Ländern, Beauftragte gegen Antiziganismus zu berufen und eine ständige Bund-Länder-Kommission zu schaffen, um die Arbeit gegen Antiziganismus auf höchster Ebene politisch zu verankern.
Eine weitere Forderung der Kommission lautet: „Die zahlreichen Defizite bei der ‚Wiedergutmachung‘ des Unrechts gegenüber Sinti_ze und Rom_nja müssen umgehend kompensiert und den Überlebenden ein Leben in Würde ermöglicht werden.“ Darüber hinaus solle ein umfassender Prozess der Aufarbeitung der sogenannten Zweiten Verfolgung nach 1945 durch eine von Perspektiven von Sinti_ze und Rom_nja geprägte Wahrheitskommission eingeleitet werden.
Der Bericht macht weiterhin deutlich, dass es in der Asylpolitik seit Jahrzehnten zu einer erheblichen Benachteiligung von Rom_nja, die in Deutschland Schutz vor Verfolgung, Diskriminierung, Gewalt und Krieg suchten, gekommen ist. Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt der Bundesregierung auch vor dem Hintergrund der europäischen Dimension des nationalsozialistischen Genozids ein klares Bekenntnis zu einer besonderen Verantwortung: „Die Abschiebung von Rom_nja aus der Bundesrepublik sowie die Perspektivlosigkeit derjenigen, die bis heute mit dem unsicheren Status einer Duldung leben müssen, sind zu beenden.“
Über die Unabhängige Kommission Antiziganismus
Die Unabhängige Kommission Antiziganismus wurde vom Deutschen Bundestag eingesetzt. Das Gremium hat sich – nach vorangegangenen fachlichen Konsultationen mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma – am 27. März 2019 im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat konstituiert. Ihm gehören 11 Personen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft an, die sich mit Antiziganismus beziehungsweise Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja befassen.
Weiterführende Informationen
Zentrale Empfehlungen der Unabhängigen Kommission Antiziganismus https://ots.de/TH0bVC
Programm der Tagung „Perspektivwechsel. Nachholende Gerechtigkeit. Partizipation“ am 4./5. Juni https://ots.de/SuVFIX
Mitglieder der Kommission https://ots.de/qRIxip
Der gesamte Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus „Perspektivwechsel – Nachholende Gerechtigkeit – Partizipation“ ist bisher noch nicht erschienen; er wird in Kürze unter anderem als Bundestagsdrucksache veröffentlicht werden.
Pressekontakt:
Koordinierungsstelle der Unabhängigen Kommission Antiziganismus
c/o Deutsches Institut für Menschenrechte
Dr. Sarah Kleinmann
Zimmerstraße 26/2710969 BerlinTelefon: 030 259 359-485E-Mail: [email protected]
Quelle: Presseportal
Stand: 15.06.2021
]]>
Ziel
Die Mitglieder der Kommission
Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus 2021: Zentrale Forderungen
1. Berufung einer_eines Beauftragten gegen Antiziganismus und Einsetzung eines unabhängigen Beratungskreises
2. Schaffung einer ständigen Bund-Länder-Kommission
3. Umfassende Anerkennung des nationalsozialistischen Genozids an Sinti_ze und Rom_nja
4. Kommission zur Aufarbeitung des an Sinti_ze und Rom_nja begangenen Unrechts in der Bundesrepublik Deutschland
5. Anerkennung von geflüchteten Rom_nja als besonders schutzwürdige Gruppe
6. Umsetzung und Verstetigung von Partizipationsstrukturen
Pressemitteilung (03.06.2021): Unabhängige Kommission Antiziganismus fordert grundlegenden Perspektivwechsel in der Gesellschaft
Tagung zum Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus am 4./5. Juni
Bekämpfung des Antiziganismus: Der Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus wurde am Mittwoch im Kabinett vorgestellt.
Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die aktuelle 19. Legislaturperiode wurde vereinbart, ein Expertengremium zum Thema „Antiziganismus“ einzusetzen.
Dieses Gremium, die Unabhängige Kommission Antiziganismus, hatte sich nach vorangegangenen fachlichen Konsultationen mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma am 27. März 2019 im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat zusammengeschlossen.
Die Expertinnen und Experten haben nach zweijähriger Arbeit ihren Bericht mit zahlreichen Forderungen und Empfehlungen abgeschlossen. Dabei hat der Expertenkreis unabhängig und selbständig seine Arbeitsagenda festgelegt und abgearbeitet. Dieser Bericht wurde am Mittwoch von der Bundesregierung zur Kenntnis genommen.
Grundlage für weitere gesellschaftspolitische Diskussionen
Der Bericht beinhaltet Ausführungen zu antiziganistischen Erscheinungsformen und qualitativen sowie quantitativen empirischen Gegebenheiten in Deutschland, auch und gerade aus Perspektive der Sinti und Roma.
Zudem beleuchtet er die unterschiedlichsten Bereiche und Ausprägungen des Antiziganismus und schafft eine allgemeine Grundlage für weiterführende gesellschaftspolitische Diskussionen, die im Deutschen Bundestag zu führen sind.
Auch Bundeskanzlerin Merkel betonte bei der erst kürzlich erfolgten Verleihung des Europäischen Bürgerrechtspreises der Sinti und Roma die Bedeutung der Bekämpfung des Antiziganismus: „Wir alle sind gefordert, uns gegen jede Form von Antiziganismus zu wenden, hierzulande und in ganz Europa. Die Grundrechte und Grundwerte, die unsere Gesellschaft einen, sind unvereinbar mit antiziganistischen Auswüchsen aller Art.“
Quelle: Bundesregierung
Stand: 21.05.2021
Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat Beschwerde bei der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) gegen eine Spiegel-TV-Reportage eingelegt. Der Beitrag „Perfide Abzocke mit Terrassenreinigung: Einmal saubermachen für 5.000 Euro“ stärke massive Vorurteile gegenüber der gesamten Minderheit und schüre Hass, der sich in unzähligen Hasskommentaren im Internet entlade und zu Angriffen auf Sinti und Roma führe, erklärte der Verband am Donnerstag in Heidelberg. „Dies dokumentieren insbesondere die Kommentarspalten unter dem Spiegel-TV-Beitrag in den sozialen Medien“, kritisiert Zentralratsvorsitzender Romani Rose.
Auf Facebook kommentiert ein Nutzer einen Ausschnitt aus dem Spiegel-TV-Video wie folgt: „Das Pack weiss doch dass in Deutschland was zu holen ist. Ein Kollege sagte zu mir, dass hätte er mal 1940 bei seinem Opa versuchen sollen. Er wüsste nicht wo er da gelandet wäre.“ Ein anderer Schreibt: „Dieses Pack würde ich sofort von meinem Grundstück jagen. Aber denen passiert ja nichts. Kassieren alle Hartz 4 und fahren Mercedes AMG.“
Missachtung journalistischer Grundsätze
Er hielt den Produzenten vor, die Reportage missachte grob journalistische Grundsätze, Vorgaben des Niedersächsischen Mediengesetzes und des Medienstaatsvertrages sowie der Programmgrundsätze, wonach Programme die Würde des Menschen zu achten haben und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken sollen. Besonders kritisierte Rose Begriffe wie „Roma-Clan“, der der gesamten Minderheit Kriminalität allein aufgrund ihrer Abstammung unterstelle.
Zudem habe der Beitrag wiederholt die Namen Betroffener genannt. Mehrere Familien hätten sich beim Zentralrat gemeldet, die den gleichen Namen trügen und damit als Unbeteiligte mit an den Pranger gestellt würden. „Eine derartige Darstellung verletzt massiv die Wahrung der Menschenwürde“, erklärte Rose.
Spiegel TV schon öfter aufgefallen
Von der NLM erwartet das Gremium eine grundsätzliche Prüfung der erhobenen Vorwürfe, insbesondere, inwieweit Spiegel TV private Videos und Facebook-Profile habe verwenden dürfen.
In der Vergangenheit waren dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma nach Angaben ihres wissenschaftlichen Leiters Herbert Heuß schon mehrfach grenzwertige Aussagen in Beiträgen von Spiegel TV aufgefallen, die im Rahmen der Drittsendezeit auf RTL ausgestrahlt werden. Mehrfache Anfragen an Spiegel TV seien jedoch ohne Reaktion geblieben, sagte er dem „Evangelischen Pressedienst“.
Quelle: Migazin
Stand: 21.05.2021
]]>Ab sofort lieferbar ist der Band 46 der Edition DISS im Unrast-Verlag:
Katharina Peters
Das deutsche Fernsehen und der Fall ›Rassismus‹
Mediale Inszenierungen von Sinti und Roma im Tatort und in politischen Talkshows
Das Buch ist erhältlich im guten Buchhandel oder direkt beim Unrast-Verlag.
ISBN 978-3-89771-775-6
164 Seiten, 18 EUR
Das vermeintliche Wissen, das über Sinti*ze und Rom*nija kursiert, ist geprägt von negativen Stereotypen bei kaum vorhandenen Kontakterfahrungen mit Angehörigen der Minderheit. Die dominierenden Bilder werden durch die Medien verbreitet und als Wahrheiten ausgegeben und rezipiert. Sie beschränken sich außerdem nicht auf Mitglieder der Minderheit, sondern werden ohne Widerspruch auf Menschen aus Bulgarien und Rumänien übertragen. Neben der emanzipatorischen Arbeit einer zunehmenden Zahl an Selbstorganisationen, ist es ein Anliegen dieser Arbeit, die medialen Inszenierungen, deren Schauplätze und Akteur*innen, sowie die dahintersteckenden Wirkmechanismen und Strukturen aufzudecken.
Katharina Peters untersucht am Beispiel der medialen Inszenierung von ›Sinti und Roma‹ im deutschen Fernsehen, wie Rassismen adaptiert und verbreitet werden. Die mit dem Augsburger Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien ausgezeichnete Analyse entlarvt die als Realitäten ausgegebenen Bilder in ihrer Konstruiertheit und schafft so Raum für andere Wirklichkeitsentwürfe, die ein vielfältigeres Bild zulassen und Stereotype negieren. Der diskurs- und medienwissenschaftliche Ansatz leistet einen Beitrag, Erscheinungsformen des Rassismus in Zeiten eines weltweit erstarkenden Nationalismus am Beispiel von Antiziganismus im deutschen Fernsehen detailliert zu beschreiben. Mit dem Ziel, die Sensibilität für eine diskriminierungsfreie mediale Darstellung zu schärfen und das Bewusstsein für die Realität Deutschlands als eine Einwanderungsgesellschaft zu stärken.
Katharina Peters
Katharina Peters (*1987) studierte Germanistik, Anglistik, Literatur- und Kulturwissenschaften und lebt im Ruhrgebiet. Als Mitarbeiterin am Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung und als Lehrbeauftragte arbeitet sie zu den Themen Rassismus, Antiziganismus und Gender Studies – insbesondere in den Medien.
Sie ist Verfasserin der Expertise Diskursivierung von ›Sinti und Roma‹ und ›Antiziganismus‹ in Bundestagsdebatten 2010 – 2019 im Auftrag der von der Bundesregierung eingesetzten Unabhängigen Kommission Antiziganismus, in der sie die politischen Positionen der einzelnen Fraktionen und deren Argumentationsstrategien untersucht. Die Ergebnisse der Studie werden 2021 veröffentlicht.
2020 erschien der von ihr und Stefan Vennmann herausgegebene Sammelband Nichts gelernt?! Konstruktion und Kontinuität des Antiziganismus. Weitere Infos dazu unterwww.diss-duisburg.de.
Für die vorliegende Arbeit wurde sie mit dem Augsburger Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien 2020 ausgezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Vorspann – Die Verwischung der Grenzen im Interdiskurs Fernsehen
Drehbuch – Korpus und Struktur der Analyse
Im Visier – Sint*ezza und Rom*nja als Objekte medialer Inszenierung
Wiederholung – Die Rolle des Fernsehens
Immer wieder sonntags – Der Tatort
Modus operandi – Zur Methode
‚Sinti und Roma‘ im mediopolitischen Diskurs – Eine Spurensuche
Die Bürde der kollektiven Schuld – Armer Nanosh (1989)
Musikalität und Leidenschaft – Die schlafende Schöne (2005)
Kriminalität und Elend
Klau-Kids: aus ‚Osteuropa‘ – Brandmal (2008) und Kleine Diebe (2000)
‚Menschenhandel‘, ‚Prostitutoon‘, ‚Arbeiterstrich‘, ‚Bettel-Clans‘ und ,Müll’ – Mein Revier (2012), Angezählt (2013), Mi sanjetz da, wo’s weh tut (2016), Klingelingeling (2016)
Auflösung oder offenes Ende? Résumé und Ausblick
Literatur
Verzeichnis Filme und Fernsehsendungen
Anhang
Übersicht Tatort-Folgen
Übersicht Polit-Talkshows
Übersicht (diskursauslösende) Ereignisse und mediale Bearbeitungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
Quelle: Disskursiv Blog
Stand: 25.04.2021
]]>