Gefunden auf den Blog von Lukas Borl, die Übersetzung ist von uns.
Kommentar zu einem Graffiti eines „unbekannten“ Künstlers

Ich dachte immer, dass alles seine Grenzen hat. Aber als ich das Graffiti auf dem beigefügten Foto sah, dachte ich, dass die politische Verwirrung des Künstlers absolut grenzenlos ist. Ein anarchistisches Symbol in den Namen eines Staates einzubauen, erfordert viel Verrücktheit. Vielleicht weiß der Autor nicht, dass Anarchie die Negation aller Staaten ist, d. h. Russland, Tschechische Republik, Ukraine, Frankreich und aller anderen Staaten. Vielleicht ist es für ihn nicht wichtig, dass Anarchistinnen und Anarchisten schon immer von allen Staaten verfolgt, kriminalisiert, inhaftiert und unterdrückt wurden – von totalitären und demokratischen. Vielleicht denkt der Autor, dass, wenn wir ein anarchistisches Symbol in den Namen eines Staates einfügen, der Staat aufhört, ein Staat zu sein, und sich in Anarchie verwandelt. Wenn es nur so einfach wäre.
Wer weiß, vielleicht sehen wir das nächste Mal dasselbe anarchistische Symbol in den Worten „StAat“ oder „ČeskÁ RepublikA“. Diese Wörter enthalten auch den Buchstaben „A“, sodass die verwirrten Graffiti-Künstler gutes Material für ihre Arbeit haben.
Für diejenigen, die sich nicht für politische Verwirrung interessieren, sind andere Bereiche vielleicht interessanter. Zum Beispiel Fakten über die Natur des Staates, der den Namen Ukraine trägt.
- Die Ukraine ist ein Staat, der seine Grenzen für einen Großteil seiner männlichen Bevölkerung geschlossen hat und diese Menschen somit in einem Kriegsgebiet gefangen hält.
- Die Ukraine ist ein Staat, dessen Armee Männer im wehrfähigen Alter verfolgt und sie gewaltsam an die Front zwingt, wo sie der Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes ausgesetzt sind.
- Die Ukraine ist ein Staat, dessen Grenzschutz Deserteure verfolgt, foltert und ermordet.
- Die Ukraine ist ein Staat, dessen Gerichte Deserteure strafrechtlich verfolgen und dessen Gefängnisse sie einsperren. Derzeit sprechen offizielle Statistiken von mehr als 200.000 Deserteuren, aber es gibt wahrscheinlich noch weitere, die nicht offiziell registriert sind.
- Die Ukraine ist ein Staat, dessen Gerichte derzeit politische Prozesse gegen Antimilitaristinnen und Antimilitaristen wegen „Diskreditierung der Streitkräfte des ukrainischen Staates“ führen.
- Die Ukraine ist ein Staat, der bestimmte politische Einheiten wegen „Unterstützung und Förderung der kommunistischen Ideologie“ kriminalisiert, was logischerweise auch anarchistische Gruppen betreffen könnte, die sich auf Klassenkampf und anarchistischen Kommunismus beziehen.
- Die Ukraine ist ein Staat, der eine diskriminierende Politik gegenüber der russischsprachigen Bevölkerung betreibt.
- Die Ukraine ist ein Staat, der rechtsextreme Gruppierungen wie Asow, die Bruderschaft, den Rechten Sektor, die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) usw. integriert hat.
- Die Ukraine ist ein Staat, der der Bourgeoisie, die die Arbeiterklasse stark ausbeutet, Schutz bietet. Arbeiterinnen und Arbeiter in der Ukraine erhalten normalerweise 20.000 Griwna (= 460 Euro) für einen Monat Arbeit, während die Preise für Grundnahrungsmittel denen in der Tschechischen Republik ähneln.
- Der ukrainische Staat unterdrückt den Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen.
- Die Ukraine ist ein Staat, der weniger brutal ist als Nachbarstaaten wie Russland oder Belarus, aber dennoch in seinem Kern die Privilegien der Kapitalistenklasse auf Kosten der Arbeiterklasse verteidigt.
- Die Ukraine ist ein Staat, der insbesondere den Teil der Arbeiterklasse unterdrückt, der in Bezug auf die Staatsbürokratie in die Kategorie „ukrainische Staatsbürger“ fällt.
- Die Ukraine ist ein Staat, der alle Widersprüche der Klassengesellschaft und damit das ganze Elend des proletarischen Lebens bewahrt.
Die Ukraine ist ein Staat, also ein Feind der Anarchie!
]]>
Gefunden auf archives autonomies, die Übersetzung ist von uns. Eine Kritik von Cajo Brendel an „nationalen Befreiungsbewegungen“.
Dritte-Weltismus und Sozialismus, Cajo Brendel
In den zwei Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg wurde die politische Bühne von den antiimperialistischen Kämpfen der kolonialisierten Völker beherrscht. Die chinesische Revolution ist nur der prominenteste Fall eines Kolonialvolkes, das in sehr harte Kämpfe gegen einen viel mächtigeren imperialistischen Feind verwickelt ist – Kuba, Algerien und Vietnam sind ebenfalls Beispiele unter vielen.
Während diese antiimperialistischen Kämpfe tobten, führte die metropolitane Arbeiterklasse nur wenige politisch bemerkenswerte Schlachten gegen ihre eigenen Herren; in keinem der Industrieländer erhob sich das Proletariat gegen die Bourgeoisie, um deren politische Macht in Frage zu stellen. Der ungarische Aufstand von 1956 war wie der Kronstädter Aufstand 1921 in Russland1 von politischer Bedeutung, aber da er in einem Land stattfand, in dem das Privateigentum an Produktionsmitteln bereits abgeschafft worden war, passte er nicht in die orthodoxe marxistische Analyse der gesellschaftlichen Dynamik, und seine tiefere Bedeutung blieb unbeachtet. Unter diesen Umständen entstanden die „Dritte-Weltismus“-Theorien.
Diese Theorien konzentrierten sich hauptsächlich auf die folgenden Punkte:
1.) Das Proletariat der Industrieländer revoltiert nicht, weil es von den Brosamen der Ausplünderung der kolonialen Welt gesättigt ist. Dieser Umstand erstickt seine revolutionäre Initiative. Das Proletariat in diesen Ländern ist korrupt und in die bourgeoise Ordnung integriert.
2.) Die Bevölkerung der kolonialen Länder, deren Arbeit die Rohstoffe liefert, die der Imperialismus benötigt, bildet ein Weltproletariat“ (auch wenn es sich um Bauern handelt, die nicht in eine industrielle Tätigkeit eingebunden sind). Im Weltmaßstab sind sie die revolutionäre Klasse. Und sie sind es, die sich in bewaffneten Aufständen gegen den Imperialismus erhoben haben. Die antikoloniale Revolution ist daher die sozialistische Revolution unserer Zeit.
3. Bauern auf der ganzen Welt werden den bewaffneten Kampf aufnehmen und die städtischen Zentren einkreisen (genau wie in China und Kuba). Außerdem werden diese Zentren in einer ökonomischen Krise zusammenbrechen (da ihnen die Rohstoffquellen, Märkte und Arbeitskräfte entzogen wurden). Das städtische Proletariat wird sich in dieser Phase der siegreichen Revolution der kolonialen Bauern anschließen.
Die drei oben genannten Punkte, die vielleicht bis zu einem gewissen Grad vereinfacht sind, stellen dar, was wir unter der Theorie des „Dritte-Weltismus“ verstehen. Wie jede andere Orthodoxie hat sie viele Varianten, von denen jede für sich beansprucht, die einzig authentische zu sein. Auf jeden Fall bilden diese drei Punkte den gemeinsamen Nenner derjenigen, die der „Dritte-Weltismus“-Ideologie anhängen.
Der „Dritte-Weltismus“-Marxismus ignoriert die grundlegenden Annahmen der marxistischen Gesellschaftsanalyse. Nach Marx ist eine Revolution nicht nur ein Aufstand gegen das Elend. Sie ist die Legitimation eines neuen Ensembles von sozialen Beziehungen, die vor der Revolution aufgrund einer neuen Produktionstechnologie entstanden sind. Nach Marx ist es nicht die Revolution, die eine neue Gesellschaft hervorbringt, sondern ein neues Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse, das eine Revolution hervorbringt und ihr dann die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. So konnten die großen Revolutionen in England (1640) und Frankreich (1789) nur die Gesellschaftsordnung legitimieren, die die Bourgeoisie jahrzehntelang hervorgebracht hatte.
Welche Art von Gesellschaft reifte in den Kolonialländern vor ihrer Unabhängigkeit heran? Das Industrieproletariat in diesen Ländern war fast nicht existent und konnte keine entscheidende Rolle spielen. Der Kampf der Kolonialvölker war in erster Linie eine Bauernrevolte. Revolutionen, die von halbmilitärischen Parteien angeführt und durch militärische Kämpfe vollendet wurden, brachten Regime hervor, die zutiefst von ihren Ursprüngen geprägt waren. Die neuen politischen Strukturen sind ein Abbild der Formen des Machtkampfes: reglementiert, autoritär, doktrinär, bürokratisch. Neue Regime dieser Art können die Millionen von Menschen, die in den modernen Industrieländern leben, nicht inspirieren. Alle Revolutionen in einem unterentwickelten Land haben die absolute Herrschaft einer politischen oder militärischen Bürokratie hervorgebracht. Selbst wenn sie von ihrer eigenen Bevölkerung toleriert werden (oft nach der Inhaftierung oder Hinrichtung jeglicher Opposition – einschließlich der Linken), können diese Regime nicht als Modell oder Ziel für die Menschen in einer modernen Industriegesellschaft dienen.
Das bedeutet nicht, dass diese Revolutionen wertlos waren. Wo Tausende von Menschen verhungern, ist man fehl am Platz, wenn man sich über den Mangel an Demokratie beschwert. Selbst wenn die chinesischen, kubanischen oder algerischen Revolutionen nichts weiter getan hätten, als das Elend in diesen Kolonialländern zu verringern, wären sie nicht nutzlos gewesen. In Wirklichkeit haben sie mehr getan, als nur hungrige Bäuche zu füllen: Sie haben das Analphabetentum beseitigt, das Privateigentum an Land abgeschafft, die Industrialisierung eingeleitet und so weiter. Aber nichts davon kann weder implizit noch explizit so verstanden werden, dass es auch nur das Geringste mit Sozialismus zu tun hätte: Die fortgeschrittenen Länder haben viel mehr als das produziert, und wir kritisieren sie immer noch gnadenlos. Beim Sozialismus geht es um eine grundlegende Veränderung der Produktionsverhältnisse: die Abschaffung des Verhältnisses von Herrschenden und Beherrschten in den Produktionskräften und in allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens. Die Revolten in der Dritten Welt bringen keine neue Art von Gesellschaftsordnung hervor, die für die Industriegesellschaft gültig ist.
Darüber hinaus ist der Spielraum für nationale politische Autonomie, der in solchen Staaten existiert, oft sehr begrenzt. Ökonomische und militärische Hilfe, allgegenwärtige „Berater“, das Erbe besonderer politischer Strukturen und etablierter Handelsströme neigen dazu, solche Staaten in einer Situation der Abhängigkeit von ihren früheren imperialistischen Herren zu belassen: siehe die Beziehungen Algeriens zu Frankreich. Wo die Revolte tiefer ging, entstehen neue politische Strukturen und neue Handelsströme, und in der Regel findet sich das Land zunehmend unter dem Einfluss anderer Supermächte wieder. Die kubanische Unterstützung für den russischen Einmarsch in die Tschechoslowakei zeigte, wie sehr Castro davon abhängig war, dass die Russen die Zuckerernte aufkauften – der Handel mit Prinzipien steht in direktem Zusammenhang mit dem Prinzip des Handels. Selbst wenn echte „politische“ Unabhängigkeit erlangt wird, wie im Fall Chinas, werden die Prinzipien den durch den Handel vermittelten Vorteilen geopfert. 1964 sabotierte die maoistische KP Japans einen Generalstreik im Zusammenhang mit ihren Bemühungen, den chinesisch-japanischen Handel zu fördern, und zwei Jahre später wurde bekannt, dass die Chinesen die USA mit Flach- und Rundstahl belieferten, der für ihre Kriegsanstrengungen in Vietnam unerlässlich war.
Auch wenn die „ökonomische Katastrophe“ der Ballungszentren nicht eintritt – wie jeder, der mit dem Primat des internen Marktes im modernen Kapitalismus vertraut ist, leicht hätte vorhersehen können – ist es so, dass die Industrieländer weniger von den unterentwickelten Ländern abhängig sind als diese von den Industrieländern. Nicht nur, dass Kunstfasern die Baumwolle ersetzen können, sondern auch, dass die baumwollproduzierenden Länder sehr arme Märkte für z.B. Autos oder Computer darstellen. Moderne Industrieländer sind im Vergleich zu früher immer weniger von ihren ehemaligen Kolonien abhängig, sowohl was Rohstoffe als auch was Märkte betrifft. Holland hat Indonesien verloren, Belgien den Kongo, die USA wurden aus Kuba hinausgeworfen, ohne dass ihre Ökonomien zusammengebrochen wären.
Dennoch haben die Kämpfe der Kolonialvölker etwas zur revolutionären Bewegung beigetragen. Die Tatsache, dass schlecht bewaffnete Bauernvölker den enormen Kräften des modernen Imperialismus entgegentreten konnten, erschütterte den Mythos der Unbesiegbarkeit der militärischen, technologischen und wissenschaftlichen Macht des Westens. Ihr Kampf hat auch Millionen von Menschen die Brutalität und den Rassismus des Kapitalismus vor Augen geführt und viele, vor allem junge Menschen und Studenten, dazu gebracht, den Kampf gegen ihre eigenen Regime aufzunehmen. Die Unterstützung der kolonialen Völker gegen den Imperialismus bedeutet jedoch nicht die Unterstützung irgendeiner der Organisationen, die an diesem Kampf beteiligt sind.
Unsere Weigerung, politische Organisationen zu unterstützen, die nationalistische, bourgeoise oder staatskapitalistische Programme verfolgen, ist nicht nur eine Frage der Treue zu revolutionären, moralischen und ideologischen Prinzipien. Es ist auch eine Frage der politischen Solidarität. In vielen Fällen kommt es vor, dass es in großen, reichen und lauten Organisationen kleine Gruppen von Militanten gibt, revolutionäre Internationalisten, die in einem sehr scharfen Konflikt nicht nur mit dem Imperialismus, sondern auch mit ihren eigenen nationalistischen „Partnern“ stehen. In China wurden z. B. sowohl Anarchisten als auch Trotzkisten auf dem Weg der KP zum Sieg zerschlagen. Die Anwälte des „Realismus“, die ihre Unterstützung mehr nach Größe als nach Programm, nach objektiven Bedingungen als nach subjektivem Bewusstsein gewähren, verraten nicht nur ihre revolutionären Prinzipien, sondern auch diejenigen, die in den betreffenden Ländern für dieselben Prinzipien kämpfen. Es ist die Politik derer, die sich den „objektiven Bedingungen“ anpassen, anstatt die Politik derer, die es wagen, sie herauszufordern und zu verändern.
1Vgl. Ungarn, 1956 von Andy Anderson; und Ida Mett, La Commune de Cronstadt, Crépuscule sanglant des Soviets (Die Kronstädter Kommune, Blutige Dämmerung der Sowjets), Spartacus Hefte. (A.d.Ü., Ida Mett, Kommune von Kronstadt, auch auf unseren Blog veröffentlicht)
]]>
Gefunden auf anarchist library, ursprünglich veröffentlicht von Elephant Editions, die Übersetzung ist von uns. ine weitere Kritik an ‚nationalen Befreiungsbewegungen‘ und die Mythologien mit denen sie sich ernähren.
Jenseits der Sturmhauben im Südosten Mexikos
Charles Reeve, Sylvie Deneuve, Marc Geoffroy
Einleitung
„Bis auf den heutigen Tag ist das Revolutionsprinzip dabei geblieben, nur gegen dieses und jenes Bestehende anzukämpfen, d. h. reformatorisch zu sein.“ Max Stirner
Bücher, Konferenzen, Videos, T-Shirts, Aufkleber, Märsche, Komitees und Benefizveranstaltungen gibt es in Hülle und Fülle, die die vielen Ausdrucksformen dessen zeigen, was als „die Internationale der Hoffnung“ bezeichnet wird. Dennoch wurde keine Kritik am „aufständischen Chiapas“ und der Zapatistischen Nationalen Befreiungsarmee aus subversiver Sicht veröffentlicht. Auch viele Anarchistinnen und Anarchisten haben ihren Beitrag geleistet, ohne ein Wort der Kritik. Warum ist das so?
Die Texte zu dieser Frage, vor allem die EZLN-Kommuniqués und -Dokumente, geben sicherlich Stoff zum Nachdenken (z. B. die Organisation der von den „Zapatisten“ kontrollierten Gebiete, die Schaffung einer „revolutionären provisorischen Regierung“, die Verhängung „revolutionärer Steuern“, „revolutionärer Gesetze“ und sogar „revolutionärer Gefängnisse“). Aber warum spricht man von der zapatistischen Armee, als wäre sie eine Organisation, die über den Marxismus-Leninismus hinausgegangen ist, ein libertäres Experiment usw.?
Weil man nur das sieht, was man sehen will. Mit anderen Worten: Die zapatistische Ideologie ist nur ein weiteres Indiz für das Elend, das allgemein herrscht. Das Spektakel hat zu all dem beigetragen: das Bild der Sturmhaube, das Geheimnis des Waldes, die Faszination exotischer Orte; und dann ist da noch Marcos mit seinen poetischen Texten („schwul in San Francisco, Anarchist in Spanien…“, „ein Land, in dem das Recht zu tanzen in der Verfassung verankert sein wird…“) und sein Geschick, mit dem Begriff der Macht zu spielen. Was jedoch mehr als alles andere dazu beigetragen hat, ist die Perspektivlosigkeit, die übel riechende Einheitsfront einer Linken, die am Ende das Recht auf Arbeit und demokratische Garantien gegen den „Neoliberalismus“ verteidigt, den alle, von Stalinisten bis Anarchisten, zu bekämpfen vorgeben, und die Abwesenheit eines revolutionären Diskurses, der das radikale Problem – die Zerstörung des Staates, die Abschaffung der Ökonomie und die verallgemeinerte Selbstverwaltung – jenseits der Leere der historischen Feierlichkeiten in radikale Worte fassen könnte.
Der Mangel an Ideen und Wünschen macht uns in zweifacher Hinsicht blind. Erstens, indem sie das wahre Wesen der Organisationsformen verschleiert, die die Ausgebeuteten in der sozialen Konfrontation überall auf der Welt entwickeln (in diesem speziellen Fall die Methoden der EZLN und der sogenannten „indigenen Autonomie“). Zweitens, indem sie das Problem dieser Formen und Inhalte von der konkreten Arena des Aufstands wegführt, wo sie hingehören. Andererseits: Warum um alles in der Welt sollten diejenigen, die Rebellion hier zu Hause oder den Vorschlag, dass der Staat nicht von alleine zusammenbricht, sondern dass etwas Konkretes dagegen getan werden muss, für wild und rücksichtslos halten, sich für den Guerillakrieg an exotischen, fernen Orten begeistern? Verbindet etwas das Bild der „zapatistischen“ Sturmhaube mit dem täglichen Leben derjenigen, die arbeiten, konsumieren, wählen und Steuern zahlen – so etwas wie Passivität, die sie vielleicht sogar mit Waffen verteidigen?
Der Wert der kämpferischen Fassade der EZLN ist in letzter Zeit in der Börse der revolutionären Ideologien tatsächlich gesunken. Ihre Übereinstimmung mit der französischen institutionellen Linken, die bewegende Umarmung von Marcos und dem Anführer der reformierten Kommunistischen Partei Italiens (Rifondazione Communista), Bertinotti, hat vielleicht diejenigen enttäuscht, die die Aufständischen von Asturien, Durruti oder Flores Magòn auf der Suche nach historischen Vorbildern, mit denen sie ihre Unterstützung für die Zapatistische Nationale Befreiungsarmee rechtfertigen können, beunruhigt hatten. Zweifellos gibt es eine Menge weniger anspruchsvoller Unterstützer, die darauf warten, ihren Platz einzunehmen.
Die folgenden Texte enthalten – zum ersten Mal – die notwendige Kritik an der EZLN und dem kommerziellen Indigenismus. Grundlegender gesunder Menschenverstand, wenn du so willst. Jeder wird darin etwas finden, worüber er nachdenken kann. Doch bevor wir diese kurzen Notizen beenden, möchten wir noch einen kurzen Blick auf die „Internationale der Hoffnung“ werfen – also auf die zapatistische Bewegung. Es ist interessant, einige der Transkriptionen und Zusammenfassungen der Diskussionen zu lesen, die während des interkontinentalen („intergalaktischen“) Treffens im August 1996 in Chiapas stattfanden. In Bezug auf die Ökonomie (eine Frage, die speziell an einem der fünf „Debattiertische“ behandelt wurde) findet sich folgende Prämisse: „Der Globalismus des Neoliberalismus macht es notwendig, in Bezug auf ebenso globale Alternativen zu denken. Der Kampf muss auf weltweiter Ebene geführt werden. Abstrakt betrachtet können wir dem Konzept des Globalismus durchaus zustimmen.“ Problematisch wird es, wenn es darum geht, etwas dagegen zu tun. Wie wir alle wissen, sind es nicht die Antworten, sondern die Fragen, die das Wesen eines Projekts offenbaren.
Schauen wir uns einige der angesprochenen Punkte an. „Es ist dringend notwendig, die Macht über die ökonomische Politik zurückzugewinnen, um Probleme wie die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter und die Lohnungleichheit zu lösen“. Wer kann zum Beispiel das „Problem“ der Lohnunterschiede angehen, wenn nicht diejenigen, die die Steuern erheben, also die Regierung? An wen ist diese Frage also gerichtet? Was sie mit dem „Globalismus des Neoliberalismus“ meinen, wird in folgendem Satz deutlich: „Der Neoliberalismus trifft auch Länder mit einer ökonomischen Verwaltung wie Kuba, das Opfer einer Verschärfung des Embargos der Vereinigten Staaten ist.“ Geht es darum, dass Kuba mit seinem bürokratischen Kapitalismus ein Beispiel für Arbeit und „Einkommensgleichheit“ liefern soll? Oder dass der „Neoliberalismus“ eine Art unmenschliche Übertreibung des Kapitals darstellt, die irgendwie abgemildert werden könnte? Aber kommen wir zu den „globalen“ Vorschlägen. „Wir schlagen folgende Losung vor, um Kämpfe auszulösen, die sich auf der ganzen Welt wiederholen lassen: Erlass (manche sprechen einfach von einer Reduzierung!) der Schulden der armen Länder, Senkung der Zinssätze, Selbstorganisation der Schuldner, Arbeitszeitverkürzung, Lohngleichheit und die Schaffung von Kampfnetzwerken von Arbeiterinnen und Arbeitern, Arbeitslosen, Ausgegrenzten usw.“ Nochmal: Wer kann die Schulden der armen Länder abschreiben? Wer sind die „Schuldner“, die sich selbst organisieren sollten? Die Fragen können niemals revolutionär – mit anderen Worten: global – sein, wenn die Antworten vom Feind, d. h. den Bossen, abhängen. Die Kämpfe der Ausgebeuteten wären dann nur ein Mittel, um Druck auf den Staat und das Kapital auszuüben (die zugrundeliegende Theorie der Sozialdemokratie), nicht aber die reale Möglichkeit der revolutionären Zerstörung der letzteren. Eine „extremistische“ Weiterentwicklung dieses Diskurses, die Übernahme der Verwaltung der Macht (und definitiv keine verallgemeinerte Selbstverwaltung), ist in der Tat leninistisch.
Was mit Globalismus gemeint ist, ist also nichts anderes als ein breiter Reformismus, eine Politische Internationale. Ein Diskurs wird nicht einfach dadurch global, dass überall die gleichen Slogans verwendet werden oder dass Informationen ausgetauscht werden. Eine globale Dimension wird erreicht, wenn alle sozialen Beziehungen und alle Lebensbedingungen in die Kritik geraten: wenn Probleme konkret, d.h. in ihrem gesamten Kontext, angegangen werden. Ein Kampf für eine Arbeitszeitverkürzung – ein Problem, dem sich das Kapital selbst durch das Spektakel und die Reservearmee der Konsumenten stellt – wird nicht dadurch global, dass er in Belgien, Spanien, Italien, Mexiko oder wer weiß wo zur gleichen Zeit stattfindet. Global bedeutet, das Konzept der Arbeit an sich zu kritisieren, wie Löhne, soziale Organisation, die Macht der Waren, moralische Opfer usw., unabhängig von der Anzahl der Beteiligten.
Andere Debatten bestätigen das oben Gesagte nur. In der Niederschrift der Diskussionen an „Tisch 5“ (mit dem Titel „Viele haben ihren Platz in dieser Welt verloren“) lesen wir: „Die Achtung der Identität der Völker muss als ein Recht anerkannt werden, das durch die Unterstützung ihrer vollen kulturellen und materiellen Entwicklung politisch wird“. Auch auf die Gefahr hin, pedantisch zu wirken: Unterstützung durch wen, wenn nicht durch den Staat? Die Behauptung, dass der Staat Selbstbestimmung unterstützt, die, wenn sie real ist – wenn es sich nicht gerade um ein Recht handelt – letzteres beseitigen würde, ist entweder dumm oder eine Mystifizierung, subversiv, auf keinen Fall. Um dies besser zu demonstrieren: „Auf der anderen Seite treten Staaten nicht nur die Rechte ihrer eigenen Volksgruppen mit Füßen, sondern verweigern auch anderen Staaten das Recht auf Selbstbestimmung (Vereinigte Staaten – Kuba und der Rest Lateinamerikas)“. Selbstbestimmungsrecht der Staaten?
Um den Leser nicht länger zu langweilen, kommen wir zum Schluss zu den beiden letzten, drängenden Fragen. Erstens: „Sollten bestimmte kulturelle und sozioökonomische Regionen innerhalb von Staaten völlige Autonomie oder Unabhängigkeit erlangen?“ (Dieses Problem ist für Autonome von weitaus größerem Interesse als für Revolutionäre – was viel über das Konzept der Autonomie aussagt). Zweitens: „Wir fragen uns, ob die Abwesenheit der offiziellen Linken bei diesem Treffen bedeutet, dass sie den Kampf gegen den Neoliberalismus aufgegeben hat?“ (Bertinotti, wo bist du?) Um zum Schluss zu kommen: „Parallele Handelsnetze“, „alternativer Tourismus“ und „Volksabstimmungen“ sind Lösungen, die alle sehr gut zu den angesprochenen Problemen passen.
„Die Gesellschaft, die wir aufbauen, verfügt nicht über die traditionellen Instrumente und Waffen der neoliberalen Staaten, wie Armee, Grenzen und nationalistische Ideologien“, so ein Mitglied der EZLN. Nicht schlecht für eine Organisation, die sich selbst die Zapatistische Nationale Befreiungsarmee nennt. Kein Geringerer als Subkommandant Marcos bekräftigt in seinem letzten Gruß, nachdem er poetisch gesagt hat, dass „der Kreis der Macht sich um die Rebellen schließt, die dennoch jederzeit die ganze Menschheit hinter sich haben“, politisch versichert: „Wir Zapatisten haben vorgeschlagen, für eine bessere Regierung hier in Mexiko zu kämpfen.“ Wie du siehst, funktioniert der zapatistische Diskurs auf drei Ebenen: die „revolutionäre Regierung“ für die Leninisten; die Verteidigung der Demokratie gegen den „Neoliberalismus“ für die Militanten der linken Parteien; die Poesie gegen die „Macht“ und den Mythos der souveränen Vollversammlung für die Libertären. Aber der Reformismus bleibt genau das, selbst wenn er zu den Waffen greift, selbst wenn er die Mächtigen schlecht redet oder neben Arbeit auch Gerechtigkeit und eine neue Verfassung fordert; selbst wenn er das Recht zu tanzen verlangt.
Es ist klar, dass ein Slogan wie „für die Menschlichkeit gegen den Neoliberalismus“ alle Geschmäcker anspricht, genauso wie es klar ist, dass der Begriff „Hoffnung“ einen religiösen Beigeschmack hat. Trotzdem ist es sinnvoll, den tatsächlichen Inhalt des Zapatismus zu kritisieren, und zwar nicht, um die Revolten in Mexiko oder anderswo zu unterschätzen (was nicht mit ihrer spektakulären Darstellung und ihrem kommerziellen Konsum verwechselt werden sollte). Im Gegenteil, sie zielt darauf ab, sie besser zu verstehen und ihre Globalität zu verwirklichen; den Bereich der subversiven Theorie und Praxis zu erkennen, der durch das Spektakel der Revolution und der Bewegungen, die nichts als reformistische Negation darstellen, kolonisiert wurde. Mit anderen Worten: Eine antiautoritäre und subversive Internationale, eine Internationale, die es wirklich versteht, die Todesprojekte des Staates zu stören, muss erst noch erfunden werden. Ihr Gegenteil zu erkennen und zu kritisieren ist nur der erste Schritt.
Massimo Passamani.
Zur Einführung…
(…) ich mache hier die Schranken der Gegenwart und Vergangenheit nicht zu Schranken der Menschheit, der Zukunft (…)
Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums.
Denn sofortige Bewunderer und plötzlich Überzeugte sind selten das Salz der Erde.
B. Traven, Dans l’Etat le plus libre du monde.1
Es ist nicht unsere Absicht, die kollektive Revolte der Proletarierinnen und Proletarier von Chiapas auf die Organisationsformen zu reduzieren, die sie sich selbst gegeben haben oder, und das muss noch bestätigt werden, die sich selbst auf ihren Kampf aufgepfropft haben. Wir glauben, dass es eine Beziehung zwischen den beiden Dingen gibt, eine Beziehung, die es zu Recht verdient, analysiert zu werden.2 Die Aufgabe derjenigen, die sich für soziale Emanzipation entscheiden, muss immer danach streben, so weit wie möglich das zu betonen, was in einem Kampf autonom ist, und die Organisationen zu kritisieren, die behaupten, die Kämpfenden zu vertreten. Das bedeutet, dass man sich von jeglicher Bevormundung distanzieren muss, die per Definition unegalitär ist und dazu neigt, die Ausgebeuteten im Kampf in bestimmte Kategorien einzuschließen, die auf ihrer Identität beruhen oder nicht. Wer bereit ist, für andere das zu akzeptieren, was für ihn selbst inakzeptabel ist, ist nahe dran, das Unannehmbare zu akzeptieren. Im Namen der Taktik werden künftige Forderungen als rückläufig betrachtet. Wer im Wesentlichen nachgibt, wird zum Jünger des Realismus und fällt hinter die staatstragenden Projekte der hierarchischen Organisationen zurück.
Gegen Ende der 80er Jahre wurde ein Freund, ein Verleger in Madrid, zur Buchmesse in Managua (Nicaragua) eingeladen. Damals waren die Zeiten für die Bewunderer des autoritären Sozialismus einfacher: Die Kommandanten versprachen, dass die glorreiche Zukunft in ihrem kleinen Land nahe sei. Am Flughafen entdeckte ein eifriger Beamter (natürlich ein Revolutionär) anarchistische Texte im Gepäck unseres Freundes und beeilte sich, sie zu beschlagnahmen. Auf seinen Protest hin erklärte ein politischer Kommissar (noch revolutionärer), dass diese Bücher nicht in Umlauf gebracht werden dürften, sondern den Bestand der Bibliothek des Sandinistischen Komitees bereichern würden. So könnten sich die Kommandanten mit Ideen vertraut machen, die für das Volk verboten seien. Wie wir wissen, ließen ihnen die Arroganz des amerikanischen Imperialismus und der Zusammenbruch der UdSSR keine Zeit. Damals gaben die Libertären ihre Energie, manchmal sogar ihr Leben, für die sandinistische Revolution. In aller Aufrichtigkeit, aber auch in aller Naivität. Heute könnte man fragen, was aus diesen Texten geworden ist: Wurden sie „der nagenden Kritik der Mäuse unterworfen“? Wurde die Bibliothek von den neoliberalen Idioten privatisiert, die die sandinistischen Bürokraten ablösten und nun in der Geschäftswelt recycelt werden? Wie dem auch sei, die Menschen in Nicaragua, die in das Elend der postrevolutionären Katastrophe gestürzt sind, haben die glorreiche Zukunft verpasst, die ihnen versprochen wurde, und haben Bakunin immer noch nicht gelesen…
Im Goldenen Zeitalter des „wirklich nicht existierenden Sozialismus“ wurden Reisen in die Länder der glorreichen Zukunft organisiert. Die Frommen wurden eingeladen, ihre Begeisterung für eine Realität zu zeigen, die von den Gutsherren inszeniert wurde. So besuchte man die UdSSR des sowjetischen Sozialismus, das China des maoistischen Sozialismus, das Albanien des Miniatursozialismus, das Kuba des bärtigen Sozialismus, das Nicaragua des sandinistischen Sozialismus, usw. Wehe dem, der die objektive, wissenschaftliche und unbestreitbare Natur dieser erfundenen Realitäten anzweifelte. Bis zu dem Tag, an dem diese Systeme zusammenbrachen. Wir dachten, wir hätten gesehen, aber wir hatten nichts gesehen! Haben wir aus all dem etwas gelernt? Offensichtlich nicht! Heute hat sich das Epizentrum der Revolte in diesen Regionen nach Norden verlagert. In den lakandonischen Wäldern und ihrer Umgebung wurden die etablierten Wahrheiten der traditionellen marxistisch-leninistischen Politik durch die Umwälzungen in der Welt auf den Kopf gestellt. Da eine neue Weltordnung die alte Zweiteilung in zwei Blöcke ersetzt hat, haben die politischen Kommissare ihre Identität aktualisiert und sind sogar bereit, Bakunin zu zitieren, auch wenn sie aus Vorsicht die theologischen Texte der christlichen Befreiung oder sogar Shakespeare vorziehen. Das genügte den Libertären in Frankreich und Navarra, um sich davon zu überzeugen, dass es diesmal wirklich so war und dass eine politische und militärische Bewegung Trägerin der Ideale der sozialen Emanzipation werden konnte. War es die bloße Erwähnung von Zapatas Namen und die Erinnerung an „Mexiko-auf-der-Spitze-des-Vulkans“, die sie verleitete? Wie kann man sich naiv in die Unterstützung einer Bewegung stürzen, die als Vehikel für die Werte von Identität und Patriotismus fungiert, und das mitten in den barbarischsten Gegenden der Welt?3 Diese Anhänger des Zapatismus wiederum sind nicht in der Lage, uns Informationen oder direkte Berichte über die tatsächlichen Geschehnisse auf dem mexikanischen Land zu liefern, sei es über die Besetzungen, die von den kämpfenden Bauern gewählten Organisationsformen oder ihre politischen Ziele und Perspektiven4. Sie sind ebenso wenig in der Lage, auch nur das kleinste Element der Kritik zu liefern, das es uns ermöglichen würde, unser Verständnis der avantgardistischen Organisation, die den bewaffneten Kampf anführt, zu vertiefen. Schließlich ist die Unterstützung für die EZLN ein Gefangener ihres im Wesentlichen nationalistischen Charakters geblieben. Während die soziale Lage in allen Gesellschaften Lateinamerikas explosiv geworden ist und sich die Bewegungen zur Landfrage mehr oder weniger überall ausbreiten und radikalisieren, bleiben die Komitees, die die EZLN unterstützen, auf Mexiko fixiert. Ihr Desinteresse an den Revolten und den jüngsten Massakern an den verarmten Bauern in Brasilien ist signifikant.5 Natürlich begünstigt das Fehlen charismatischer Anführer nicht die Inszenierung eines Medienspektakels.
Die Unterstützungsbewegung für die EZLN ist dabei, die Krise zu offenbaren, in der libertäre und sozialistische Kreise debattieren. Die Anarchistinnen und Anarchisten und allgemein die libertären Strömungen scheinen vom Zusammenbruch des staatskapitalistischen Modells mit voller Wucht getroffen worden zu sein. Während einige erwartet hatten, dass sie das ideologische Vakuum, das dieser Zusammenbruch hinterlässt, ausnutzen würden, ist genau das Gegenteil passiert. Diese Strömungen wurden in die Ohnmacht getrieben, und die Verwirrung ist groß. Was paradox erscheinen mag, ist es nicht wirklich, wenn man bedenkt, dass die Dynamik und die polemische Energie dieses Milieus durch die Existenz eines „Bruderfeindes“ angeheizt wurde. Sobald die antikommunistische Dimension verschwand, blieb die libertäre Strömung mit ihrer Schwäche bei der Analyse des modernen Kapitalismus zurück, der inzwischen zu einem globalen System geworden ist. Viele von ihnen sind aufgrund ihres kurzsichtigen Aktivismus nicht mehr in der Lage, kritisches Denken zu entwickeln. Das Ergebnis ist, dass sie in die Richtung des sozialdemokratischen Humanismus geführt werden. Nur diejenigen, die an den Prinzipien einer staatsfeindlichen und antikapitalistischen libertären Ethik festhalten, schaffen es zu überleben. Unter den Jüngern des Zapatismus herrscht große Verwirrung. Ohne das geringste Zögern geht man von Marcos zu Guy Debord über, soziale Bewegungen, die sich in offener Revolte gegen das System befinden, werden mit den großen patriotischen Massen der EZLN auf eine Stufe gestellt. Alles ist gleich, und es herrscht Unklarheit. Noch gravierender ist, dass sich dieses Milieu bereitwillig den identitätsbasierten und nationalistischen Ideen unterwirft, die den Kern des zapatistischen Projekts bilden. Zunächst wurde versucht, diese Unterstützung im Namen der Taktik abzuschwächen. Jetzt werden Stimmen laut, die das beibehalten wollen: „Auch wenn die Idee der Nation durch den ideologischen Gebrauch der Bourgeoisie besudelt wurde, bewahrt sie die Idee der pluralistischen Freiheit, die den politischen Parteien fehlt. Auch wenn die Nation auf einen rein fiktiven Zustand reduziert wurde, trägt sie immer noch die Idee der Emanzipation in sich.“6 Das lässt erahnen, welche Strecke in so kurzer Zeit zurückgelegt wurde! In diesem Sinne offenbart die Vernarrtheit in die Zapastistas die Krise breiter Teile des libertären Milieus, die nicht in der Lage sind, internationalistische Positionen angesichts der Konsequenzen der sich vollziehenden kapitalistischen Globalisierung zu verteidigen .
Paris, Mai 1996
Jenseits der Sturmhauben im Südosten Mexikos
Die Gemeinden der Indigene: Mythos oder Entfremdung?
Der autoritäre Charakter der Maya- und Inka-Gesellschaften ist heute eine anerkannte Tatsache. Trotzdem hält sich der Mythos einer idyllischen indianischen Gemeinschaft hartnäckig. Dieser Mythos wird zum Teil durch die Vorstellungen, die die Menschen von Gemeinschaft haben, aufrechterhalten. Als ob die gemeinschaftliche Form vorkapitalistischer Gesellschaften eine straff strukturierte Hierarchie, zentralisierte Macht und barbarische Formen der Ausbeutung von Arbeitskräften irgendwie ausschließen würde. Bei den Mayas zum Beispiel, zu deren Gebiet das heutige Chiapas gehörte, diente die Mehr(wert)arbeit der Bauern dazu, eine Minderheit von Aristokraten und Priestern zu ernähren, die die herrschende Klasse dieser Stadtstaaten bildeten.7 Wenn man von „lokalen Traditionen der demokratischen Entscheidungsfindung“ spricht und die Regeln, nach denen sie sich richteten, als Formen primitiver Demokratie darstellt, ignoriert man die Autorität der Ältesten und Häuptlinge, die von einer zentralen Theokratie abhängig waren, die ihre Befehle durchsetzte und ihre Interessen verteidigte. Die Organisation der sozialen Beziehungen ließ wenig Raum für Anfechtungen oder gar Diskussionen. In diesen Gemeinschaften war die Solidarität die der Verengung. Entscheidungen über die grundlegenden Probleme des materiellen Lebens entgingen den Mitgliedern dieser Gemeinschaft, und der soziale Zusammenhalt beruhte auf der Unterordnung unter die Autorität. Zu diesem Thema genügt es, auf aztekische Abhandlungen zu verweisen, die die Normen und Prinzipien verbreiteten, die das soziale Leben leiten sollten: „Sei liebevoll, dankbar, respektvoll; sei ängstlich, schau mit Furcht, sei unterwürfig, tu, was das Herz deiner Mutter wünscht, und auch das deines Vaters, denn es ist ihr Verdienst, ihre Gabe; denn sie haben von Rechts wegen Anspruch auf Dienst, Unterwerfung, Ehrerbietung. […] Erniedrige dich, verneige dich, senke dein Haupt, verneige dich!“8.
Im 9. Jahrhundert verfiel das Maya-Reich, das von den Azteken besiegt wurde, dem Niedergang. Der Autoritarismus, der die sozialen Beziehungen durchzog, verschwand trotzdem nicht, obwohl der Zusammenbruch des alten politischen Systems den Stämmen und Gemeinschaften mehr Autonomie ließ, vor allem denjenigen, die an den Rändern des Reiches lebten. Sie zollten ihren neuen Herren weiterhin Tribut, hielten sich aber dennoch an die alten Regeln der Hierarchie. Diese neue Situation erklärt den Widerstand, den einige Maya-Stämme gegen die europäischen Eroberer leisteten. Wir wissen, dass die Spanier militärische Siege über die „strukturierten“ Reiche leichter errangen als über die Stämme, die nicht in staatsähnliche Formen eingebunden waren. Das lässt sich leicht erklären. Die Bewohner eines Reiches wie der Inkas waren bereits an die corvées (Zwangsarbeit) für den Kaiser oder für die Tempel der Sonne und des Mondes gewöhnt. Der Übergang vom Kaiser zum spanischen encomendero verlief sicherlich nicht friedlich, sondern wurde durch die Anwendung von Gewalt ermöglicht. Bei den freien Völkern ohne staatlichen Rahmen hingegen reichte die Gewalt nicht aus: Der Krieg wurde zum Massaker und die Überlebenden wurden in die Sklaverei getrieben.9 Die Maya-Stämme in der Peripherie befanden sich in einer Zwischensituation. „Im Gegensatz zu den Azteken gab es keine zentrale Autorität, die hätte gestürzt werden können und das ganze Reich mit sich gerissen hätte. Genauso wie die Mayas keinen Krieg im üblichen Sinne führten. Sie waren Dschungel-Guerillas.“10 Auf diese Weise erhielt diese Region seit der Eroberung eine Besonderheit, die sich auf die Bildung der mexikanischen Nation auswirken sollte.
Nach ihrer Versklavung durch die bürokratischen Imperien und die europäischen Kolonialherren wurden diese indianischen Menschen von der kapitalistischen Maschinerie zerschlagen. Nachdem sie von ihrem Gemeindeland vertrieben worden waren, wurden viele Indigene zu Proletariern, die der Gewalt des Lohnarbeitsverhältnisses ausgesetzt waren. Diejenigen, die sich heute als Vertreter der „indianischen Gemeinschaften“ präsentieren, vergessen nie, patriotisch ihre Verbundenheit mit den Idealen der mexikanischen Unabhängigkeit zu verkünden! Doch wir wissen, dass dies ein entscheidendes Element bei der Umwandlung der indigenen Bevölkerung in arme Bauern und landlose Proletarier war. Fast ein Jahrhundert später stammten diejenigen, die während der mexikanischen Revolution den größten Teil der zapatistischen Armee stellten, aus dem Bundesstaat Morelos, „praktisch dem einzigen südlichen Bundesstaat, in dem überall kapitalistische Produktionsverhältnisse herrschen“11.
Wenn es ihre Verbundenheit mit den Sehnsüchten eines vergangenen indianischen Gemeinschaftslebens war, die ihre Revolte angestachelt hatte, erklärt dies auch ihre Unfähigkeit, in ihrer Emanzipation weiterzukommen. Diese Bauern und Bäuerinnen waren tief in ihrem Land und ihren Traditionen verwurzelt. Sie kämpften vor allem für die Wiederherstellung des enteigneten Gemeindelandes und für das Recht, ein individuelles Grundstück zu besitzen. Für diejenigen, die nach der historischen Wahrheit jenseits der Legende suchen, scheint es, dass „die zapatistische Bewegung weder sozialistisch noch ‚fortschrittlich‘ in dem Sinne ist, dass sie ganz Mexiko revolutionär verändern will. (…) Sie ist nur insofern ‚revolutionär‘, als sie eine Antwort auf die Bestrebungen einer kommunitären indianischen Vergangenheit war (…). Sie setzt weder einen Bruch voraus noch schlägt sie ihn vor.“ Oder, wenn man es vorzieht: „Der Traditionalismus der zapatistischen Bewegung war die Grundlage für ihre Einsamkeit und Isolation und vor allem für ihre Ungereimtheiten, Zweideutigkeiten und tiefgreifenden Widersprüche. Und diese Originalität ermöglichte ihr das Überleben; gleichzeitig legitimierte sie ihre Unfähigkeit, sich dynamisch in Richtung Selbsttransformation zu entwickeln und ihr regionales ‚Ghetto‘ wirklich zu verlassen.“12 Außerdem ist es bezeichnend, dass es der Regierung im selben Zeitraum gelang, die aufständischen Yaquis vorübergehend zu befrieden, indem sie ihren Häuptlingen versprach, ihnen das Gemeindeland zurückzugeben und Kirchen zu bauen… 13…. Mit dem Ende der Revolution hat die Expansion des Kapitalismus die Zerstörung der traditionellen Formen der indianischen Gemeinschaft beschleunigt, indem die meisten ihrer Mitglieder in die „Gemeinschaft des Kapitals“ integriert wurden.
In Chiapas wurde der Prozess der kapitalistischen Modernisierung durch die Stärke der Großgrundbesitzer, die dort auf fast feudale Weise herrschten, lange Zeit verzögert. In einer Region, in der die Revolution nur wenige Umwälzungen verursacht hatte, konnten sie von der Geschlossenheit und dem Traditionalismus der indianischen Gemeinschaften profitieren und die von ihnen Ausgebeuteten gegen den offiziellen Plan der Agrarreform und der Befreiung der Leibeigenen mobilisieren.14 Dieser Widerstand gegen die zentrale Bourgeoisie vereinte Ausbeuter und Ausgebeutete bei der Erhaltung der indianischen Gemeinschaften zum Vorteil der Großgrundbesitzer in Chiapas. Ab den 40er Jahren sollten „die trockenen Berge der Altos del Chiapas, die durch Cardenas‘ heuchlerische Agrarreform geteilt wurden, zu einem perfekten Arbeitskräftepool für die Latifundien des Centro, der Fraylesca und des Soconusco werden, die plötzlich nicht mehr all diese Mäuler außerhalb der Erntesaison zu stopfen brauchten, da sie mehr oder weniger auf dem kommunalen Land überleben konnten.“15 Nach und nach überlebten viele der Gemeinden nur dank der Lohnarbeit der auf den Kaffeeplantagen beschäftigten Indianer.16 Die Ahnenwerte, die in ihrem armseligen materiellen Überleben verwurzelt blieben, sind größtenteils Werte der Unterwerfung.
Diese kamen den Großgrundbesitzern zweifelsohne entgegen. Die Gemeinschaften, deren demokratische und emanzipatorische Traditionen heute zum Mythos erhoben werden, bildeten jahrzehntelang die soziale Struktur, die die Ausgebeuteten in die Hände der Großgrundbesitzer fallen ließ. Erst die Entwicklung der proletarischen Verhältnisse und das damit verbundene Aufbrechen der kommunitären Formen lösten Revolten aus, die Elemente der sozialen Emanzipation enthielten. Die Revolte in Chiapas ist die jüngste Episode in der langsamen und besonderen Integration, die diese Randregion des mexikanischen Kapitalismus durchlaufen hat.
Die Revolte der „Neuen Gehängten“17
Revolten der armen Bauern und Landbesetzungen sind endemische Phänomene in den lateinamerikanischen Gesellschaften. In Mexiko wie auch anderswo wurde die Art dieser Kämpfe von den Erschütterungen aller Gesellschaften der Dritten Welt beeinflusst: Vertreibung der armen Bauern vom Land, soziale Ausgrenzung, Migration, Proletarisierung. Um das Wesen der Revolte in Chiapas zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick auf die Besonderheiten dieser Region und den Platz, den sie in der Entwicklung der sozialen Spannungen in Mexiko einnimmt, werfen.
Aufgrund des Fortbestehens eines quasi-feudalen Besitzsystems gehörten die Bauern der Ejidos (Gemeinschaftsgrundstücke) und die Kleinbesitzer in Chiapas zu den Ärmsten in Mexiko. Trotzdem begannen Ende der 50er Jahre zahlreiche indianische Bauern und Bäuerinnen, die von ihren individuellen Grundstücken vertrieben worden waren, nach Chiapas auszuwandern. Obwohl diese Bewegung im Wesentlichen spontan war, wurde sie von der Regierung gefördert. Die vertriebenen Bauern (expulsados) wurden aufgefordert, sich in den Wäldern niederzulassen. „In sozialer Hinsicht war die lakandonische Grenze ein Sicherheitsventil; eine Region fernab des Machtzentrums, in der die potenziell explosiven indigenen und bäuerlichen Massen aus den tieferen Schichten Mexikos arbeiten konnten. Es war, wenn man so will, ein Naturschutzgebiet für die Ärmsten der Armen.“18 In nur wenigen Jahren siedelten sich über 150.000 landlose Indianer in den Wäldern und Bergen an.19 Wie jede kapitalistische Landverteilung verlief auch diese auf ungleiche Weise. Die Neuankömmlinge fanden sich auf dem ärmsten Land in den Bergen wieder und hatten nie Zugang zu den fruchtbaren Tälern. Kurze Zeit später wurde dieses Land entweder aufgegeben (weil es zu trocken war) oder enteignet (mit Gewalt oder auf legalem Wege). Die Tatsache, dass es sich bei diesen armen Bauern hauptsächlich um Indianer handelte, erleichterte es den wohlhabenden, mit der Agrarindustrie verbundenen Landbesitzern, sich ihr Land anzueignen.
Die Bedingungen für das Entstehen neuer sozialer Konflikte waren nun gegeben, und das „Sicherheitsventil“ wurde zu einer Zeitbombe. Der Niedergang der alten indianischen Gemeinschaften ging einher mit der Entstehung einer neuen armen Bauernschaft, die sich aus einer gemischten Bevölkerung (Maya und Nicht-Maya-Indianer und Métis) zusammensetzte. Bereits Anfang der 70er Jahre begannen die alten Gemeinschaften, die in der Vergangenheit strukturiert worden waren, die Auswirkungen eines intensiven Prozesses der internen sozialen Differenzierung zu zeigen, der ihre Mechanismen des Zusammenhalts und der Selbstverteidigung auffraß. Bauern und Bäuerinnen, die weder Land noch Arbeit hatten, begannen, sich in den elenden Vororten (der Städte von Chiapas) zu konzentrieren. „Anfang der 80er Jahre hatte sich die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte verdoppelt, während gleichzeitig die Politik der verbrannten Erde der Regierung Rios Montt in Guatemala mehr als 80.000 Maya-Flüchtlinge nach Chiapas trieb, die aus dem Nachbarland flohen, um sich der Reservearmee von Arbeitskräften auf der mexikanischen Seite der Grenze anzuschließen.“20 Die enteigneten Indianer wurden oft an den Rand gedrängt, da die Landbesitzer es vorzogen, sie durch guatemaltekische Arbeiterinnen und Arbeiter zu ersetzen, die noch prekärer lebten und sich oft illegal im Land aufhielten.21
Kurz gesagt: „Das alte System des Kaufs und Verkaufs und der Reproduktion der Arbeitskräfte wurde also unterbrochen, ohne dass es durch ein neues System ersetzt wurde, das in der Lage war, eine wachsende Masse von arbeitslosen Arbeiterinnen und Arbeitern in der Landwirtschaft aufzunehmen. Verzweiflung und Krise hatten begonnen, ihre perversesten Auswirkungen zu entfalten.“22 Die Sozialstruktur erfuhr einen tiefgreifenden Umbruch. Die Entflechtung des ländlichen Raums ging mit einer chaotischen, unkontrollierten Verstädterung der Gemeinden einher. Heute kann man in Chiapas wie in Guatemala alle Formen der Enteignung sehen, die die indianischen Gemeinden bedrängen“23.
In Mexiko war die Verbundenheit der armen Bauernschaft mit dem Land von den Bestrebungen der gemeinschaftlichen indianischen Vergangenheit durchdrungen und wurde durch das Erbe der Revolution verstärkt. Diese Bestrebungen verblassten mit der Enteignung des Gemeindelandes und der Einführung des Kapitalismus auf dem Lande. Ein paar Hinweise können helfen, dies zu verstehen und den Mythos des Kommunitarismus zu überwinden. Das Familieneigentum an kommunalem Land war der erste Schritt dieser Enteignung. Obwohl fast ein Drittel des Landes Teil der Ejidos ist oder den Kleinbauern gehört, werden nur 10 % der Ejidos kollektiv bewirtschaftet. Außerdem sind die meisten Bewirtschafter der Ejidos (etwa 80 %) jetzt gezwungen, für die Großgrundbesitzer zu arbeiten, wenn sie überleben wollen, was einen Eindruck davon vermittelt, wie arm das Gemeindeland ist. In den 80er Jahren wurde die Enteignung der Ejidos überall beschleunigt. Durch die Verschuldung der Bauern und Bäuerinnen griff der Bankensektor nach dem Gemeindeland und zwang die armen Bauern und Bäuerinnen, „Partner“ der reichen Grundbesitzer zu werden.24 Die Krise des Gemeindelandes führte so zu einem schnellen Prozess der Proletarisierung der Bauern und Bäuerinnen. In einem solchen Kontext, der von der privaten Form des Landbesitzes dominiert wurde, gingen die Forderungen der Bauernkämpfe selten über die Grenzen der kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse hinaus. Es ist nur natürlich, dass die avantgardistischen politischen Organisationen, die sich parallel zu den ländlichen Bewegungen entwickelten, die Achtung des Privateigentums an Grund und Boden zu einem der Grundelemente ihres eigenen reformistischen Kampfes machten. Die Revolte in Chiapas fand statt, als sich dieser Prozess seinem Ende näherte. Als letzte Region, die unter den Auswirkungen der Enteignung kommunaler Ländereien zu leiden hatte, wurde Chiapas zu einer Pufferzone, in der sich alle Probleme des Landes konzentrierten, und wurde genau zu dem Zeitpunkt zum Pulverfass Mexikos, als die Globalisierung der Ökonomie auf der Tagesordnung stand. Diese Revolte ist eine Revolte aller Ausgeschlossenen, der landlosen und arbeitslosen Proletarier, der ausgegrenzten, armen Bauern und städtischen Lumpenproletarier, die dort festsitzen, wo sie sind, zwischen dem Wald, den Bergen und dem Meer. Es ist die Revolte der „neuen Gehängten“. Tatsächlich hat die Masse der jungen Menschen keinen Zugang zum Land und kann in den Städten keine Arbeit finden.25 „Heute besteht die zapatistische Armee hauptsächlich aus dieser Masse junger, moderner, emanzipierter Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen und einige Erfahrung mit Lohnarbeit haben. Sie haben nicht viel Ähnlichkeit mit den isolierten Indianern, die man sich vorstellt.“26 Wer darauf besteht, die Revolte als eine spezifisch indianische Bewegung darzustellen, verweigert sich selbst die notwendigen Mittel, um sie zu verstehen. Wer nicht über die demokratischen Forderungen der EZLN hinausgeht, verkennt, dass die politischen Ziele der Organisationen, die im Namen der beteiligten Völker sprechen, möglicherweise nicht mit deren Wünschen und Wut übereinstimmen. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass die jungen Rebellen in Chiapas für Land kämpfen, egal ob es sich um privates oder kollektives Land handelt.
Von Mao zu Marcos: Der Erfolg der EZLN
Im Oktober 1968 massakrierte die mexikanische Regierung, verblüfft von der Größe einer beispiellosen Studentenbewegung, rund 300 Demonstranten auf der Plaza der drei Kulturen in Mexiko-Stadt. Gleichzeitig wurde eine brutale Repression gegen die Organisationen der extremen Linken eingeleitet. Nach diesen tragischen Ereignissen beschloss die marxistisch-leninistisch-maoistische Gruppe Politica Popular, das Studentenmilieu zu verlassen und ihre Aktivitäten auf die „arbeitenden Massen“ zu konzentrieren. Sie siedelte sich in den Städten im Norden des Landes an, wo durch die Landflucht riesige Gebiete mit Elendsvierteln entstanden waren – ein günstiges Terrain für militante Linke. Ihr Ziel war es, „rote Basen“ zu schaffen: ein Netzwerk von Organisationen, die alle Bereiche des sozialen Lebens abdecken und die Kontrolle über diese armen Gebiete erlangen sollten. Die Taktik wurde von den linken Tendenzen der chinesischen Kulturrevolution übernommen: Die politische Führung der Organisation sollte nie an die Öffentlichkeit treten, sondern ihre Entscheidungen immer als Ergebnis von Beratungen mit den Massen in Komitees und Vollversammlungen präsentieren. Dies ist das klassische Projekt einer autoritären Avantgarde-Organisation, die Massen von Menschen übernimmt und manipuliert, indem sie sich mit dem demagogischen Diskurs der Basisdemokratie maskiert. Bei der Organisation ihrer „politischen Arbeit“ auf diesem Terrain trafen die mexikanischen Maoisten unweigerlich auf ältere militante, progressive katholische Priester. Maoisten und Priester, die beide um die Kontrolle über dieselben Massen konkurrierten, kamen schnell zu einer Einigung. Aus ihrer wundersamen Zusammenarbeit entstand der „Torreonismus“ (nach der großen Stadt Torreon im Norden), das mexikanische Modell für die „Arbeit an den Massen“.27 Mitte der 70er Jahre setzte die mexikanische Regierung, beunruhigt über den Erfolg dieser Strömung, eine brutale Repression gegen sie in Gang, in deren Verlauf viele militante Mitglieder getötet wurden. Auch hier revidierte die Führung der Organisation ihre Positionen: Die „Massenlinie“, die den Schwerpunkt auf die politische Arbeit in den städtischen Gebieten legte, wurde durch die „proletarische Linie“ ersetzt, die den Schwerpunkt auf die Verankerung unter den armen Bauern und Bäuerinnen legte. Die Verabschiedung dieser neuen Linie bedeutete für die mexikanischen Maoisten den Rückzug in Gebiete, in denen sie glaubten, weniger Repressionen ausgesetzt zu sein: Es war ihr „Langer Marsch“. Dies war eine unruhige Zeit im Leben der Gruppe, die durch eine ganze Reihe von gescheiterten „Einpflanzungen“, Spaltungen, Verzicht und internen Abrechnungen gekennzeichnet war.28 Erst Ende der 70er Jahre trafen die ersten „Brigaden“ der maoistischen Avantgarde in Chiapas ein, wo sie auf ihre „Mitstreiter“ aus der „fortschrittlichen“ Kirche trafen, die bereits in den armen Bauerngemeinden präsent waren.
Es ist heute nicht einfach, einen klaren linearen Zusammenhang zwischen der Zeit, in der sich diese Organisation etablierte, und der Geburtsstunde der EZLN herzustellen. Sicher ist jedoch, dass es diese Verbindung gibt. Nach einiger Zeit kamen andere maoistische Gruppen in Chiapas an. Marcos selbst gehörte anscheinend zu einer der letzten „Brigaden“29 Viele militante und politische Anführer verschwanden infolge der gnadenlosen Repression durch die Armee und die von den Großgrundbesitzern eingesetzten Söldner. Die Überlebenden mussten einige ihrer Ideen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten überarbeiten. Schließlich ist bekannt, dass die grundlegende Taktik der linken Maoisten in den Bauernkämpfen wieder auftauchte: der ständige Rückgriff auf Vollversammlungen als Mittel, um die politische Führung zu verstecken und zu schützen.
Wie ihre peruanischen Pendants vom Leuchtenden Pfad (Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso) hatten die mexikanischen Maoisten auf ihre Weise die guevaristische Idee des Foquismo30 (Aufstandsherde) kritisiert. Sie hatten verstanden, dass die politische „Einpflanzung“ zum Scheitern verurteilt war, wenn sie sich auf Aktionen einer kleinen Gruppe beschränkte, die in geschlossenen indianischen Gemeinden abgesetzt wurde, die allem, was von außen kam, feindlich gegenüberstanden. Aus taktischen Gründen verkündeten sie von Anfang an die Einzigartigkeit der indianischen Kultur. Die kleinen Gruppen von Militanten mussten sich in die Gemeinden integrieren, indem sie u. a. ihre Verbindungen zur „indigenen Kirche“ nutzten. In einer zweiten Phase passte die politische Organisation ihre Vorstellung von Führung an die neuen historischen Bedingungen an, die durch den Zerfall der ländlichen Gemeinschaften und die Proletarisierung der indianischen Bauern gekennzeichnet waren. Die Gründung von Bauernverbänden entsprach dieser zweiten Phase. Im Jahr 1991 wurde die „Unabhängige Bauernallianz Emiliano Zapata“ zu einer nationalen Organisation. Dies bedeutete einen grundlegenden politischen Sprung: Die Arbeit zur Schaffung einer „Massenbasis“ war abgeschlossen und die „regionalistischen“ Vorstellungen – die von den autarken indianischen Gemeinschaften gefordert und von der „indigenen Kirche“ verteidigt wurden – waren überholt. Die Zeit für bewaffnete Aktionen war gekommen. Nach diesem Modell sollte die Gründung der militärischen Organisation die letzte Phase eines langen politischen Prozesses der „Einpflanzung“31 in die lokale Bevölkerung sein. Heute ist die zapatistische Armee, die aus diesen „Massen“-Organisationen hervorgegangen ist, lediglich eine der Strukturen der Organisation; sie ist ihr sichtbarer Teil. Die Texte der EZLN und die Aussagen von Marcos kommen oft auf diese Frage zurück. Der Erfolg der neo-zapatistischen Organisation erklärt sich zu einem großen Teil aus der politischen Intelligenz, die ihre militanten Mitglieder während dieser langen Zeit an den Tag legten.
Dennoch wird die Strategie der EZLN von anderen Strömungen der mexikanischen avantgardistischen extremen Linken kritisiert, die Zweifel an ihren Erfolgschancen haben. Sie bezeichnen die EZLN als „reformistische bewaffnete Organisation“, deren soziale Isolation ihre Betonung auf Verhandlungen erklärt: „Wie kann eine nationale Befreiungsarmee behaupten, über ihr eigentliches Ziel, die Macht zu ergreifen, zu verhandeln? Und wie kann man mit dem Staat über ein solches Ziel verhandeln?“32 Die EZLN hat sich offensichtlich ein Medienimage aufgebaut, das nicht ihrem wahren Wesen entspricht, mit dem taktischen Ziel, ihre eigene Schwäche zu verschleiern. Zunächst zur Avantgarde: „Die EZLN behauptet weiterhin, sie sei keine Avantgarde. Das führt zu Verwirrung. Natürlich ist eine Avantgarde genau das, was sie sind, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. Es kommt darauf an, was du tust, nicht was du sagst. Wenn du anfängst zu kämpfen, wenn du Menschen in verschiedene Lager bringst, dann musst du die Verantwortung dafür übernehmen, den Widerstand organisieren und die beteiligten Kräfte koordinieren.“33 Zur Frage der Friedensforderung: “Frieden ist für die herrschenden Klassen in Ordnung. Sie haben schon immer ‚mit dem Frieden‘ gelebt und so haben sie ihre Macht erhalten. (…) Marcos ruft ständig nach der Unterstützung von Teilen der Gesellschaft, die, wenn es ernst wird, nichts mehr von den Zapatistas hören wollen.“34 Die EZLN hat keine Wahl: Sie muss auf Zeit spielen und eine Unterstützungsbewegung außerhalb von Chiapas aufbauen, daher der ständige Appell an die ‚Zivilgesellschaft‘. Doch auf lange Sicht führt das Beharren auf Verhandlungen unweigerlich zu einer Stagnation der Positionen der Organisation und dem Ende der Unterstützung von außen. ‚ Was den Zapatistas in Realität aber gerade grausam fehlt, ist massive Unterstützung von der Straße, wie im Januar (1995), als sie einen Waffenstillstand forderten. Und die viel zu wenig kritisierte Vagheit der „Zivilgesellschaft“, die sich nur als kläglicher Umschlag ohne eigene Kraft entpuppt. Der einzige Ort, an dem sie eine starke Realität ist, ist hier. Und die Menschen vor Ort ziehen es vor zu sagen: „Das Volk in der Rebellion“35 Hier sind wir beim Kern unserer Kritik angelangt. Die Originalität der EZLN ist im Begriff, zu ihrer größten Schwäche zu werden. Zehn Jahre lang konnte diese Bewegung von den besonderen Bedingungen in einer geografisch isolierten Region profitieren, in der es keine Probleme mit den Sicherheitskräften und bewaffneten Auseinandersetzungen gab. Diese Isolation, die es ihr ermöglichte, sich leicht zu entwickeln, ist nun zu einer Falle geworden. Sobald die EZLN offen auftrat, wurde sie militärisch eingekreist, isoliert und jeder Rückzugsmöglichkeit im Falle eines Angriffs durch die mexikanische Armee beraubt.36
Indigene Demokratie im Zeitalter des Internets
Die Kontrolle der Sprache ist ein Aspekt des bürokratischen Charakters der EZLN. Die Stimmen der Rebellen in Chiapas werden auf eine einzige reduziert, die im Namen aller anderen spricht und schreibt. Die Tatsache, dass einige der kaviar-linken Bourgeois Marcos aufgrund eines elitären Verständnisses verteidigen, ist kaum überraschend. Er ist ein „Künstler“ und „der beste zeitgenössische lateinamerikanische Schriftsteller“, der Vertreter „einer Handvoll sehr begabter junger Menschen“. „Er (Marcos) spricht nicht in ihrem Namen, er macht seine Gefährten zu Figuren in Erzählungen oder Kurzgeschichten. Mit dieser zur Schau gestellten, aber kollektiven Subjektivität erfindet er eine neue Art, ‚Ich‘ zu sagen, die wie ‚wir‘ klingt, ohne sich selbst zu ersetzen, ein offenes und wandelbares ‚Ich‘, das jeder so nehmen kann, wie er will, und das er auf seine eigene Weise erweitern kann.“37 Enthusiastische Militante sind gelegentlich von dem Spektakel des Subcomandante verunsichert. Sie geben sich alle Mühe, uns zu versichern, dass Marcos im Namen des Volkes spricht, dessen Sprecher er lediglich ist. Es besteht keine Gefahr von Caudillismus. Aber wie kannst du die Stimme des Volkes erkennen, wenn du nur Marcos hörst? Das kann natürlich nur Marcos! Und wir drehen uns im Kreis. Andere schließlich haben keine Angst vor dem Gestank des Totalitarismus und erklären das: „Die Maske sagt, dass alle durch den Mund eines Mannes sprechen können. Die Maske sagt, dass niemand unersetzlich ist.“38 Weil alle gleich sind, könnten wir zynisch hinzufügen. Der Subcomandante seinerseits rechtfertigt sich: „Das Neue ist nicht die Abwesenheit des Caudillo, sondern die Tatsache, dass er ein gesichtsloser Caudillo ist.“39 Für uns ist die Anonymität des Anführers natürlich nicht das Ende des Anführers; im Gegenteil, sie ist die abstrakte Form der Autorität. Der Heldenkult wird nicht verdrängt – er erscheint in seiner reinen Form. Die Moderne präsentiert sich uns in Form einer Karikatur der Vergangenheit: Wir dachten, wir wären die bolschewistische Avantgarde los, nur um bei der Avantgarde des Zorro zu landen. Die EZLN ist Dirigismus mit einer demokratischen Sturmhaube.
Wenn man jedoch die Prosa der EZLN genau liest, erkennt man eine klare Trennung zwischen „uns“ (der Befreiungsarmee) und „ihnen“ (den Massen). Dem aufmerksamen Beobachter fällt es nicht schwer, in diesen Worten die Grundprinzipien des linken Maoismus und des „Torreonismus“ der 70er Jahre zu erkennen. Die zapatistische Organisation entspricht diesem Modell: Vollversammlungen an der Basis, klandestine politische Komitees an der Spitze (das Generalkommando, dem Marcos untersteht). Man sagt uns auch, dass die Organisation sich unermüdlich mit der Basis berät: Es gibt Plebiszite, Vollversammlungen, Volksabstimmungen.
Es ist ein „demokratischer politischer Prozess“, ein „neues politisches Projekt“, eine „autonome Demokratie für alle (sic) Ebenen der mexikanischen Gesellschaft“, eine „neue politische Synthese“ usw. In einem Interview nach dem anderen, in einem Kommuniqué nach dem anderen wiederholt Marcos seine eigene Litanei aus demokratischen Klischees, die sein Publikum gerne hört. Er spricht unermüdlich von den demokratischen Anliegen der EZLN. Das geht so weit, dass scharfe Köpfe im Rausch der schönen Worte zu zweifeln beginnen, ob er selbst auch nur ein Wort davon glaubt. Sobald du über die abgedroschenen Phrasen hinauskommst und versuchst, den wirklichen Inhalt der Strukturen zu erkennen, die die Macht ausüben werden, ist Annäherung die Regel. Der Mann, der das moderne Internet nutzt, um seine eigenen Texte zu verbreiten, entpuppt sich als eingefleischter Anhänger der Vergangenheit: „Wenn eine Gemeinschaft ein Problem hat, trifft sie sich zur Vollversammlung, die Menschen analysieren es und lösen es gemeinsam… Diese Form der Demokratie ist angeboren und natürlich, man muss sie nicht lehren. Sie stammt von unseren Vorfahren und deren Vorfahren und wird ein Leben lang weitergegeben.“40 Man könnte es wagen, nach dem mythischen Gehalt dieser kommunitären Demokratie zu fragen, doch das würde missbilligt werden. Hat man uns nicht gesagt, dass „die indigene Demokratie nicht aus den Zeichensälen kommt. Sie wird bergauf und bergab diskutiert, sie verdichtet sich in der Umgebung, in den Flüssen, den Wasserlöchern und den Höhlen. Du siehst sie nicht, du spürst sie.“41 Sich des respektvollen Schweigens seiner Gesprächspartner sicher, zögert Marcos nicht, dieses Modell der Repräsentation als Regierungsmodell für moderne Gesellschaften vorzuschlagen, scheinbar ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass er damit lediglich eine vereinfachte Version dessen vorschlägt, was bereits existiert. „Lasst uns die Welt so organisieren, lasst uns die Macht ausüben, jemanden ernennen, der uns vertritt; aber wir werden ihn beobachten, und wenn er seine Arbeit nicht macht, werden wir ihn absetzen, ihm die Macht nehmen, so wie es in den indianischen Gemeinschaften gemacht wird“42.
Der patriotische Nationalismus ist neben der kommunitären Demokratie die zweite Säule im Diskurs der EZLN. Ein Beobachter, der mit den Aktionen der EZLN sympathisiert, konnte dennoch nicht umhin festzustellen, dass „Marcos selbst einen fanatischen Patriotismus ausstrahlt“.43 Die patriotische Hysterie, die einer der gröbsten Fehler des maoistischen Extremismus war, konnte sich problemlos an die neue Situation anpassen. Tatsächlich hat die EZLN eine beachtliche Fähigkeit bewiesen, sich an eine Situation anzupassen, die aus dem Zusammenbruch des Staatskapitalismus und dem Ende der Teilung der Welt in zwei Blöcke entstanden ist. Sie ist die erste Guerillabewegung der postkommunistischen Zeit, die versucht, einen Weg zu finden, in der Ära der neuen Weltordnung zu agieren. Ihre marxistisch-leninistischen Kader haben den ausbeuterischen Charakter der zusammengebrochenen Systeme nie kritisiert. Manchmal gehen sie sogar so weit, sie als „Länder, die frei leben konnten“44zu bezeichnen. Meistens beschränken sie sich darauf, das Verschwinden dessen festzustellen, was für sie Sozialismus war: „Die Sowjetunion ist am Ende – es gibt kein sozialistisches (sic) Lager mehr; in Nicaragua haben wir die Wahlen verloren; in Guatemala wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet; in El Salvador wird über Frieden diskutiert. Kuba ist isoliert; niemand will mehr etwas über den bewaffneten Kampf hören, noch weniger über den Sozialismus; von nun an sind alle gegen die Revolution, egal ob sozialistisch oder nicht.“45 Was bleibt den Marxisten-Leninisten, die die Unterstützung der ‚Bruderländer‘ verloren haben, also anderes übrig, als sich einem kruden antiimperialistischen Patriotismus, dem Lob der Nation und der Achtung der parlamentarischen Demokratie hinzugeben. Die EZLN ist keine Bewegung, die „die Vergangenheit mit der Zukunft vereint“,46 und noch weniger ist sie die „erste Revolution des kommenden Jahrhunderts“. Sie ist eine Bewegung der Vergangenheit, die versucht, sich an die neuen Gegebenheiten einer Gegenwart anzupassen, die keine Zukunft hat. Sie ist die letzte Bewegung alten Stils in einem Jahrhundert, das sich dem Ende zuneigt.
Die Interessen Gottes und die Frauen haben genug
Wir haben gesehen, dass sich die marxistisch-leninistischen Gruppen und die katholische Kirche vor Ort von Anfang an einig waren. Die politischen Militanten passten sich sehr gut an eine „einheimische Kirche“ an, die auf dem Prinzip der Autonomie der Diözesen und der Fähigkeit der militanten Basis beruhte, die Aufgabe der Evangelisierung und der Feier der Messe zu übernehmen. Die Dominikaner, die in Chiapas die Mehrheit stellten, akzeptierten diese Vereinbarung, die es ihnen ermöglichte, ihre „Arbeit an den Seelen der Menschen“ fortzusetzen, während die Maoisten sie als Mittel zur Infiltration der Gemeinden nutzten. Viele indianische Kader der EZLN wurden auf diese Weise rekrutiert, nachdem sie sich vor Ort in den religiösen Gemeinschaften und Bauernorganisationen engagiert hatten.47 Außerdem ist ihr politisches Denken von den vereinfachenden Prinzipien der Befreiungstheologie durchdrungen: Es gibt „falsche Ideen“ und „wahre Ideen“, genauso wie es je nach Perspektive eine falsche und eine wahre Interpretation des Evangeliums gibt. Mehrere Themen der EZLN-Ideologie passen perfekt zu den Positionen dieser religiösen Strömung: Ablehnung der Zentralmacht, Kult der Gemeinschaft usw. Wenn einer der Comandantes sagt: „Wenn Christus sein Leben gegeben hat, wenn er sein Blut vergießen ließ, um seine Brüder zu befreien, dann denke ich, dass wir die gleichen Waffen haben werden“,48 dann wiederholt er damit nur die Behauptung der Befreiungstheologie, die den militanten politischen Kampf als Weg zur Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden darstellt.49 Für die Befreiungstheologie wird der Zugang zur religiösen „Gnade“ durch das Engagement als Militanter erreicht. Gnade ist die Gabe, die einen Menschen überzeugt, zu vertrauen. Aus Vertrauen entsteht Einheit. Und Einheit ermöglicht Organisation. In diesem Sinne steht die Gnade im Gegensatz zur bestehenden Machtstruktur.50
Daher wäre es ein Fehler, daraus zu schließen, dass die Kirche und die EZLN die gleiche Strategie verfolgen. Die Partei, die von der katholischen Kirche vertreten wird, versucht auf ihre Weise, die Situation auszunutzen und die für sie charakteristischen Ziele zu verfolgen. Dies gilt umso mehr, als die protestantischen Sekten seit den 60er Jahren mit den katholischen Sekten um die Kontrolle über die Seelen der Menschen konkurrieren. Zehntausende von indianischen Bauern in Chiapas wurden unter dem Vorwand von ihrem Gemeindeland vertrieben, dass sie zum Protestantismus konvertierten und sich „den Vertriebenen“ in den Bergen anschlossen.51
Die EZLN konnte diese religiöse Konkurrenz nicht ignorieren. Deshalb betont sie ihre Unabhängigkeit von den Kirchen und nimmt Evangelisten und Mitglieder anderer protestantischer Sekten auf. Die Funktionäre der katholischen Kirche grenzen sich ihrerseits von der EZLN ab, respektieren aber gleichzeitig ihre politische Tätigkeit. Der Priester Ruiz, Bischof von San Cristobal und eine Schlüsselpersönlichkeit bei den Verhandlungen zwischen der EZLN und dem Regime, ist zudem ein alter Kenner der mexikanischen Linken, die er seit den 70er Jahren frequentiert.52
1990, während die EZLN ihre militante Arbeit im Verborgenen fortsetzte, hängten der Priester Ruiz und seine Untergebenen Fotos von Föten an die Fassade der Kathedrale von San Cristobal,53 um auf diese Weise gegen das Gesetz über das Recht auf Schwangerschaftsunterbrechung zu protestieren, das gerade vom Provinzparlament verabschiedet worden war.54 Wie überall war die Frage der Fortpflanzung eine politische Frage der sozialen Kontrolle, und die Caciques der PRI [Partido Revolucionario Institucional, die regierende Partei in Mexiko] sahen darin ein Mittel, um die Geburtenrate unter den Armen zu senken. Die gefeierte „fortschrittliche Kirche“ – ein Verbündeter der Zapatisten – offenbarte ohne Skrupel ihre reaktionäre Natur. Heute gilt Ruiz als „Dissident“ der Kirche, unter anderem weil er das Zölibat der Priesterschaft kritisiert. Er weiß, dass das Überleben seines kleinen Unternehmens auf dem Spiel steht. Denn die Konkurrenz der Protestanten ist nicht nur eine einfache Frage der Theologie. Die Protestanten haben sich leicht in den Gemeinden eingenistet, weil ihre Organisation flexibler ist und weil Männer die Aufgaben des Kirchenamtes problemlos erfüllen können. Ruiz und seine Clique haben das verstanden und versucht, sich dem Zug anzuschließen. Laut dem ‚Katechismus des Exodus‘ der ‚Progressiven‘ können die Gemeinden Diakone wählen, aber Tatsache ist, dass es immer noch keine einheimischen Priester gibt… Und das aus gutem Grund: „In den indigenen Gemeinschaften ist immer der ältere, der erwachsene Mann das Familienoberhaupt. Ein Mann ist nicht erwachsen, solange er unverheiratet ist.“55 Der Zusammenhalt der Gemeinschaft ist für das Überleben der Partei der katholischen Kirche notwendig (genauso wie für die EZLN) und die Priester lehnen den Kampf für Geburtenkontrolle als Theorie der ‚Ersten Welt‘ ab.56 (Es ist interessant, diese Position mit der der rassistischen Strömungen der nordamerikanischen schwarzen Islamisten zu vergleichen, für die das Recht auf Verhütung und Schwangerschaftsunterbrechung Teil eines Plans der Weißen ist, der auf die Ausrottung der schwarzen Gemeinschaft abzielt.) Wenn sie schon dabei sind, unterstützen sie den politischen Kampf, indem sie behaupten, dass die Mittel zum Lebensunterhalt vorhanden sind und das Problem darin besteht, „zu wissen, wer sie kontrolliert und wer sie verteilt.“57 So ergibt sich am Ende eine Konvergenz mit der EZLN.
Für alle, die es noch nicht verstanden haben: Diese Macho- und Pro-Geburtenraten-Diskurse stellen die Lebensbedingungen der Frauen in den Gemeinden nicht in Frage. In diesen armen Regionen sind die Lebensbedingungen der Frauen extrem hart, der Alkoholismus richtet verheerende Schäden an und verstärkt die männliche Gewalt. In Chiapas ist die Geburtenrate sehr hoch, im Durchschnitt gibt es etwa sieben Kinder pro Frau. „60 % der Bevölkerung sind unter 20 Jahre alt; viele heranwachsende Mädchen werden in die Ehe verkauft, bevor sie fünfzehn Jahre alt sind. 117 von 100.000 Frauen sterben bei der Geburt (die häufigste Todesursache in Mexiko), und die Kindersterblichkeit ist doppelt so hoch wie die nationale Rate. Und schließlich sprechen 30-40 % der Frauen nur eine (indigene) Sprache und 60 % können weder lesen noch schreiben.“58 Es ist sicherlich richtig, dass die EZLN für Frauen besonders attraktiv ist, denn sie stellen rund ein Drittel der Truppen und mehr als die Hälfte der militanten Mitglieder. Dieses Phänomen ist keine Besonderheit der Situation in Chiapas, sondern gilt für alle Gesellschaften, die sich in einem Transformationsprozess befinden, in dem sich Guerillagruppen gebildet haben. Die EZLN hat ihr Frauengesetz zu Beginn des Aufstands definitiv unter dem Druck der Frauen erlassen, die ihre Gemeinden verlassen haben, um zu kämpfen.
Mit ihrem Engagement bestätigen die Frauen den reaktionären Charakter der indianischen Gemeinden, den die zapatistischen Anführer weiterhin als das neue Modell der Demokratie präsentieren, das überall eingeführt werden soll. Andererseits bleibt die Integration der Frauen in die militärischen Strukturen der sicherste Weg, das subversive Potenzial ihrer Entscheidung, mit der Vergangenheit zu brechen, zu entschärfen. Jeder Wunsch, die sozialen Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu verändern, wird so im Keim erstickt. Die jüngste historische Erfahrung zeigt, dass Frauen oft im Kampf eingesetzt und dann neuen allgemeinen Interessen untergeordnet werden, ja sogar einer neuen Politik, die eine höhere Geburtenrate begünstigt. Das Beispiel Algerien sollte ausreichen, um an den sozialen „Errungenschaften“ zu zweifeln, die die Anführer der EZLN gerne für sich in Anspruch nehmen. Seit wann ist die Beteiligung von Frauen an militärischen Aufgaben und ihr Aufstieg in der Befehlskette ein Beweis für die Emanzipation der Frauen? Man kann behaupten, dass „der Aufstand selbst einen Prozess der Umwälzung des traditionellen Lebens und der Herrschaftsverhältnisse darstellt.“59 Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass die Guerillaarmee insofern eine modernistische Kraft ist, als sie es den Frauen ermöglicht, den sozialen Beziehungen der traditionellen Gemeinschaften zu entkommen. Trotzdem werden immer noch keine Details über die neuen Beziehungen in den „befreiten“ Zonen genannt. Es ist zu befürchten, dass die Militarisierung der Frauen an die Stelle ihrer Unterwerfung unter die kommunitären Beziehungen treten wird. Und wir sollten darauf hinweisen, dass abgesehen von einigen seltenen Äußerungen der „comandantes“ kaum Worte von Frauen in den Texten der EZLN zu finden sind.
Die Landfrage: Die EZLN zwischen Besatzung und Verhandlung
Die Sympathisanten der EZLN wollen uns um jeden Preis glauben machen, dass ihre Existenz einen Schutzwall darstellt, eine Selbstverteidigungskraft der armen Bevölkerung gegenüber dem Staat und den Kapitalisten. Und das ist natürlich ein extrem elitäres Argument: Die schwachen Menschen brauchen einen bewaffneten Flügel, der sie verteidigen kann. Die Realität sieht jedoch anders aus. Die EZLN ist keine klassische bewaffnete Gruppe, sie ist der bewaffnete Flügel einer Organisation, die ein kleines Gebiet kontrolliert. Wenn es zu Zusammenstößen jenseits der kontrollierten Zone kommt, fehlen ihr die Mittel, um einzugreifen, und die aufständischen Bauern und Bäuerinnen werden dann von den bewaffneten Söldnern, die von den Großgrundbesitzern bezahlt werden (der „weißen Garde“), hemmungslos beschossen. Ihre Unterstützung für die Landbesetzungen ist, gelinde gesagt, zaghaft. In der letztgenannten Frage hat die EZLN einige Schwierigkeiten, sich mit der direkten Aktion der armen Bäuerinnen und Bauern und der Landarbeiterinnen und Landarbeiter zu verbinden. Natürlich hat die EZLN eine programmatische Position zur Landfrage: das Revolutionäre Gesetz zur Agrarreform. Sein Inhalt ist besonders moderat: Es spricht von der Achtung des Privateigentums, der Enteignung eines Teils des Landes der großen Plantagen, der Aufforderung zur Gründung von Genossenschaften und Produktionskollektiven auf dem enteigneten Land, der Notwendigkeit der Verstaatlichung der Vermarktungsbehörden, und das alles im Rahmen einer marktwirtschaftlichen Ökonomie.60 Inzwischen haben die zapatistischen Aktionen die Bauern und Bäuerinnen nicht nur in Chiapas, sondern auch in anderen südlichen Bundesstaaten zur Landbesetzung ermutigt. Anfang ’95 gab es allein im Bundesstaat Chiapas mehr als 500 besetzte Grundstücke. Die pro-zapatistischen Politiker machen keinen Hehl daraus: „(Die Bauern) hatten schon so lange versucht, das Land mit legalen Mitteln zu bekommen, ohne jedes Ergebnis, dass sie in ihrer Verzweiflung begonnen haben, das Land zu besetzen. Die Regierung hat sie vertrieben, aber sobald das passiert ist, holen sich die Bauern das Land wieder zurück.“61 Aus Angst vor der Notwendigkeit, mit der Machtstruktur zu verhandeln, scheinen sie diese Bewegung jedoch zu fürchten. Bei dieser Gelegenheit trällern sie das gleiche alte Lied über die Manipulation der Massen und Provokationen. Während die Bauern und Bäuerinnen mit den Vertreibungsbefehlen und dem legalen Kampf beschäftigt sind, lenkt die Regierung sie ab, um sie von der Teilnahme an der großen nationalen Konsultation (die von der EZLN organisiert wird) abzuhalten.62
Auf all den Seiten, auf denen die Revolte in Chiapas verherrlicht wird, findet sich kaum Material über die tatsächliche Bewegung der Individuen, die an diesen Besetzungen beteiligt sind. Umso wertvoller sind die wenigen Dokumente, in denen sie erwähnt werden.63 Es stellt sich heraus, dass die aktivsten Militanten „vor Ort“ nicht mit der EZLN, sondern mit einer anderen Organisation, der Union Campesina y Popular Francisco Villa, verbunden sind. Obwohl auch sie die Zapatistas unterstützen, scheinen die Villas nicht mit der Guerillaaktion einverstanden zu sein und stehen der Verhandlungstaktik kritisch gegenüber. Sie sagen, sie bevorzugen „die Verteidigung von zurückerobertem Land und die Ausbildung der ‚compañeros‘“64 Diese politischen Divergenzen erklären vielleicht auch die Haltung der Zapatistas gegenüber einer Besatzungsbewegung, die ihnen entgeht. Wie organisieren die Arbeiterinnen und Arbeiter die Produktion auf den besetzten Grundstücken? Es scheint, dass dort weiterhin im Akkord gearbeitet wird, auch wenn es keine täglichen Aufgaben mehr gibt65 und der Lohn erhöht wurde. Schließlich wurde auch die Arbeitsorganisation selbst nicht verändert. Es ist schwer zu verstehen, welches organisatorische Verhältnis zwischen den Militanten, die die Besetzungen anführen, und der Masse der Arbeitenden entstanden ist, wenn man nur bedenkt, dass die Anführer weniger (oder gar nicht…) zu arbeiten scheinen und dazu neigen, sich als Chefs zu äußern (z. B. „Wir verlieren lieber die Ernte, als Mitarbeiter einzustellen“)66. Wer hat das Sagen und wie? Schließlich bleibt das Vermarktungsnetzwerk das gleiche. Wenn man weiß, dass die mafiösen Zwischenhändler die soziale Basis der Regierungspartei (der PRI) bilden, kann man verstehen, dass sie sich nicht allzu sehr um die Berufe kümmern. Außerdem freuen sich die örtlichen Ladenbesitzer, weil die Bauern und Bäuerinnen ihren Lohn jetzt direkt in ihren Läden ausgeben, ohne die Geschäfte auf den Grundstücken zu passieren. Hier sollte ein besonders obskurer und beunruhigender Aspekt hervorgehoben werden. Es scheint, dass auf den besetzten Ländereien die alten guatemaltekischen Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen wurden, weil sich die villista Militanten weigerten, „ihrerseits zu Ausbeutern zu werden“67.
Es ist nicht klar, warum die Einwanderer nicht an den Besetzungen teilnehmen und wie die Indianer bezahlt werden können, es sei denn, Fremdenfeindlichkeit und mexikanischer Patriotismus haben sie übermannt. Die Beispiele und die verfügbaren Informationen vermitteln den Eindruck, dass die Bauern und Bäuerinnen nicht sonderlich an dem Land oder seiner kollektiven Nutzung interessiert sind. Versuche, ihnen dabei zu helfen, ihre Produktion wieder in Gang zu bringen, sind auf wenig Begeisterung gestoßen68 und dort, wo das Land besetzt wurde, wurde die Idee, es aufzuteilen, nur vage geäußert.69 Die Besetzungen scheinen eher als ein Akt der Klassenrache an den Großgrundbesitzern gelebt worden zu sein, denn die armen Bauern sind sich der Schwäche ihrer eigenen Kräfte bewusst. Sobald das Land besetzt ist, begnügen sie sich damit, am Existenzminimum zu produzieren. Es stimmt, dass die Großgrundbesitzer seit einigen Jahren die einheimischen Arbeiterinnen und Arbeiter für rachsüchtig halten und sie durch zugewanderte Arbeiterinnen und Arbeiter ersetzen.
Man muss schon eine gehörige Portion romantischer Naivität (von der Art der Stachanows) haben, um in all dem die Prämisse einer sozialen Revolution zu sehen. „Man empfindet eine Art verrückte Freude, wenn man sieht, wie sie sich aus den Vorräten der Bosse bedienen, uns zu einem dreigängigen Mittagessen einladen, schweißgebadet, aber mit zufriedenen Gesichtern von den Feldern zurückkommen und laut mit denjenigen unter ihnen scherzen, die genau die Karten lochen, mit denen die Verwaltung die Körbe [des Kaffees] zählt, die jeder Arbeiter gepflückt hat.“70 Leider sind wir in Chiapas weit davon entfernt, die Anfänge einer Veränderung der sozialen Beziehungen zu sehen, geschweige denn einer Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse. Die Situation lässt sich nicht mit anderen jüngeren Erfahrungen von Bauernbewegungen vergleichen, die die Frage der landwirtschaftlichen Produktion zum Gegenstand eines Bruchs gemacht haben, sei es im sandinistischen Nicaragua (1979-1982) oder unter dem Regime der Unidad Popular in Chile (1970-1973) oder während der portugiesischen Revolution von 1974. Die multinationalen Agrarkonzerne sind ebenso wie die mexikanischen Großgrundbesitzer kaum durch die Bauernbewegung in Chiapas bedroht. Ebenso gibt es im Diskurs der EZLN nur wenige Hinweise auf ein Projekt zur Neuorganisation von Produktion und Gesellschaft auf einer neuen Grundlage, und die Schwäche ihrer Vorschläge zur sozialen Frage ist auffällig.
Sicherlich: „Der zapatistische Aufstand hat eine neue Realität, ein neues Kräfteverhältnis geschaffen und die Verwirklichung alter Träume ermöglicht, die bis dahin unerreichbar waren.“71 Die EZLN betrügt die jungen Lumpenproletarier, die ihre Basis bilden, doppelt. Sie bietet ihnen eine kollektive Identität in einer Zeit intensiver sozialer Destrukturierung, kanalisiert ihre Revolte aber in einen militärischen Rahmen und macht sie so kontrollierbar und verhandelbar in hohen Positionen. Die EZLN ist heute ein Faktor der sozialen Befriedung in Chiapas und ihre Anführer zögern nicht, dies zu betonen. „Wenn wir verschwinden würden, würde alles wild und hoffnungslos werden. Es wäre wie Jugoslawien im Süden Mexikos. Der Bundesstaat hätte keine Gesprächspartner mehr, sondern nur noch Feinde.“72 Dieses ‚neue Kräfteverhältnis‘ stellt also auch eine Schwäche dar, wenn es um die Entwicklung der Fähigkeit der Ausgebeuteten zur Eigeninitiative geht. Solange die mexikanischen Proletarierinnen und Proletarier sich nicht die Mittel geben, um ihre eigenen Schwächen zu überwinden, solange sie sich allein auf die Stärke der EZLN verlassen, werden sie betrogen. Denn die eigene Stärke durch die Stärke der Partei zu ersetzen, ist die Daseinsberechtigung (raison d’etre) einer Avantgarde-Organisation.
Patrioten gegen den Neoliberalismus, oder die Sackgassen der EZLN
Die Ereignisse in Chiapas ereignen sich zu einer Zeit, in der der Kapitalismus eine besondere historische Phase durchläuft. In der Ära der Teilung der Welt in zwei Blöcke bedeutete jedes nationale Unabhängigkeitsprojekt die Angleichung der neuen herrschenden Klasse an die eine oder andere kapitalistische Macht. Das Ziel der so genannten „Befreiungsbewegungen“ war es jedoch, die Verbindung dieses oder jenes Landes mit dem amerikanischen Imperialismus zu lösen. Damals identifizierte sich die marxistisch-leninistische Ideologie mit dem Nationalismus der neu entstehenden Staaten. Seit der Errichtung der „neuen Weltordnung“, die aus dem Zusammenbruch des staatskapitalistischen Systems entstanden ist, kann das nationalistische Projekt einen solchen Bruch nicht mehr anstreben. Jede avantgardistische Organisation muss ihre Taktiken und Strategien überdenken, um nicht zum Verschwinden verurteilt zu sein. Eine solche Organisation muss nicht nur nationalistische Forderungen aufstellen, die sich die antiimperialistische Stimmung zunutze machen, die in den von den kapitalistischen Zentren abhängigen Ländern immer noch sehr lebendig ist, sondern sie muss sich auch in das politische Leben vor Ort integrieren und Allianzen ausschließlich im Rahmen der Widersprüche innerhalb der herrschenden Klassen eingehen.
Wir wissen, dass die militärische Aktion der EZLN in Chiapas zeitgleich mit dem Inkrafttreten des NAFTA-Abkommens – dem Freihandelsabkommen zwischen den drei nordamerikanischen Ländern – stattfand. Ziel dieses Abkommens ist es, einen formalen Rechtsrahmen zu schaffen, um einen Prozess zu regeln, der seit Jahren im Gange ist: die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten über ihre beiden Nachbarländer, Kanada im Norden und Mexiko im Süden. Aufgrund seiner strukturellen ökonomischen Schwäche leidet Mexiko unter der schlimmsten Rezession seit den 30er Jahren. Die Investitionen gehen zurück, nicht wettbewerbsfähige Industriebetriebe werden geschlossen, die Arbeitslosigkeit schießt in die Höhe, die Inflation erreicht Rekordwerte, die traditionelle landwirtschaftliche Produktion wurde zerstört und die Mehrheit der Bevölkerung verarmt.73 Hinzu kommt eine drastische Zerrüttung der herrschenden Klasse, denn die mexikanische Ökonomie ist durch starke staatliche Eingriffe gekennzeichnet. Der Bruch der über Jahrzehnte aufgebauten Verbindungen zwischen der Bürokratie der einzigen Partei – der PRI – und der privaten Kapitalistenklasse steht nun auf der Tagesordnung. Dadurch ist das gesamte System von Klientelismus und Korruption bedroht. Der Zusammenbruch der politischen Klasse – der Partei der Institutionellen Revolution (PRI) – und der bürokratischen Kontrolle der Zivilgesellschaft ist nicht neu: Die Studentenrevolten der 60er Jahre und die Bewegungen der Selbstorganisation nach dem Erdbeben in Mexiko hatten dies bereits angekündigt. Heute ist die Fäulnis zur Norm geworden und die Situation ist so, dass an der Spitze der PRI eine blutige Abrechnung stattfindet. Die „neoliberale“ Tendenz fordert die Beseitigung der bürokratischen Zwänge, die die Grundlage für das Überleben der antiquierten Sektionen der PRI bilden. Natürlich sind die Bündnisse zwischen den verschiedenen Tendenzen alles andere als eindeutig, denn viele Befürworter des Neoliberalismus kommen auch aus den korrupten und spekulativen Sektoren der PRI. Hier, wie auch anderswo, werden Mitglieder der Staatsbürokratie zu erbitterten Verfechtern eines ungezügelten Privatkapitalismus.
Innerhalb der mexikanischen Bourgeoisie gibt es viele, die es vorziehen, sich den Forderungen des nordamerikanischen Kapitalismus nicht anzupassen. Wir können davon ausgehen, dass die militärische Aktion der EZLN und die Beunruhigung, die sie in den Kreisen des multinationalen Kapitals ausgelöst hat, zu einem Faktor im Konflikt zwischen dieser Tendenz und den Verteidigern der amerikanischen Interessen geworden sein könnten. Der Übergang zur amerikanischen Kontrolle über das mexikanische Öl, der unter dem Deckmantel der Schuldentilgung durchgeführt wurde, hat diese Antagonismen reaktiviert und die nationalistischen Gefühle der Bourgeoisie verstärkt. Auch die sozialdemokratische Opposition, die sich in der Revolutionären Demokratischen Partei (PRD) zusammengeschlossen hat, musste sich einen neuen Platz auf der politischen Bühne suchen. Zunächst versuchte der linke Flügel der PRD, sich mit der Führung der EZLN zu verbünden, indem er seine eigenen institutionellen Verbindungen, seine politischen und gewerkschaftlichen/syndikalistischen Strukturen und seinen Einfluss in den Medien zur Verfügung stellte. Dieses Bündnis hat jedoch die Entwicklung der Situation nicht überlebt. Die EZLN konnte ihre Aktivitäten nicht in die nationale Strategie der PRD einbinden, die von bestimmten Sektoren der mexikanischen Bourgeoisie zu sehr kompromittiert wurde. Nach den Wahlen im August ’94, bei denen die PRD eine Niederlage erlitt und die neoliberale katholische Strömung der Partei der Nationalen Aktion (PAN) an die Macht kam, wurden die Differenzen noch deutlicher. Die Anführer der EZLN wissen ihrerseits genau, dass sie angesichts der historischen Situation und der Machtverhältnisse nicht in der Lage sind, die Macht des Zentralstaates allein zu beanspruchen. Andererseits sind die Zapatistas in der Lage, über die Macht zu verhandeln, die marginalisierten und ausgeschlossenen Schichten des Proletariats zu vertreten, eine Macht, die sie dank der durch ihre Aktionen geweckten Sympathie erlangt haben. Mit ihrer Umwandlung in die FZLN versucht die EZLN, einen Platz in dem politischen Vakuum zu besetzen, das links von der PRD besteht.
Die Wichtigkeit, die die FZLN dem Patriotismus beimisst, bekommt dadurch ihre volle Bedeutung. Die Zapatistas präsentieren sich immer mehr als Hüter der Werte des mexikanischen Nationalismus. Sie suchen immer mehr Allianzen mit Teilen der politischen Klasse. Dabei stoßen sie immer mehr auf die Schwierigkeiten eines solchen Projekts. Deshalb wenden sie sich immer wieder an die „wahren Patrioten“, an diejenigen, die „immer noch dieses unerklärliche Gefühl in ihrem Herzen spüren, den Nationalismus, das Gefühl für die Nation, die eigene Geschichte, das eigene Land“74 Angesichts der drohenden militärischen Aktion beschwören sie die faschistische Bedrohung und appellieren an die Patrioten der Armee und die „Ehrenmänner“ in ihren Reihen. „Wenn es einen faschistischen Ausgang gibt, können sie mit diesem Land machen, was sie wollen: das Öl und alles andere nehmen… warum nicht auch die Nationalflagge?“75 Das ist nichts Neues. Diese lächerlichen Ausbrüche entsprechen ganz dem Wesen der zapatistischen Anführer und erinnern nur allzu sehr an die der chilenischen Linken unmittelbar vor dem Militärputsch. Aber in der Ära der „neuen Weltordnung“ sind sie gezwungen, ihre Analysen der nationalen Frage zu überarbeiten. Als Modernisten halten sie sich fest an Chomsky, da der alte Joe nun nicht mehr im Mittelpunkt steht. Aus der Erkenntnis der Zerstörung der Nationen durch die Bewegung des Kapitals erwächst ihr großes Bedauern: „… denn in Mexiko haben die herrschende Klasse, die Banken und andere sehr empfindlich auf den Prozess der Globalisierung reagiert, und zwar so sehr, dass sie alle ethischen oder moralischen Werte und Normen vergessen haben. Und damit meine ich nicht die religiösen ethischen und moralischen Standards, sondern das, was die Menschen früher ihr Land, ihr Nationalgefühl nannten. In diesem Sinne glaube ich, dass Chomsky Recht hat, wenn er sagt, dass die Nation-Staaten am Ende sind und die besitzenden oder regierenden Klassen verschwunden sind.“76 Für die Zapatistas ist die ‚nationale Zerstörung‘ das, was die neue neoliberale Phase des Weltkapitalismus kennzeichnet. Sie präsentieren ihren Patriotismus als Antwort darauf. Und da „es sehr schwer vorstellbar ist, dass es noch Teile der Regierung gibt, die bereit sind, das nationale Projekt zu verteidigen“77, ist es an der „nationalen Befreiungsbewegung“, darauf allein zu reagieren, da sie nicht in der Lage ist, dies in einer vereinten Front zu tun. Gleich zu Beginn haben die Zapatistas zwei große Rückschritte gemacht. Erstens greifen sie das klassische marxistisch-leninistische Schema auf. „Ein revolutionärer Prozess muss mit der Wiederentdeckung des Konzepts von Nation und Land beginnen“78. Als Nächstes schlagen sie natürlich eine mystifizierende Alternative zur kapitalistischen Globalisierung vor. Offensichtlich betrachten die Zapatistas die gegenwärtige Phase der Globalisierung nicht als einen historischen Moment des Kapitalismus. Sie stellen sie als Irrweg dar: „Das neoliberale Projekt impliziert diese Internationalisierung der Geschichte, es bedeutet, dass die nationale Geschichte ausgelöscht und internationalisiert wird. (…) Tatsache ist, dass für das Finanzkapital nichts existiert, nicht einmal das eigene Land oder der eigene Besitz“79, schreit der Subcomandante entsetzt! Für die Zapatistas ist der Internationalismus nichts anderes als die Summe der Anfälle von Nationalismus und Protektionismus gegen das kapitalistische System. Die Zukunft, die sie vorschlagen, entpuppt sich als das Projekt einer vergangenen Vergangenheit.
Die Zukunft hat immer noch ein Gesicht
Die Explosion der Mexikokrise und ihre finanziellen Folgen haben den Mythos eines neoliberalen ökonomischen Wunders auf dem gesamten amerikanischen Kontinent zerstört. In dem Glauben, mit NAFTA ein gutes Geschäft zu machen, sehen sich die amerikanischen Kapitalisten in Mexiko mit einer Situation konfrontiert, die explosiv werden könnte. Und wenn es zu einer Explosion kommt, müssen sie sich einerseits mit der Unzufriedenheit der Einwanderer – nicht nur der mexikanischen, sondern der hispanischen – in den Vereinigten Staaten selbst auseinandersetzen80 und andererseits mit der Gefahr, dass die Revolte auf andere Länder Lateinamerikas übergreift. Was auch immer geschieht, die politische Zukunft der FZLN-EZLN kann nicht von den Auseinandersetzungen innerhalb der herrschenden Klasse über die Frage der Abhängigkeit vom amerikanischen Kapitalismus getrennt werden. Die Aktivitäten der Zapatistas sind jetzt Teil des Schauplatzes der bourgeoisen Politik und von nun an Teil dieses Unterfangens. Die große Unbekannte wird die Aktion des mexikanischen Proletariats sein und seine Fähigkeit, sich von der Kontrolle der bürokratischen Organisationen zu befreien, sowohl der alten (PRI und PRD) als auch der modernen (EZLN). Wenn sie sich auf autonome und unabhängige Aktionen einlassen, werden sie feststellen, dass die Kluft zwischen ihren Klasseninteressen und den nationalistischen Interessen dieser Parteien und Organisationen immer größer wird. Dann werden wir sehen, wie die alten caciques und die neuen Anführer mit Sturmhauben gemeinsam am Verhandlungstisch sitzen und sich beeilen, die „unrealistischen“ Forderungen der jungen lumpenproletarischen Rebellen zurückzuweisen. Mit dem „Beweis ihrer Verantwortung“ werden die neuen gesichtslosen Anführer ihr wahres Gesicht offenbaren. Wie ein Revolutionär zur Zeit Zapatas bemerkte: „Der Personenkult kann nur unter den Unwissenden oder denjenigen, die auf öffentliche Ämter und Einnahmen aus sind, Bekehrte gewinnen.“81
Paris, August 1995 Sylvie Deneuve, Charles Reeve
* * * * *
Über ‚Solidarität mit den Zapatisten‘
Anfang 1995 startete die Hamburger Zeitschrift Die Aktion eine Solidaritätskampagne für die Zapatistas.82 Dieser Text wurde als Reaktion auf diese Initiative geschrieben.
Ich weigere mich, euren Aufruf zu unterschreiben oder aktiv an der Informationskampagne mitzuarbeiten, die ihr ins Leben gerufen habt. Ich tue bereits so wenig „politisch“, dass es für mich eine Zeitverschwendung wäre, mich daran zu beteiligen. Schlimmer noch, es würde meinen Überzeugungen, die ich seit den Anfängen meiner politischen Gedanken und Aktivitäten vertrete, eklatant widersprechen.
Jetzt soll ich plötzlich eine Armee unterstützen (wie kommt es, dass Individuen ihre Organisationsform so nennen; das hat mich nachdenklich gemacht), während ich immer die Idee verteidigt habe, dass sich die soziale Revolution immer auf dem Terrain der Produktions- und Verteilungsorganisation abspielt und nicht auf dem Terrain der militärischen Konfrontation. Außerdem nennt sich diese „Armee“ selbst eine nationale Befreiungsarmee. Erinnert euch das an etwas? Abgesehen davon, dass dieses Wort in der stalinistisch-maoistisch-guevaristischen Tradition steht, wie kann jemand die „nationale“ Befreiung verteidigen, wenn ich der Überzeugung bin, dass die „Nation“ eine Struktur ist, die der bourgeoisen Gesellschaft eigen ist, und dass die Emanzipation der Menschheit notwendigerweise über die Sprengung dieses Zwangs erfolgen muss, um sich als menschliche Gemeinschaft, als Subjekt ihres Werdens, behaupten zu können? Diese beiden Aspekte bildeten schon immer das ABC meines kritischen Denkens.
Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe anderer Dinge. Der ständige Verweis auf das Volk, auf die Rechte des Volkes, auf die Ehre des mexikanischen Volkes (oder übrigens auch jedes anderen), auf sein Blut und anderen Unsinn löst bei mir Ekel und einen Drang zum Kotzen aus. Gütiger Gott, all die Schwindler und Ausbeuter der Nationen der Welt, in der Dritten Welt und anderswo, deren Münder überquellen, wenn sie von „ihrem“ Volk sprechen (zu dem sie natürlich gehören), obwohl sie nicht dessen „natürliche“ Wortführer sind und es darum geht, ihren Anteil an den auf planetarischer Ebene erpressten Profiten zu verteidigen oder zu erhöhen. Wenn das Wort „Volk“ in den Mund genommen wird, sind es immer die Ausgebeuteten selbst, die Gefahr laufen, dass ihre Ketten modernisiert und sie mit Gewalt der Diktatur des Kapitals unterworfen werden. Wenn man die mexikanische Regierung nur als Erfüllungsgehilfin des amerikanischen Kapitalismus und des IWF sehen will, übergeht man stillschweigend die Existenz einer nationalen Bourgeoisie (und sogar ihrer konkurrierenden Fraktionen), die entschlossen ist, ihre eigenen Interessen innerhalb des kapitalistischen Ausbeutungssystems zu verteidigen, sei es durch Diplomatie oder durch Waffen (je nach den Umständen) in der Assoziation von Banditen, die die Nationalstaaten sind.
Wenn dies wirklich eine „indianische“ Bewegung wäre, würde sie sich nicht um nationale Grenzen scheren. Ich werde weiter unten auf das Thema der sozialen Bewegung zurückkommen. Aber die Verwirrung ist total, wenn die Leute zu sagen scheinen, dass die Indianer die Ausgebeuteten sind, als ob Schwarze und Weiße die Ausbeuter wären. Es ist richtig, dass sich in Lateinamerika im Allgemeinen die Mehrheit der herrschenden Klassen aus Weißen rekrutiert (nicht überall, wie der Fall Haiti zeigt); aber die Mehrheit der Weißen und fast alle Schwarzen gehören zu den Ausgebeuteten. Das kann man nicht einfach ignorieren. Und wie ist es dann möglich, in der indianischen Tradition die Erinnerung an eine Gemeinschaft zu sehen, die angeblich frei und autonom war. Gerade die Gesellschaften der Inka und Maya waren lange vor der Ankunft der blutrünstigen Eroberer durch eine gewaltige soziale Hierarchie und brutale Ausbeutung gekennzeichnet. Paradoxerweise unterwarfen sich diese indigenen Völker gerade deshalb der neuen Ausbeutung aus Europa, weil sie jahrhundertelang ausgebeutet worden waren, ohne allzu viel Widerstand zu leisten, und ihre einzelnen Mitglieder konnten mehr oder weniger überleben. Die indianischen Bevölkerungsgruppen, die den Formen des primitiven Kommunismus am nächsten standen, leisteten einen viel entschlosseneren Widerstand. Es war nicht möglich, sie auszubeuten; sie mussten liquidiert werden. Die Spuren, die sie auf dem nordamerikanischen Kontinent hinterließen, kann man an der Leere erkennen, die zurückblieb und die durch einen massiven Nachschub an schwarzen Sklaven gefüllt werden musste.
Aber kommen wir zurück zur EZLN und ihrem Subkommandeur. Es gibt nicht nur das „Volk“, sondern auch die Nationalflagge (natürlich besudelt), das Land (natürlich verkauft), die nationale Souveränität, Landesverräter und als Krönung: „Alles für alle, nichts für uns“. Das zeigt ganz nebenbei, wie weit die EZLN („wir“) und die Bewegung („alle“) davon entfernt sind, sich einig zu sein, sondern stattdessen gegensätzlich sind. Ich finde diesen „Dem Volk dienen“-Opfergeist sehr suspekt.
Und dann ist da noch der berühmte „Dialog“, den die EZLN mit der Regierung führen will. Was ist mit Dialog gemeint? Wie kann es einen friedlichen „Dialog“ zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten über die Abschaffung der Ausbeutung geben? Diese implizite Anerkennung des Staates als die geeignete Institution, um das bourgeoise Credo von „Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit“ zu verwirklichen, sagt viel über den nicht-subversiven Charakter der EZLN aus.
Subkommandeur Marcos, der zugibt, dass er nichts weiter als eine recycelte Guerilla ist, hat seine Intelligenz, seinen Sinn für Humor und sogar einen Sinn für Poesie unter Beweis gestellt. Das gebe ich gerne zu. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Inhalt dürftig ist und dass er es genießt, die Rolle des bescheidenen Helden zu spielen, der unbekannten und geheimnisvollen Persönlichkeit mit dem maskierten Gesicht (Zorro!). Ich sehe in ihm alle Anzeichen für einen bestimmten Stil des lateinamerikanischen Machismo. Seine Enttäuschung darüber, dass er wenig Zuspruch von Frauen erhält, kann man als Ironie deuten; für mich hat er den widerlichen Gestank des starken Mannes, der im Mittelpunkt der Blicke bewundernder Frauen steht. Ein echter Caudillo.
Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass Marta Duren, die gekommen war, um die Indianer zu interviewen, am Ende aus ‚praktischen Gründen‘ (?) ihren Dolmetscher interviewte. Hier werden wir wieder einmal mit der Delegation von Macht auf Lebenszeit konfrontiert. Und das stört sie nicht im Geringsten! Außerdem scheint es Marcos auch nicht peinlich zu sein, zu keinem Zeitpunkt besteht er darauf, die Rolle eines echten Übersetzers zu spielen und andere ‚Kämpfer‘ zu Wort kommen zu lassen, noch weniger tut er dies für einfache Bauern (oder eher Halbproletarier, wie der Text von Garcia Leon ziemlich deutlich zeigt, was zumindest einige Zweifel am ‚indianischen‘ Charakter der Bewegung aufkommen lässt, während es sich, wenn es eine Bewegung gibt, um eine soziale Bewegung handelt, die an die Situation dieser Bevölkerung in der Gesamtproduktion der Gesellschaft gebunden ist).
Lass uns ein bisschen darüber reden. In Lateinamerika sind Landbesetzungsbewegungen von halbproletarisierten Bauern und Bäuerinnen (sehr oft Frauen), die sich gegen die Übergriffe der Großgrundbesitzer wehren, ein weit verbreitetes Phänomen. Einerseits sind diese Bewegungen ein Beispiel für sozialen Kampf, für Ungehorsam, andererseits waren sie nie in der Lage, sich mit den städtischen sozialen Bewegungen zu verbinden und sind oft von vagen Vorstellungen über Landbesitz, die „Rückkehr“ zur Natur oder die Forderung nach finanzieller und rechtlicher Unterstützung durch den Staat durchdrungen, so dass die subversiven Elemente der modernen Gesellschaft in ihnen selten sind. Diese Bewegungen haben meine volle Sympathie, sind aber weit davon entfernt, mir Hoffnung auf einen totalen Umsturz der Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft zu machen.
Da es mir also schon schwerfällt, in diesen sozialen Bewegungen eine Quelle der Hoffnung zu sehen, bin ich besonders deprimiert über Individuen in Europa, die sich mit einer sozialrevolutionären Vision identifizieren, sich nicht für die soziale Bewegung begeistern, sondern stattdessen offenbar vom Spektakel der Masken und Waffen, vom Mythos des bewaffneten Widerstands fasziniert sind. Für mich ist das das Problem: Wie weit muss man angesichts der alltäglichen Realität wirklich verzweifelt sein, um sich an die Persönlichkeit eines Schönredners klammern zu müssen? Es ist auffallend, dass in all den Dokumenten, die ihr veröffentlicht habt, und trotz der Tatsache, dass der Zugang zu den „befreiten“ Zonen relativ einfach ist, keine einzige auch nur annähernd detaillierte Beschreibung des Alltagslebens, der Arbeit, der Aufgabenteilung, der Verteilung der Güter, der Entscheidungsfindung, der Beziehungen zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern, der Bildung usw. zu finden ist. Warum misst man politischen Erklärungen, so poetisch sie auch sein mögen, mehr Bedeutung bei als den Mechanismen des materiellen und sozialen Funktionierens der vermeintlich aufständischen Bevölkerungen?
Ich hatte noch keine Gelegenheit, auf die Rolle Mexikos in der Ökonomie der Vereinigten Staaten, auf die Nutzung der EZLN durch die mexikanische Regierung bei internationalen Verhandlungen oder auf die Einbindung von Chiapas in die sozialen Spannungen in anderen Regionen Mexikos einzugehen. Um zu verstehen, was im Lakandonischen Wald und in der Umgebung wirklich vor sich geht, müsste man sich mehr Zeit für diese Themen nehmen. Das wird aber nichts an meiner grundsätzlichen Haltung gegenüber der von euch eingenommenen Position ändern.
Marc Geoffroy, Berlin Juni 1995.
‚Indigenismus‘ und Macht
Dieser Text, verfasst von Libertären in Peru, wurde im Januar 1995 in der Zeitschrift Contrafluxo mit Sitz in Medellin (Kolumbien) veröffentlicht.
Ein politischer und kommerzieller Handel im Namen des Volkes – oder wie die „indigene Kultur“ zu einem Ball wird, den die Politiker hin und her werfen, und zu einer weiteren Ware
Jeden Tag sehen wir auf immer offensichtlichere Weise, wie der Zusammenbruch des autoritären Sozialismus zur Flucht seiner professionellen Parteigänger (Intellektuelle, Politiker, Mitglieder der NGOs) in zwei sich ergänzende ideologische Refugien geführt hat: den „demokratischen“ Sozialismus und den regionalen Nationalismus oder „Indigenismus von oben gesehen“. Das erste ist nichts anderes als Sozialdemokratie: das System, das die ökonomische Macht in den Händen einer Minderheit präsentiert, die niemand wählt, im Namen eines Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Aber es ist die zweite, mit der wir uns hier beschäftigen werden.
Wie wir im Text „Der Mythos des Vaterlandes“ betont haben, verwüstet das Phänomen des ethnischen Nationalismus die Welt wie ein Stier, der auf den Ruinen des „realen Sozialismus“ tanzt und sich von der wachsenden Armut ernährt, die durch die große Offensive des Kapitals seit Anfang der 70er Jahre entstanden ist, und zwar sowohl im Norden als auch im Süden des Planeten. Ethnischer Nationalismus nimmt je nach Herkunftsort unterschiedliche Formen und Merkmale an. Die besondere Form, die er im heutigen Peru annimmt, würden wir den „Indigenismus der Macht“ nennen. Vor allem, um ihn von dem Indigenismus zu unterscheiden, den es in anderen historischen Epochen gab und der folglich eine inhaltliche und soziale Basis hatte, die nicht unbedingt identisch war.
1. Die politischen und kulturellen Ausdrucksformen des „Indigenismus von oben“
Der Bürgermeister von Cuzco, Daniel Estrada, hat beschlossen, seine linke Identität gegen die eines „unabhängigen Indigenisten“ einzutauschen. Sein Wahlkampfträger, die „Frente Unido“, will eine Kraft sein, die allen gefällt. So wie die Bewegung von Javier Perez de Cuellar. Estradas Widerstand gegen Fujimori erklärt sich im Wesentlichen aus der Bedrohung durch dessen zentralistische Politik gegenüber allen regionalen Gouverneuren, wie Estrada, Belmont, Caceres und anderen. Es ist ihre eigene Macht, die auf dem Spiel steht. Der Bürgermeister von Cuzco repräsentiert somit eine politische Strömung, die mit einem breiten Sektor der regionalen Intelligenz verbunden ist und sich von einer politischen Identität gelöst hat, um nicht mit „veralteten“ ideologischen Tendenzen identifiziert zu werden. Auf diese Weise fanden sie eine neue Identität im „Indigenismus“, der bis dahin nur ein populistisches Anhängsel ihrer Diskurse war. Diese Identität zeigt sich beharrlich in den verschiedensten Bereichen: in Universitätsvorlesungen und Treffen von NGOs, in Denkmälern, die von der Gemeinde errichtet werden, und in Zuschüssen für Publikationen. Diese neuen Indigenisten versuchen, sich mit den Arbeiterklassen zu identifizieren, da der Indigenismus (wie alle Formen des Nationalismus) in bestimmten historischen Momenten die Form eines „Banners der Unterdrückten“ angenommen hat. Wir verweisen insbesondere auf die Widerstandsbewegungen von Tupac Amaru dem Ersten im XI. Jahrhundert und von Tupac Amaru dem Zweiten im XVII. Jahrhundert sowie auf die Tahuantinsuyo-Bewegung zwischen 1905 und 193983.
Die neue indigenistische Avantgarde will vom Ruhm dieser Revolutionäre profitieren, ohne den Preis dafür zahlen zu müssen. Ihr Ziel ist es, sich das Image des Revolutionärs anzueignen, ohne dafür Risiken eingehen zu müssen. Sie berufen sich auf 500 Jahre Widerstand, aber der einzige Widerstand, der sie wirklich interessiert, ist der aus der Kolonialzeit. Ihr Indigenismus steht in direktem Zusammenhang mit ihrem nationalistischen Plan für ein „vereintes Peru“, in das sie die indigenen Bevölkerungsgruppen integrieren möchten, um so die Konflikte zu vermeiden, die das soziale Gefüge des Landes auf dem Weg der kapitalistischen Entwicklung zerstören.
Diese besondere historische Vision des Indigenismus kommt in einer ihrer unzähligen kulturellen Manifestationen deutlich zum Ausdruck: dem Wandgemälde von Juan Carlos Bravo in der Avenida de la Sun. Ohne seine Qualitäten in Frage stellen zu wollen, sollten wir anmerken, dass darin die sozialen Kämpfe nur bis zur nationalen Unabhängigkeit dargestellt werden. An diesem Punkt der Geschichte angekommen, entführt uns der Künstler plötzlich in eine blühende Morgendämmerung, in der das ganze Volk einen Regenbogen bestaunt. Dieser historische Sprung von 1821 in unsere Zeit ist nichts anderes als die offizielle Darstellung der letzten anderthalb Jahrhunderte. All die Gewerkschafts-, Bauern- und Guerillakämpfe und andere, die das „Cuzco Rojo“ jener Jahre so tief geprägt haben, werden ganz einfach aus dem Werk getilgt, aus der Geschichte gelöscht. Als ob die sozialen Konflikte im XIX. Jahrhundert mit dem Beginn der Unabhängigkeit und der Intensivierung der kapitalistischen Entwicklung verschwunden wären.
Der Indigenismus ermöglicht es den regionalen Behörden und ihren intellektuellen Verbündeten in privaten und öffentlichen Einrichtungen heute, sich mit den Unterdrückten zu identifizieren, dank einer unvollständigen und mythisierten Geschichte, die sie über die vielfältigen kulturellen und pädagogischen Kanäle, die sie selbst kontrollieren, verbreiten. Auf diese Weise versuchen sie, ihren Status als Vertreter des Volkes gegenüber einer Bevölkerung zu rechtfertigen, die den Eliten, die behaupten, in ihrem Namen zu sprechen, schon immer misstraut hat.
Wenn der Indigenismus von einer befreienden Vision getrennt wird, die sich auf die tatsächlichen Realitäten stützt und von oben manipuliert wird, kann er dem herrschenden System ohne allzu viele Widersprüche dienen. Eine solche Situation ist nicht neu. Schon während der Kolonialzeit stand das Inkareich im Mittelpunkt der großen Mythen, die es verherrlichten, während die indigenen Nachfahren der Inkas weiterhin ausgebeutet wurden. Seitdem erlebt die indigene Bevölkerung eine doppelte Sklaverei: im Verhältnis zu ihren wahren Herren und im Verhältnis zu ihrer eigenen Vergangenheit.
2. Indigene Kultur als kommerzielles Produkt
Indigenismus ist ein Diskurs, der behauptet, die Volkskultur aufzuwerten. Aber was ist diese Kultur?
Der Kapitalismus neigt dazu, alles, was das menschliche Sozialleben betrifft, in Waren zu verwandeln, und die Kultur eines Volkes entgeht dieser Regel nicht. Diese ökonomische Aktivität garantiert das Wohlergehen einer Minderheit. Genau diese Minderheit (Mittel- und Oberschicht) profitiert nun von der indigenen Kultur durch ihre ökonomischen Kontakte mit der Außenwelt, wie z. B. dem Tourismus. Das Bild des „Indianers“ mit seiner romantischen Armut illustriert die Touristenbroschüren und lockt Besucher an, die ihr Geld in den Hotels, Geschäften, Restaurants und anderen Orten des Konsums ausgeben. Aber kommen diese Gewinne aus der Populärkultur auch den arbeitenden Klassen zugute? Diejenigen, die glauben, dass der Tourismus die beste ökonomische Wahl für Peru ist, sollten sich Länder wie Brasilien oder Mexiko ansehen. Diese Länder erzielen viel höhere Einnahmen aus dem Tourismus als Peru. Dennoch handelt es sich um Länder, in denen die soziale Armut besonders groß geworden ist.
Der derzeitige Prozess der Privatisierung der Tourismusindustrie hat keinen anderen Zweck als die Bereicherung einer kleinen Gruppe, die Millionen von Dollar ausgibt, um die zum Verkauf stehenden Unternehmen zu kaufen.
Die Kommerzialisierung hat zur Folge, dass die einheimische Kultur eine Standardisierung ihres Kunsthandwerks und ihrer Kleidung für den Verkauf und den Export erfährt. Dieser wichtige Handwerkszweig bildet die Grundlage für eine neue Abhängigkeit, die sich im Land etabliert.84 Eine Abhängigkeit, die nicht befreit, sondern im Gegenteil die Produzenten in die Sklaverei treibt. Jeder, der die Sozial- und Arbeitsbedingungen der Menschen beobachtet, die sich an der Basis der Pyramide dieser „indigenen Industrie“ befinden, kann das selbst sehen.
Letztendlich gehorcht die indigene Kultur heute weitgehend den Gesetzen des Marktes. Das sind die Gesetze, die sie definieren und verzerren, je nach den Bedürfnissen desselben Marktes. Die Kultur ist Teil der Tourismusindustrie, einer Industrie wie jeder anderen, in der Ausbeutung vorherrscht.
In der Zwischenzeit werden die sozialen Kämpfe, die mit den Forderungen der Indigenen verbunden sind, in die „lebenden Museen“ der Ruinen, Denkmäler und Archive verbannt. Das Bild von der Macht des Inkareichs wird benutzt, um seine heutigen Nachkommen machtlos zu machen, indem eine Kultur der Unterwerfung unter alle Formen der Autorität aufrechterhalten wird. Der Indigenismus ist zu einer historischen Last auf den Schultern der vielen Menschen geworden, die ihn tragen müssen. Tag und Nacht wachen der Pachachtec auf der einen und das Weiße Kreuz auf der anderen Seite über die Bewegungen der Einwohner von Cuzco wie George Orwells „Großer Bruder“. Diese beiden Monumente stehen für alte Legenden, die von nun an dazu dienen, die Angst und Unterwerfung der Bevölkerung zu verstärken. Der Tag, an dem sie fallen, wird ein glücklicher Tag für die Männer und Frauen sein, die den Weg ihrer Emanzipation suchen.
Fazit
Wir haben die Wiedergeburt der indigenistischen Idee in den globalen Kontext des ethnischen Nationalismus und seiner Suche nach einer historischen Identität gestellt. Im Gegensatz zu einem Indigenismus, der wie in Mexiko den politischen Rahmen sprengt, hat der Indigenismus in Peru seine frühere Maske als „Ideologie der Befreiung“ verloren, auch wenn populistische Politiker ihn weiterhin instrumentalisieren. In den meisten Fällen haben Ideologien oder Bewegungen, die sich auf ethnische Identität stützen, in den letzten Jahren auf internationaler Ebene dazu geführt, dass Klassenbewegungen, die sich gegen falsche Spaltungen wehrten, kurzfristig abgelenkt und auseinandergerissen wurden. Mehr noch: Sobald der Indigenismus seinen Klassencharakter verliert, wird er zum Gefangenen der Interessen politischer Eliten, die nach einer einfachen Möglichkeit suchen, sich mit dem „Volk“ zu identifizieren. Außerdem dient der Indigenismus in den Anden über seine kulturellen Erscheinungsformen direkt den ökonomischen Interessen derjenigen, die mit allem spekulieren, was mit indigener Kultur und Geschichte zu tun hat, indem sie genau die „Indigenen“ ausbeuten, deren Identität auf dem Tourismusmarkt fetischisiert und zynisch gefeiert wird. Hier wird die Ironie schmerzhaft. Alles „Indigene“ wird in den Dienst der Tourismusindustrie gestellt. Diese Industrie wiederum steht im Dienst der viel gepriesenen nationalen „Entwicklung“ oder des „Fortschritts“. Manchmal wird sie sogar als das wichtigste Element angesehen. Aber ist diese „Entwicklung“ nicht der Vorwand, in dessen Namen indigene Völker seit 500 Jahren brutalisiert und ausgegrenzt werden? Der Verkauf der indigenen Kultur ist die Garantie für ihr Verschwinden.
1Anmerkung des Übersetzers (T.N.): Dies ist eine Übersetzung der französischen Version. Die englischsprachige Version, die in „The Kidnapped Saint and other stories“ veröffentlicht wurde, lautet: ‚Solch rasche Begeisterung und schnell erworbene Überzeugungen sind selten das Salz, das man in Fällen wie diesen zum Würzen verwendet.‘ Wir bevorzugen die obige Version. Der Text geht weiter: “Das wahre Bedürfnis besteht nicht darin, die große Masse zu überzeugen, sie zu flammender Begeisterung aufzupeitschen und sie zu einer Resolution zu bewegen. Vielmehr geht es darum, einzelne Menschen zu überzeugen. Die Menschen der Zukunft und die Menschen, die sich auf das Kommende vorbereiten, sollten nicht unüberlegt argumentieren; sie sollten nicht bedingungslos glauben; vielmehr sollten sie von dem Bewusstsein erfüllt sein, dass diese Revolution richtig und machbar ist, während die andere bourgeoise Ordnung falsch und nicht machbar ist. Die Menschen, die heute den Willen zur zukünftigen Entwicklung in sich tragen, sollten nicht im Vertrauen auf den Verstand eines klugen Führers für die kommende Gesellschaft arbeiten, sondern mit ihrem eigenen Verstand, mit ihrem eigenen Herzen und mit ihrer eigenen Seele.
Das können sie aber nur tun, wenn sie wissen, worum es geht, und wenn sie auch genau wissen und verstehen, was sie selbst wollen.“
2Die erste Version des Textes Au-dela des passes-montagnes wurde 1995 geschrieben, nachdem einer von uns in gesunder Wut über die romantische Unterstützung für die Aktivitäten der EZLN (siehe Anhang 1) erregt wurde. Als Reaktion darauf gingen einige unserer Freunde durch die Decke, und ein paar unbedeutende Feinde offenbarten sich. Wie konnten wir es wagen, eine so schöne Sache zu kritisieren, die die Jugend mobilisierte und die alten Aktivisten inspirierte? Radikalen Verlegern, die wir kontaktierten, fehlte es an Begeisterung. Schließlich wurde der Text selbstbewusst über das Lokal einer kleinen Anti-Establishment Assoziation in Paris namens La Bonne descente verbreitet . Wir behielten den ursprünglichen Geist des Textes bei, überarbeiteten ihn aber, indem wir zusätzliche Analysen einfügten, die wir aus den seit 1995 veröffentlichten Texten entnommen hatten.
3Siehe dazu den letzten Bericht einer der Säulen des Pariser „ready-to-think“ (Bereit zum Denken) nach seiner Rückkehr aus Chiapas: „Marcos hat die Geschichte Mexikos im Blut. Er ist ein seltsamer Libertärer, der wie ein Patriot denkt, eine hierarchische Armee befehligt und nicht individualistisch, sondern kommunitär reagiert.“ Regis Debray, „La guerilla autrement“, Le Monde, Paris, 18. Mai 1996.
4Eine Ausnahme: Das Werk von Nicolas Arraitz (Tendre venin, Edido) teilt nicht die Faszination des Autors für „den Unterschied“, weder seine Analysen noch seine politischen Schlussfolgerungen (in denen er versucht, die demokratischen und nationalistischen Positionen der EZLN-Aufständischen neu zu bewerten), schon gar nicht seine verächtlichen Worte über die „selbstgefälligen Sklaven“ der sogenannten entwickelten Gesellschaften. Wir müssen ihm zugute halten, dass er einer der ersten war, der uns Informationen aus erster Hand darüber lieferte, wie die Menschen in diesen Regionen des aufständischen Mexiko, insbesondere in Chiapas und Guerrerro, wirklich leben. Er hat sich nicht damit begnügt, die Anführer zu interviewen. Er ging in die besetzten Fincas.
5Siehe den beigefügten Text über die Situation in Brasilien.
6Yves Le Manach, „La résignation est un suicide quotidien“,Alternative Libertaire, Brüssel, April 1996.
7Siehe: J.Eric S.Thompson, Grandeur et décadence de la civilisation maya‚, Paris, Bibliotheque Historique Payot, 1993.
8„Témoinages de l’ancienne parole“, S.48, übersetzt aus dem Nuhauti von Jacqueline de Thirand-Forest, Paris, La Difference, 1995).
9Ruggiero Romano, Les méchanismes de la conquete coloniale: les conquistadores (S. 46), Paris, Flammarion).
10Michael Coe, The Mayas, zitiert in ‚Insurgent Mexico‘,Fifth Estate, Sommer 1994 (französische Übersetzung).
11Americo Nunes, Les révolutions du Mexique (S.151), Paris, Flammarion, 1975) In dieser brillanten Kritik an den progressiven Mythen der mexikanischen Revolution zeigt der Autor insbesondere, dass „die libertäre Parole ‚Land und Freiheit‘ (Tierra y Libertad) fälschlicherweise der zapatistischen Bewegung zugeschrieben wurde“, während es sich in Wirklichkeit um den Slogan der (anarchistischen) liberalen Partei der Brüder Magon handelte. Siehe auch: Ricardo Flores Magon, La révolution mexicaine, Paris, Spartacus, 1979.
12Ebd., S. 148, 150.
13Im Bundesstaat Sonora (Nordwestmexiko) revoltierte der Stamm der Yacqui immer wieder gegen die Enteignung des Landes. Er wurde schließlich 1926 von Obregon, einem revolutionären General, der mit den Zapatisten verbündet war, militärisch niedergeschlagen…
14Siehe dazu das interessante Kapitel „Le sang, le joug et la foret“, Nicolas Arraitz, Tendre Venin, Editions du Phenomene, Paris, 1995.
15Nicolas Arraitz, Ibid, S. 219. 5. Antonio Garcia de Leon, Los motivos de Chiapas, Barcelona, die Zeitschrift Etcetera, November 1995.
16Antonio Garcia de Leon, Los motivos de Chiapas, 16. Rebellion from the Roots, John Ross, Common Courage Press, 1995, S. 257.
17A.d.Ü., wir denken dass der Titel eine mögliche Anspielung auf das Buch von B.Traven Die Rebellion der Gehängten macht.
18Rebellion from the Roots, John Ross, Common Courage Press, 1995, S. 257.
19Katerina, Mexiko ist nicht nur Chiapas, Noch ist der Aufstand in Chiapas eine mexikanische Angelegenheit, März 1995, Hamburg.
20Antonio Garcia de Leon, op. Cit.
21Die armen Bauern in Chiapas – wo Grenzen historisch gesehen wenig bedeuten – wer ist indianisch? wer ist mexikanisch? wer ist guatemaltekisch? Die treuen Anhänger der zapatistischen Sache schweigen seltsamerweise über die Anwesenheit dieser Gruppe von Einwanderern. Welche Maßnahmen gedenkt die EZLN zu ergreifen, um dieses „Problem“ zu lösen? Gibt es überhaupt ein Problem?
22Antonio Garcia de Léon, op. cit.
23Nicolas Arraitz, a.a.O., S. 221.
24Katarina, a.a.O.
25Heute sind 60 % der Bevölkerung von Chiapas unter 20 Jahre alt.
26Antonio Garcia de Leon, a.a.O.
27In diesem Teil des Textes haben wir uns ausgiebig auf das Werk von John Ross, Rebellion From the Roots, siehe Anmerkung 15, gestützt, insbesondere auf die Kapitel „Back to the Jungle“ und „Into the Zapatist Zone“.
28Zu dieser Zeit wurden die Verbindungen zwischen den politischen Bossen der Regierungspartei PRI und den Anführern der Politica Popular geknüpft. Zwei große maoistische Anführer aus dieser Zeit sind heute hochrangige Kader der PRI in der offiziellen Bauernorganisation…: siehe dazu John Ross, op. cit. S. 276.
29John Ross, a.a.O., S. 278.
30A.d.Ü., hier ist die Rede der sogenannten Fokustheorie. Eine von Che Guevara entwickelte Theorie, die auf den Sieg der Kubanischen Revolution von 1956 basierte, nämlich dass für eine sozialistische Revolution kein Proletariat mehr als treibende Kraft notwendig sei, sondern das Landproletariat und die Kleinbauern, was unter anderem heißt, dass die Revolution nur im Trikont stattfinden kann. Es finden sich zwischen dieser Theorie und Maos Ideen viele Parallelismen.
31Siehe die interessante Analyse von Julio Mogel in La Jornada, 19. Juni 1994; zitiert von John Ross, op. cit.
32Salvador Castaneda, „Es wird schwierig für die EZLN“, Interview, Analyse & Kritik Nr. 373. Castaneda war einer der Anführer der MAR (Movimiento de Accion Revolucionaria), einer Organisation des bewaffneten Kampfes in den 70er Jahren.
33Ebd.
34Ebd.
35N. Arraitz, op. cit.
36Um damit umzugehen, schlug ein Teil der mexikanischen extremen Linken der EZLN die Bildung einer Einheitsfront politischer Organisationen vor. Trotz der Kontakte zur EZLN weigert sie sich im Moment, irgendeine Möglichkeit in Betracht zu ziehen, in der sie nicht eine dominante Position einnehmen würde.
37Regis Debray, „A demain Zapata“, Le Monde, Mai 1995.
38N. Arraitz, a.a.O., S. 273.
39Interview in La véridique légende du sous-commandant Marcos, ein Film von T. Brissac und T. Castillo, La Seot/Arte, Paris 1995.
40Marcos, Interview in Brecha, Montevideo, Oktober 1995 (übersetzt und veröffentlicht von Alternative Libertaire, Brüssel, März 1996.
41Grundsatzerklärungen der EZLN, zitiert von N. Arraitz, op. cit, Titelseite.
42Marcos, Interview, a. a. O.
43John Ross, a.a.O., S. 294.
44Interview mit Tacho und Moises, N. Arraitz, a.a.O., S. 343.
45Interview, La véridique légende du sous-commandant Marcos,a. a. O.
46„Jahr 03“, Text eines Berichts der Komitees zur Unterstützung der EZLN in Deutschland, Hamburg, 18. Februar 1996.
47Siehe das Interview mit den Kommandanten Acho und Moises, N. Arraitz, op. Cit.
48Ebd.
49Diese mystische Version der Politik unterscheidet sich nicht sehr von der des militanten Islam.
50Entnommen aus Téologia Pastoral Operaria (Arbeiterpastoraltheologie – Lehrtexte der brasilianischen Strömung der libertären Theologie), Domingos Barbe, Sao Paolo, 1983.
51John Ross, op. Cit.
52Ebd. Damals erlebte Ruiz die Arbeit von Maoisten und „fortschrittlichen“ Priestern in einer Stadt im Norden Mexikos aus erster Hand.
53Das Ereignis wird von John Ross, ebd. berichtet.
54Ebd.
55Samuel Ruiz, Interview, El Pais, 5. Oktober 1995.
56Ebd.
57Ebd.
58Ebd.
59„Jahr 03“, op. cit.
60Katarina, op. Cit.
61A. Avendano (Rebellengouverneur von Chiapas), Interview, Solidarité Chiapas no. 2, Paris, September 1995. Siehe auch N. Arraitz, op. cit., S. 203.
62Avendano, op. Cit.
63N. Arraitz, op. cit.
64Worte eines ihrer militanten Mitglieder, ebd., S. 204.
65Diese Information stammt aus N. Arraitz, a.a.O., siehe insbesondere das Kapitel „La Saga des Orantes“.
66Ebd. S. 205.
67Ebd. S. 205.
68Ebd. S. 308.
69Ebd. S. 206.
70Ebd. S. 211.
71Ebd. S. 204.
72Marcos, Aussage aufgezeichnet von Régis Debray, „La guerilla autrement“, op. cit. Hervorhebung von uns.
73Seit der Unterzeichnung des NAFTA hat der Peso 50 % seines Wertes verloren, mehr als tausend Fabriken wurden geschlossen, eine Million Arbeiterinnen und Arbeiter wurden entlassen und der Konsum ist um 25 % gesunken (Le Monde, 9. August 1995).
74Marcos, Interview, La Jornada, Mexiko, 25. bis 27. August 1995, abgedruckt in Solidarité Chiapas no. 2, Paris, September 1995
75Ebd.
76Ebd.
77Interview mit Marcos, Brecha, Montevideo: siehe Anmerkung 36.
78Ebd.
79Ebd.
80Trotz der Verstärkung der Patrouillen bleibt die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten ein Sieb. Millionen Mexikanerinnen und Mexikaner leben und arbeiten in den Vereinigten Staaten, wo ihr militantes Engagement in den Schulen, Wohnvierteln und an den Arbeitsplätzen immer sichtbarer wird.
81Ricardo Flores Magon, op. Cit.
82„Unsere Solidarität mit den Zapatistas“, 13. Februar 1995, Die Aktion, (Am Brink, 10, 21029 Hamburg). Dieser Aufruf wurde in der Zeitschrift Etcetera (Apt. 1.363, 08080 Barcelona) nachgedruckt.
83Die beiden letztgenannten hatten einen forderungsorientierten Charakter, der mit sozialrevolutionären Elementen durchtränkt war, die weit über eine rein „indigenistische“ Plattform hinausgingen, wie sie in der offiziellen Version der Geschichte gerne dargestellt werden. Wir denken dabei an die Metis-Ursprünge von Tupac Amaru II und insbesondere an den anarchistischen Einfluss in der Tahuantinsuyo-Bewegung – ein Einfluss, der sich in ihrer Ideologie von den ausgebeuteten Menschen der ganzen Welt, aller Kulturen und Ethnien zeigt. Siehe Flores Galindo, Societe coloniale et soulevements populaires, 1976 und Kapsoli, Ayllus du soleil-anarchisme et utopie andine, 1984.
84Während die Abhängigkeit im traditionellen Sinne der Präsenz ausländischen Kapitals in wichtigen Industrien entspricht (Petroperu, die Tintaya-Minen usw.), basiert diese „neue Abhängigkeit“ auf der Dienstleistungsindustrie und der kulturellen Produktion, die den Tourismus kennzeichnen, sowie auf der Akzeptanz der vom IWF und der Weltbank auferlegten Prinzipien. Infolgedessen ist Peru auf dem Weg, ein Land der Bettler zu werden: von den Kindern, die an den Türen der Touristenrestaurants und -bistros betteln, bis hin zu den Fachkräften, die darum kämpfen, Hilfe von außerhalb des Landes zu erhalten.
Mit Abhängigkeit meinen wir eine universelle Beziehung zwischen Kapital und Proletariat, nicht eine feste Beziehung zwischen Ländern oder geografischen Blöcken.
]]>Gefunden auf anarchist library, die Übersetzung ist von uns. Wir haben die Reihenfolge der Texte geändert, damit es verständlicher ist. Eine weitere Kritik an ‚nationalen Befreiungsbewegungen‘ und die Mythologien mit denen sie sich ernähren.
‚Die EZLN ist nicht anarchistisch: Oder Kämpfe an den Rändern und revolutionäre Solidarität‘ und ‚Eine zapatistische Antwort auf „Die EZLN ist nicht anarchistisch“’
Anmerkung der Redaktion: Da diese Debatte in den letzten Ausgaben von GA viel Platz eingenommen hat, hielten wir es für wichtig, den Menschen, die tatsächlich am zapatistischen Kampf für Autonomie und Freiheit beteiligt sind, ein letztes Wort zu geben. Wir haben den Artikel „Die EZLN ist NICHT anarchistisch“ ursprünglich nicht als Verurteilung der zapatistischen Bewegung gedruckt, von der wir sicherlich viel lernen könnten, sondern eher als kritische Analyse einer populären Volksbewegung, die in der Romantik liberaler oder linker Publikationen oft fehlt. Ja, wir haben einige Orientierungsunterschiede mit vielen, die am Kampf der Zapatisten beteiligt sind, insbesondere in Bezug auf Technologie, Reformen und Marxismus, aber wir unterstützen ihren Kampf für Selbstbestimmung. Der Autor dieser Antwort zeigt einige der subtilen kolonialistischen Tendenzen nordamerikanischer Aktivisten und Anarchistinnen und Anarchisten auf, derer wir uns stets bewusst sein und an deren Veränderung arbeiten müssen. Als grüne Anarchistinnen und Anarchisten wollen wir sicherlich niemandem eine auf Europa basierende Ideologie aufzwingen, vor allem nicht denjenigen, die eine starke indigene Basis haben, denjenigen, die direkter unter dem Kolonialismus leiden, und denjenigen, die noch mit der Erde verbunden sind. Auch wenn wir einige der Formulierungen bedauern, die der Autor im Originalartikel verwendet hat, freuen wir uns, dass er eine wichtige Diskussion ausgelöst hat, aus der wir hoffentlich alle viel gelernt haben und an der wir gewachsen sind.
Schließlich ist unklar, wessen Stimme diese zapatistische Antwort ist, die das „wir“ benutzt, um bei so wichtigen Themen für alle zu sprechen. Wir stimmen voll und ganz zu, dass Arroganz gegenüber den Kämpfen in Mexiko in keinem Kommentar vorkommen sollte. Vielleicht lohnt es sich auch zu fragen, ob Zentralisierung und Repräsentation antiautoritär sein können? Aus diesen Gründen hegen wir ein tiefes Misstrauen gegenüber der Linken und dem Staat und hoffen, dass sich die laufende Bewegung in Mexiko gegen sie durchsetzt. Für einen interessanten und nachdenklich stimmenden Blick auf die EZLN verweisen wir auf den ausgezeichneten Artikel „A Commune In Chiapas “, der in der staatsfeindlichen kommunistischen/autonomen Zeitung Aufheben erschienen ist und auf deren Website www.chanfles.com zu finden ist. Dieser Artikel wurde auch in Form einer Broschüre von Venomous Butterfly Publications vervielfältigt und kann für zwei Dollar bei der folgenden Adresse bestellt werden: Venomous Butterfly Publications PO Box 31098 Los Angeles, CA 90031.
Die EZLN ist nicht anarchistisch: Oder Kämpfe an den Rändern und revolutionäre Solidarität
Willful Disobedience Band 2, Nummer 7
In einer zukünftigen revolutionären Periode werden die subtilsten und gefährlichsten Verteidiger des Kapitalismus nicht die Leute sein, die pro-kapitalistische und pro-etatistische Parolen rufen, sondern diejenigen, die den möglichen Punkt des totalen Bruchs verstanden haben. Weit davon entfernt, Fernsehwerbung und soziale Unterwerfung zu preisen, werden sie vorschlagen, das Leben zu verändern … aber zu diesem Zweck fordern sie zuerst den Aufbau einer echten demokratischen Macht. Wenn es ihnen gelingt, die Situation zu beherrschen, wird die Schaffung dieser neuen politischen Form die Energie der Menschen aufbrauchen, radikale Bestrebungen vereiteln und die Revolution wieder zu einer Ideologie machen, da das Mittel zum Zweck wird... – Gilles Dauve
Die gegenwärtige Umstrukturierung des Kapitals und seine globale Expansion dringen immer stärker in das Leben derer ein, die am Rande der Gesellschaft leben. Bauern und indigene Völker in nicht-westlichen Ländern der so genannten „Dritten Welt“, die bisher ein gewisses Maß an Kontrolle über ihren Lebensunterhalt hatten, sehen sich gezwungen, ihr Land zu verlassen oder ihre Aktivitäten an die Bedürfnisse des kapitalistischen Weltmarkts anzupassen, nur um zu überleben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass unter diesen Menschen in vielen Teilen der Welt Bewegungen des Widerstands gegen die verschiedenen Aspekte des kapitalistischen Eindringens entstanden sind.
In früheren Ausgaben von Willful Disobedience habe ich über die West Papua Freedom Movement (OPM) geschrieben. Diese Bewegung der Ureinwohner West Papuas, von denen viele noch immer so leben, wie sie es jahrhundertelang vor der Ankunft der Kolonialmächte getan haben, wehrt sich ganz klar gegen das „moderne Leben“ – also gegen den Staat, das Kapital und alles, was die industrielle Zivilisation vorschreibt. Oder wie sie in Kommuniqués gesagt haben: „Wir wollen in Ruhe gelassen werden!“ Aber das ist die eine Sache, die das Kapital und der Staat niemals gewähren werden. Obwohl die OPM Delegierte entsandt hat, um Gespräche mit der indonesischen Regierung zu fordern, sind sich die West Papuas zunehmend der Aussichtslosigkeit solcher Verhandlungen bewusst. In den jüngsten Kommuniqués ist immer häufiger davon die Rede, dass sie notfalls bis zum Tod kämpfen werden. Denn sich dem Eindringen des Kapitals zu beugen, würde in jedem Fall ihren geistigen Tod bedeuten. Ihre Klarheit darüber, was sie nicht wollen, hat wahrscheinlich maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Bewegung zwar bewaffnet ist, aber nie eine eigenständige militärische Organisation entwickelt hat, sondern mit den traditionellen Methoden ihrer Kultur kämpft. Andererseits sind sie der Ideologie des Nationalismus nicht ganz entkommen, oder zumindest dem Versuch, damit vor der Weltöffentlichkeit glaubwürdig zu sein. Dennoch steht diese Bewegung dafür, dass sie sich nur wenige Illusionen darüber macht, was die zivilisierte Gesellschaftsordnung und ihre Institutionen zu bieten haben.
Ein weiterer Kampf am äußersten Rand der kapitalistischen Expansion ist der des Volkes von Bougainville, einer Insel etwa fünf Meilen westlich der Salomonen, die seit 1975 unter der Herrschaft von Papua-Neuguinea (nicht zu verwechseln mit Westpapua) steht. Die Bewohner der Insel wurden zur Revolte getrieben, als die CRA, eine australische Tochtergesellschaft von Rio Tinto Zinc, eine Kupfermine errichtete, durch die Hunderte von Einheimischen ihre Häuser, ihr Land und ihre Fischereirechte verloren und einen Großteil des Dschungels zerstörten. Die Mine dehnte sich aus, bis sie einen halben Kilometer tief war und einen Durchmesser von sieben Kilometern hatte. Proteste, Petitionen und Forderungen nach Entschädigung blieben erfolglos. Deshalb stahlen 1988 eine Handvoll Insulanerinnen und Insulaner Sprengstoff von der Bergbaufirma und begannen, deren Strukturen und Maschinen zu zerstören. Als die Regierung von Papua-Neuguinea (PNG) ihre Streitkräfte schickte, wurde die Bougainville Revolutionary Army (BRA) gegründet, um das PNG-Militär und seine australischen Berater zu bekämpfen. Nur mit selbstgebauten Gewehren bewaffnet, mit einer totalen Blockade der Insel durch australische Boote und Hubschrauber konfrontiert und von der Außenwelt weitgehend ignoriert, hat das Volk von Bougainville fast seine Autonomie erreicht. 1997 wurde ein Friedensprozess eingeleitet und die PNG-Soldaten, die sich noch auf der Insel aufhielten, wurden in ihre Kasernen zurückgeschickt. Eine unabhängige Regierungsbehörde hat begonnen, sich zu entwickeln – sicherlich, um einem autonomen Bougainville in den Augen der Staaten der Welt Glaubwürdigkeit zu verleihen – und das wird sich wahrscheinlich auf den Wiederaufbau der Gemeinschaft und der Umwelt auswirken und es Bougainville erleichtern, in die ökonomische Weltordnung einbezogen zu werden. Wie in Terra Selvaggio gesagt wurde: „Die Geschichte der Rebellion ist viel zu voll von Befreiern, die sich in Kerkermeister verwandeln, und Radikalen, die ihre Programme zur sozialen Veränderung ‚vergessen‘, sobald sie die Macht ergriffen haben.“ Die geringen Ausmaße der Insel und das Fehlen von städtischen Zentren erschweren jedoch den Aufbau der Staatsmacht. Und die Entschlossenheit der Menschen, die Wiedereröffnung der Mine nicht zuzulassen, ist ihr bester Schutz gegen die Expansion des Kapitals auf der Insel.
Während die indigene Bevölkerung Westpapuas und Bougainvilles noch nicht wirklich in den kapitalistischen Markt integriert wurde – was ihnen gewisse Vorteile verschafft, sowohl was die Klarheit darüber angeht, was sie zu verlieren haben, als auch in Bezug auf das Wissen über das immer noch größtenteils wilde Terrain, auf dem sie kämpfen -, sehen andere Indigene und Kleinbauern, die bereits bis zu einem gewissen Grad in die Ökonomie eingebunden waren, aber eine gewisse reale Kontrolle über ihren Lebensunterhalt behalten haben, dieses letzte Stückchen Selbstbestimmung nun aufgezehrt und reagieren.
In Indien haben sich Gruppen von Bauern und Bäuerinnen organisiert, um gentechnisch veränderte Nutzpflanzen anzugreifen. Sie haben die gentechnische Veränderung von Saatgut und die Patentierung von genetischen Strukturen als Methoden erkannt, mit denen multinationale Konzerne die Kontrolle über die Nahrungsmittelproduktion, selbst auf der Ebene der Selbstversorgung, endgültig übernehmen. Aber diese Gruppen üben keineswegs eine klare Kritik am Kapitalismus oder am Staat. Neben diesen direkten Angriffen fordern die Gruppen den indischen Staat auf, Gesetze zu erlassen, die sie schützen und ihren Platz in der bestehenden Gesellschaftsordnung bewahren. In ihrer jetzigen Form bleibt ihre Bewegung eine Anti-Globalisierungs-Bewegung.
Der wohl bekannteste indigene Kampf ist der in Chiapas, Mexiko. Dieser Kampf trat mit dem Aufstand vom 1. Januar 1994 ans Licht der Weltöffentlichkeit. Die Stärke des Aufstands, die Präzision seiner Ziele und die allgemeine Situation, aus der er hervorging, weckten sofort die Sympathie von Linken, Progressiven, Revolutionären und Anarchistinnen und Anarchisten auf der ganzen Welt. Der Aufstand wurde von der Zapatistischen Armee für Nationale Befreiung (EZLN) angeführt. Die Sympathie für diesen Kampf ist verständlich, ebenso wie der Wunsch, sich mit dem indigenen Volk von Chiapas zu solidarisieren. Was aus anarchistischer Sicht nicht verständlich ist, ist die meist unkritische Unterstützung für die EZLN. Die EZLN hat keinen Hehl aus ihrer Agenda gemacht. Ihre Ziele sind bereits in der Kriegserklärung, die sie zum Zeitpunkt des Aufstandes 1994 herausgegeben hat, klar erkennbar, und diese Ziele sind nicht nur nicht anarchistisch, sondern nicht einmal revolutionär. In dieser Erklärung wurden die Implikationen des Namens der Armee durch eine nationalistische Sprache verstärkt. Es heißt dort: „Wir sind die Erben der wahren Erbauer unserer Nation“, und sie berufen sich auf das verfassungsmäßige Recht des Volkes, ‚seine Regierungsform zu ändern oder zu modifizieren‘. Sie sprechen wiederholt vom „Recht, politische Vertreterinnen und Vertreter frei und demokratisch zu wählen“ und von „Verwaltungsbehörden“. Und die Ziele, für die sie kämpfen, sind „Arbeit, Land, Wohnung, Nahrung, Gesundheitsversorgung, Bildung, Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden“. Mit anderen Worten: nichts Konkretes, das nicht auch vom Kapitalismus bereitgestellt werden könnte. Nichts in späteren Erklärungen dieser produktiven Organisation hat dieses grundlegend reformistische Programm geändert. Stattdessen ruft die EZLN zum Dialog und zu Verhandlungen auf und erklärt ihre Bereitschaft, Zeichen des guten Willens von der mexikanischen Regierung zu akzeptieren. So verschickt sie Aufrufe an die mexikanische Legislative und lädt sogar Mitglieder dieses Gremiums ein, an dem EZLN-Marsch in die Hauptstadt teilzunehmen, um die Regierung aufzufordern, das 1995 vom Komitee Cocopa ausgearbeitete Friedensabkommen von San Andres durchzusetzen. Wir sehen also, dass die EZLN, obwohl sie bewaffnet und maskiert ist, eine reformistische Organisation ist. Sie behauptet, im Dienste der indigenen Bevölkerung von Chiapas zu stehen (so wie Maos Armee behauptete, im Dienste der Bauern und Arbeiter Chinas zu stehen, bevor Mao an die Macht kam), aber sie bleibt eine spezialisierte militärische Organisation, die vom Volk getrennt und nicht vom bewaffneten Volk ist. Sie haben sich zum öffentlichen Sprachrohr des Kampfes in Chiapas gemacht und ihn in reformistische Forderungen und Appelle an Nationalismus und Demokratie kanalisiert. Es gibt Gründe, warum die EZLN zum Liebling der Antiglobalisierungsbewegung geworden ist: Ihre Rhetorik und ihre Ziele stellen keine Bedrohung für diejenigen Elemente in dieser Bewegung dar, die lediglich eine stärkere nationale und lokale Kontrolle des Kapitalismus anstreben.
Natürlich kann man nicht erwarten, dass die sozialen Kämpfe der ausgebeuteten und unterdrückten Menschen einem abstrakten anarchistischen Ideal entsprechen. Diese Kämpfe entstehen in bestimmten Situationen, ausgelöst durch bestimmte Ereignisse. Die Frage der revolutionären Solidarität in diesen Kämpfen ist daher die Frage, wie man auf eine Art und Weise intervenieren kann, die mit den eigenen Zielen übereinstimmt und das revolutionäre anarchistische Projekt vorantreibt. Um das zu tun, muss man klare Ziele und eine klare Vorstellung von seinem Projekt haben. Mit anderen Worten: Man muss seinen eigenen täglichen Kampf gegen die gegenwärtige Realität mit Klarheit und Entschlossenheit führen. Eine unkritische Unterstützung der oben beschriebenen Kämpfe zeigt, dass es an Klarheit darüber mangelt, was ein anarchistisches revolutionäres Projekt sein könnte, und eine solche Unterstützung ist ganz sicher keine revolutionäre Solidarität. Jeder unserer Kämpfe entspringt aus unserem eigenen Leben und unseren eigenen Erfahrungen mit Herrschaft und Ausbeutung. Wenn wir diese Kämpfe im vollen Bewusstsein der Natur des Staates und des Kapitals, der Institutionen, mit denen diese Zivilisation unsere Existenz kontrolliert, angehen, wird klar, dass nur bestimmte Methoden und Praktiken zu dem von uns gewünschten Ziel führen können. Mit diesem Wissen können wir unsere eigenen Projekte klären und unser Bewusstsein für die Kämpfe auf der ganzen Welt zu einem Werkzeug machen, mit dem wir unseren eigenen Kampf gegen die gegenwärtige Gesellschaftsordnung verfeinern können. Revolutionäre Solidarität bedeutet, gegen die Gesamtheit einer Existenz zu kämpfen, die auf Ausbeutung, Beherrschung und Entfremdung beruht, wo immer man sich befindet. Vor diesem Hintergrund muss die revolutionäre Solidarität die Waffe der unnachgiebigen, gnadenlosen Kritik an allen reformistischen, nationalistischen, hierarchischen, autoritären, demokratischen oder klassenkollaborierenden Tendenzen ergreifen, die die Autonomie und Selbstaktivität der Kämpfenden untergraben und den Kampf in Verhandlungen und Kompromisse mit der bestehenden Ordnung lenken könnten. Diese Kritik muss auf einer klaren Vorstellung von der Welt beruhen, die wir zerstören müssen, und von den Mitteln, die für diese Zerstörung notwendig sind.
Eine zapatistische Antwort auf „Die EZLN ist nicht anarchistisch“
Zuallererst muss gesagt werden, dass nur kleine Teile des Frente Zapatista bereit sind, sich auf eine Debatte mit unbedeutenden Elementen entlang eines ideologischen Randes einzulassen. Man würde sogar noch weniger Kämpfer innerhalb des Ejercito Zapatista finden, die bereit wären, sich auf unfassbare rhetorische Schlachten mit Leuten einzulassen, deren größte Tugend es ist, ihren Mangel an Verständnis und Wissen in Zeitungen und Zeitschriften zu verbreiten. Aber der Artikel mit dem Titel „Die EZLN ist NICHT anarchistisch“ spiegelt eine solch kolonialistische Haltung arroganter Ignoranz wider, dass einige von uns beschlossen haben, eine Antwort an dich zu schreiben.
Du hast Recht. Die EZLN und ihre größere populistische Organisation, die FZLN, sind KEINE Anarchistinnen und Anarchisten. Das wollen wir auch nicht sein und das sollten wir auch nicht sein. Damit wir in unseren sozialen und politischen Kämpfen konkrete Veränderungen bewirken können, dürfen wir uns nicht auf eine einzige Ideologie festlegen. Unser politischer und militärischer Körper umfasst ein breites Spektrum an Glaubenssystemen aus einer Vielzahl von Kulturen, die sich nicht unter einem engen ideologischen Mikroskop definieren lassen. Es gibt Anarchistinnen und Anarchisten in unserer Mitte, genauso wie Katholiken, Kommunisten und Anhänger der Santeria. Wir sind Indigene auf dem Land und Arbeiterinnen und Arbeiter in der Stadt. Wir sind Politiker im Amt und obdachlose Kinder auf der Straße. Wir sind schwul und heterosexuell, männlich und weiblich, wohlhabend und arm. Was wir alle gemeinsam haben, ist die Liebe zu unseren Familien und unserem Heimatland. Was wir alle gemeinsam haben, ist der Wunsch, die Dinge für uns und unser Land zu verbessern. Nichts davon kann erreicht werden, wenn wir Mauern aus Worten und abstrakten Ideen um uns herum errichten.
In den letzten 500 Jahren wurden wir einem brutalen System der Ausbeutung und Erniedrigung unterworfen, wie es nur wenige in Nordamerika je erlebt haben. Uns wurde schon Land und Freiheit verwehrt, bevor es euer Land überhaupt gab, und wir haben daher eine ganz andere Sicht auf die Welt als ihr. Wir wurden durch die Kolonialherrschaft zuerst von den Spaniern, dann von den Franzosen und Deutschen und zuletzt von den Nordamerikanern unterworfen. Jahrhundertelang waren Mexikanerinnen und Mexikaner Sklaven und Futter und wurden als weniger als Menschen behandelt; eine Tatsache, die uns bis heute schmerzt und die wir nicht vergessen können und dürfen. Unsere Vergangenheit hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind, und bei dem Versuch, diesen historischen Trend der Ausbeutung zu durchbrechen, haben wir uns mehrfach erhoben, um unsere Menschlichkeit zurückzufordern und unser Leben zu verbessern. Zuerst kämpften wir mit Juarez und Hidalgo gegen die spanische Krone, dann mit Zapata und Villa gegen den Porfiriato. Jetzt kämpfen wir gegen die verschiedenen Gesichter desselben Kopfes, der versucht, uns als untermenschliche Diener des Kapitals zu versklaven. Das ist kein Kampf, den wir aus einem Buch oder einem Film aufgeschnappt haben, sondern ein Kampf, den wir alle in dem Moment geerbt haben, in dem wir das Licht des Lebens erblickt haben. Es ist ein Kampf, der uns allen vor Augen steht und sogar durch unser Blut fließt. Es ist ein Kampf, für den viele unserer Väter und Großväter gestorben sind und für den wir selbst bereit sind zu sterben. Ein Kampf, der für unser Volk und unser Land notwendig ist. Deine herablassende Sprache und deine arrogante Kurzsichtigkeit machen deutlich, dass du nur sehr wenig über die mexikanische Geschichte oder die Mexikaner im Allgemeinen weißt. Wir mögen „grundsätzlich reformistisch“ sein und für „nichts Konkretes arbeiten, das der Kapitalismus nicht bereitstellen könnte“, aber sei versichert, dass Nahrung, Land, Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden furchtbar kostbar sind, wenn du sie nicht hast. Kostbar genug, um um jeden Preis dafür zu kämpfen, selbst auf die Gefahr hin, ein paar bequeme Menschen in einem fernen Land zu verärgern, die ihr Glaubenssystem für wichtiger halten als die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse. Wertvoll genug, um mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dafür zu kämpfen, sei es durch Verhandlungen mit dem Staat oder durch Vernetzung in der Volkskultur. Unser Kampf tobte schon, bevor Anarchismus überhaupt ein Wort war, geschweige denn eine Ideologie mit Zeitungen und Anhängern. Unser Kampf ist älter als Bakunin oder Kropotkin. Auch wenn Anarchistinnen und Anarchisten und Gewerkschaften/Syndikate tapfer mit uns gekämpft haben, sind wir nicht bereit, unsere Geschichte für eine engstirnige Ideologie herabzusetzen, die aus denselben Ländern exportiert wird, gegen die wir in unseren Unabhängigkeitskriegen gekämpft haben. Der Kampf in Mexiko, ob zapatistisch oder nicht, ist ein Produkt unserer Geschichte und unserer Kultur und kann nicht so verbogen und manipuliert werden, dass er in die Formel eines anderen passt, schon gar nicht in eine Formel, die nichts über unser Volk, unser Land oder unsere Geschichte weiß. Du hast Recht, wir als Bewegung sind keine Anarchistinnen und Anarchisten. Wir sind Menschen, die versuchen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und eine Würde zurückzuerlangen, die uns in dem Moment gestohlen wurde, als Cortes an die Macht kam.
Wenn wir für diese Ziele kämpfen, müssen wir das tun, was für uns alle am effektivsten ist, ohne der Versuchung zu erliegen, uns in kleine Grüppchen aufzuteilen, die von denen, die uns versklavt halten, leichter zu kaufen sind. Diese Lektion haben wir von La Malinche gelernt, als sie Cortes dabei half, 30 Millionen Mexikaner in eine leicht zu erobernde Gruppe von Streithähnen aufzuteilen. Wir haben diese Lektion von der Herrschaft des Porfiriato nach der Unabhängigkeit und dem Verrat durch die reichen Mächte nach der Revolution gelernt. Wir sehen engstirnige Ideologien wie Anarchismus und Kommunismus als Werkzeuge, um die Mexikanerinnen und Mexikaner in leichter ausbeutbare Gruppen zu zerlegen. Anstatt unsere Feinde als Gruppen zu betrachten, die gegeneinander ausgespielt werden können, ziehen wir es vor, als gemeinsames Volk mit einem gemeinsamen Ziel zusammenzuarbeiten. In deinem Artikel wird das Wort „Kompromiss“ verwendet, als wäre es ein Schimpfwort. Für uns ist es der Kitt, der uns alle in einem gemeinsamen Kampf zusammenhält. Ohne diese Kompromisse, die es uns ermöglichen, zusammenzuarbeiten, wären wir nirgendwo; einsame Sklaven, die darauf warten, ausgebeutet zu werden, so wie wir es in der Vergangenheit waren. Dieses Mal werden wir uns nicht kaufen lassen. Wir werden uns nicht als Einzeleinheiten behandeln lassen und Gefälligkeiten von den Mächten annehmen, die aus unserem Unglück Reichtum schöpfen. Und so wie wir die Dinge im Moment angehen, funktioniert es auch. 60 Millionen Menschen haben Petitionen unterschrieben, um den Krieg in Chiapas zu beenden. Der Zapatismus ist wieder lebendig. Wir haben Zellen in jeder Stadt, in jedem Bundesstaat und im ganzen Land, die sich aus Menschen aus dem gesamten demografischen Spektrum zusammensetzen. Wir sind organisiert. Wir sind mächtig. Wir werden in unserem Kampf erfolgreich sein, weil wir einfach zu groß und zu gut organisiert sind, um von den Mächten ignoriert oder unterdrückt zu werden. Was wir haben, mag nicht perfekt sein. Es mag nicht ideal sein. Aber es funktioniert für uns jetzt auf eine sehr sichtbare Weise. Und wir würden nicht zögern zu sagen, dass ihr, wenn ihr in unserer Lage wärt, dasselbe tun würdet. Aber was uns in eurem Artikel wirklich wütend gemacht hat, war das altbekannte Gesicht des Kolonialismus, das durch eure guten Absichten hindurchscheint. Viele Nordamerikanerinnen und Nordamerikaner kommen nach Mexiko und rümpfen die Nase über unser Essen und unseren Lebensstil und behaupten, dass wir nicht so gut sind wie das, was sie „zu Hause“ haben. Der Autor deines Artikels tut dasselbe in seinen „Kritiken“ am Zapatismus. Hätten diese „Kritiken“ eine ausführliche Diskussion über unsere Taktik mit Bezug auf unsere Geschichte und unsere aktuelle Position in der Welt beinhaltet, wäre das keine große Sache gewesen, nichts, was wir nicht ständig innerhalb unserer eigenen Organisationen tun. Aber die Tatsache, dass er den Zapatismo einfach als Avantgarde der reformistischen Nationalisten abtat, ohne auch nur einen Hauch von Analyse, warum das so ist, zeigt einmal mehr, dass wir Mexikanerinnen und Mexikaner nicht so gut sind wie der allwissende nordamerikanische Imperialist, der sich für bewusster, intelligenter und politisch ausgefeilter hält als der dumme Mexikaner. Diese Haltung, auch wenn sie sich hinter einem dünnen Schleier der Objektivität verbirgt, ist dieselbe Haltung, mit der wir es seit 500 Jahren zu tun haben: Jemand anderes in einem anderen Land aus einer anderen Kultur denkt, dass er besser weiß, was das Beste für uns ist als wir selbst. Noch abstoßender war für uns die Zeile „Die Frage der revolutionären Solidarität in diesen Kämpfen ist also die Frage, wie man auf eine Art und Weise interveniert, die zu den eigenen Zielen passt, auf eine Art und Weise, die das eigene revolutionäre anarchistische Projekt voranbringt.“ Es wäre schwierig für uns, eine prägnantere Liste von kolonialen Wörtern und Haltungen zu entwerfen als die in diesem Satz verwendeten. „Intervenieren?“ „Das eigene ‚Projekt‘ vorantreiben?“ Die Mexikaner haben ein sehr ausgeprägtes Verständnis davon, was „Intervention“ bedeutet. Versuch mal, Conquista und Villahermosa und Tejas und Maximilian in einem Geschichtsbuch nachzuschlagen, um auch nur einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, was wir sehen, wenn Nordamerikaner von „Intervention“ sprechen. Aber noch einmal: Die Anarchistinnen und Anarchisten in Nordamerika wissen besser als wir, wie man einen Kampf führt, den wir schon 300 Jahre vor der Gründung ihres Landes geführt haben, und können deshalb sogar daran denken, uns als Mittel zu benutzen, um „ihr Projekt voranzubringen“. Das ist genau die gleiche Einstellung, mit der Kapitalisten und Reiche Mexiko und den Rest der Dritten Welt in den letzten fünfhundert Jahren ausgebeutet und erniedrigt haben. Auch wenn in diesem Artikel viel von Revolution die Rede ist, unterscheiden sich die Einstellungen und Ideen des Autors nicht von denen von Cortes, Monroe oder jedem anderen imperialistischen Bastard, den du dir vorstellen kannst. Deine Intervention ist nicht erwünscht, und wir sind auch kein „Projekt“, aus dem einige hochgesinnte Nordamerikaner Profitabilität schlagen können. Der Autor spricht viel von revolutionärer Solidarität, ohne den Begriff jemals zu definieren. Was bedeutet revolutionäre Solidarität für ihn? Aus der Haltung seines Artikels geht hervor, dass revolutionäre Solidarität für ihn mehr oder weniger dasselbe ist, was „Profitabilität“ und „Kosten-Nutzen-Analysen“ für Konzernimperialisten sind, nämlich Mittel und Wege, jemand anderen für den eigenen Vorteil zu benutzen. Solange nordamerikanische Anarchistinnen und Anarchisten kolonialistische Überzeugungen vertreten, werden sie in der Dritten Welt immer ohne Verbündete dastehen. Die Bauern und Bäuerinnen in Bolivien und Ecuador werden deine herablassende koloniale Haltung genauso wenig zu schätzen wissen wie die Freiheitskämpfer und -kämpferinnen in Papua-Neuguinea oder anderswo auf der Welt, auch wenn sie noch so sehr mit deiner starren Ideologie übereinstimmen.
Der Kolonialismus ist einer der vielen Feinde, die wir in dieser Welt bekämpfen, und solange die Nordamerikaner in ihren „revolutionären“ Kämpfen koloniale Denkmuster verstärken, werden sie niemals auf der Seite eines antikolonialen Kampfes stehen, egal wo. Wir haben die Welt darum gebeten, den historischen Kontext, in dem wir uns befinden, zu respektieren und über die Aktionen nachzudenken, mit denen wir uns aus der Unterdrückung befreien wollen. Gleichzeitig solltet ihr eure eigenen Kämpfe in eurem eigenen Land betrachten und die Gemeinsamkeiten zwischen uns erkennen. Nur so können wir eine globale Revolution machen.
]]>Gefunden auf oveja negra, die Übersetzung ist von uns.
Mittwoch, 27. März 2024
DAS VATERLAND IST UNVERKÄUFLICH?
Patriotismus wird als ein implizites politisches Prinzip dargestellt, das dem unglücklichsten Teil der Bevölkerung gerecht wird. Manche gehen davon aus, dass diejenigen, die direkt für unser Unglück verantwortlich sind, ausländische Interessen sind. Und dass unsere Klasse, die des Eigentums beraubt ist, das Vaterland besitzt, oder zumindest das Vaterland ist.
Was bedeutet „das Vaterland ist unverkäuflich“? Dass die derzeitigen Besitzer es behalten? Die argentinische Bevölkerung? Das Volk? Wir sind nicht die Besitzer von irgendetwas. Es gibt keine Möglichkeit, etwas zu verkaufen, das uns nicht gehört.
Wenn wir Arbeiter, Arbeitslose, Rentner sind und protestieren, dann deshalb, weil wir nichts besitzen, nur unsere Arbeitskraft. Die Bourgeoisie hat die Freiheit, sie zu kaufen oder nicht. Wir haben die Freiheit, zu verhungern, wie der Präsident zu Recht sagte.
Der notwendige Angriff auf die derzeitige Regierung, die noch strenger und repressiver ist als die vorherige, bedeutet nicht unbedingt die Verteidigung des Vaterlandes oder der Verwaltung des nationalen Kapitalismus vor dem 10. Dezember letzten Jahres. Man muss sich nur die Zahlen ansehen, um zu erkennen, dass die Anpassung nicht erst Ende letzten Jahres begonnen hat, sondern schon seit Jahrzehnten andauert, und dass dieser Schock eine abrupte Verschärfung darstellt.
Die notwendigste und unmittelbarste Forderung ist heute eine Erhöhung der Gehälter, Sozialleistungen und Renten. Es ist jedoch vom Vaterland die Rede… Im Vaterland ist, wie im „Volk“, Platz für alles, für die Ausgebeuteten und die Ausbeuter, die Hungernden, die Enteigneten, die Armee, die Polizei, die politischen Parteien und die Gewerkschaften/Syndikate.
Diese Kritik schlägt nicht vor, sich von Mobilisierungen, Vollversammlungen, Kämpfen zurückzuziehen oder die Hoffnung zu verlieren. Jenseits der Politik gibt es Forderungen, die uns vereinen, auch wenn es unterschiedliche Meinungen und Analysen gibt. Der Kampf ums bloße Überleben bedeutet nicht die Verteidigung des Status quo, der kapitalistischen Normalität, er kann auch neue Möglichkeiten eröffnen. Die Herausforderung besteht nicht darin, dem Nationalismus und dem Etatismus zuzuarbeiten, nicht Wahlkampf für die vermeintlichen Retter zu machen, die in Wahrheit nur die nächste Phase der Ökonomie dieses Landes verwalten.
Die soziale Frage stellt sich nicht in patriotischen Begriffen, sondern in Klassenbegriffen. Es ist keine Frage der nationalen Souveränität, der Schuldzuweisung an den IWF, der Schuldzuweisung an diese oder jene, usw., usw., usw. Es geht um die Art und Weise, wie die Profite unserer Ausbeutung oder die Verurteilung zum Ausschluss, während wir darauf warten, ausgebeutet zu werden, aufgeteilt werden. Das bringt uns zusammen, ob wir Lohnempfänger sind oder nicht, und es liegt an uns, ob wir unseren eigenen Weg bauen oder weiterhin denen der Bourgeoisie folgen, ob national oder ausländisch.
]]>
Aus der dritten Ausgabe der anarchistischen Publikation aus dem Balkan Antipolitika, die Übersetzung ist von uns.
Im Verlies des Nationalismus
Die Kommunistische Partei Jugoslawiens und die nationale Frage
Einleitung
Wenn vom Zerfall des sozialistischen Jugoslawiens die Rede ist, wird als eine der Ursachen der jahrhundertealte ethnische Hass zwischen Serben und Kroaten genannt, aufgrund dessen der Staat, der sie zu vereinen versuchte, einfach nicht überleben konnte. Abgesehen davon, dass dieses Argument nationalistisch ist und die Geschichte des sozialistischen Jugoslawiens bis zur Absurdität vereinfacht, projiziert es auch Vorstellungen über die Ethnien der Menschen auf dem nördlichen Balkan in die Geschichte zurück, die ihre heutige Form gerade während der Zeit des sozialistischen Jugoslawiens angenommen haben. Im 19. Jahrhundert wie auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts existierten heterogene Vorstellungen darüber, wer die Menschen im Norden des Balkans sind, welchen Namen man für sie verwenden sollte, ob sie eine Nation oder mehrere Nationen sind usw., und sie hingen in hohem Maße von den aktuellen politischen Interessen der Vertreter einer bestimmten Idee ab1.
Die Verbrechen des Ustascha-Regimes im Zweiten Weltkrieg bestätigten auf blutige Art und Weise eine bis dahin politisch und gesellschaftlich marginale Vision der ethnischen Beziehungen auf dem nördlichen Balkan. So sehr der Sieg des Nationalen Befreiungskampfes (NBK, NOB) unter der Führung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens (KPJ) die Negation dieser Vision war, so wenig gelang es dem etablierten Staat, der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ), mit seiner nationalen Politik die künstlichen ethnischen Trennungen zu dekonstruieren, sondern stattdessen die Bindungen von Territorium, Ethnizität und staatlicher Verwaltung zu institutionalisieren und zu stärken. Die Gefühle und Ideen über Nationen, die die heutigen Menschen mit Lebenserfahrung in Jugoslawien und Post-Jugoslawien haben, sind nicht das Ergebnis historischer Ereignisse und Ideen von Figuren aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert, die heute Teil individueller nationaler Erzählungen sind2. Die Annahme einer Kontinuität dieser Ideen bis in die Gegenwart ist eine ahistorische und nationalistische Idee. Diese Gefühle und Ideen sind vor allem das Ergebnis der jahrzehntelangen Institutionalisierung der Nationen in den jugoslawischen sozialistischen Republiken, der Institutionalisierung der kapitalistischen Verhältnisse und all dessen, was dies in der Alltagserfahrung der Menschen mit sich bringt. Als Anhänger der Komintern und der bourgeoisen Ideologie der nationalen Befreiung3 von Lenin war die Idee, dass eine Alternative zum Königreich Jugoslawien etwas anderes sein könnte als eine andere Form der Staatsmacht, schon sehr früh (1920) aus dem Horizont der politischen Ansichten der KPJ verschwunden. Aufgrund der gleichen Loyalität zu Lenin war die KPJ der Hauptbefürworter des Fortschritts und der kapitalistischen Entwicklung, die notwendigerweise mit dem Nationalismus verflochten sind. Dank der Politik der KPJ und der SFRJ wird die Reproduktion des Lebens der Arbeiterinnen und Arbeiter ein Nebenprodukt der Reproduktion des Staates und des Kapitals bleiben, und die „befreiten“ Menschen der unterdrückten Nationen werden die Grundlage der zukünftigen nationalen Polizei und der nationalen Armeen sein.
Ziel des vorliegenden Textes ist es, einen Überblick über die Politik der Kommunistischen Partei Jugoslawiens in der nationalen Frage von ihrer Gründung 1919 bis zum Zusammenbruch der SFRJ 1991 zu geben; sie in Bezug auf ihren historischen, sozialen und ökonomischen Kontext aus einer Perspektive zu betrachten, für die die einzige Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft durch eine vollständige Zerlegung ihrer Grundelemente – abstrakte Arbeit, Warenproduktion, Geschlecht, Staat und Nation – erreicht werden kann. Die Geschichtsschreibung aus der Zeit der SFRJ bewertet die nationale Politik der KPJ im Laufe der Geschichte aus einem leninistischen Blickwinkel, indem sie alles, was ihr nahe steht, als positiv und alles, was von Lenins Konzeptionen abweicht, als wahnhaft oder dem Problem nicht angemessen bewertet. Auch die zeitgenössische Geschichtsschreibung nähert sich der Bewertung dieser Politiken ausschließlich aus der bourgeoisen Dichotomie von rechts oder links, und nicht aus der Perspektive der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die rechte Perspektive sieht in Jugoslawien nur die Unterdrückung der nationalen Freiheiten, was, wie wir sehen werden, sehr weit von der Wahrheit entfernt ist. Die linke Perspektive lässt sich weitgehend von der Logik der Eroberung und der Bewahrung der Kontinuität der Staatsmacht leiten und bewertet die Politiken positiv, die ihrer Meinung nach zum Einfluss der KPJ und zur Stabilität der SFRJ beigetragen haben.
Der Text gliedert sich in drei Kapitel: Nationalismus als Strategie zur Eroberung der Macht (von der Gründung der Partei 1919 bis zum Kriegsende 1945), Nationalismus und primitive Akkumulation (die Zeit des so genannten revolutionären Etatismus 1945-1963) und Nationalismus und die Herrschaft des Staates über die Gesellschaft (die Zeit der so genannten sozialistischen Selbstverwaltung ab 1963). In diesen Abschnitten wird die nationale Politik der KPJ in Bezug auf ihre Rolle als Förderer der Interessen des Kapitals, Anführer der Industrialisierung und Hüter der Staatsmacht dargestellt. Da der historische Zeitraum, den der Text abdeckt, bereits recht umfangreich ist, werde ich der Kürze halber nicht auf Phänomene des Nationalismus eingehen, die nicht in engem Zusammenhang mit der Parteipolitik, den Debatten über den Nationalismus und das politische System Jugoslawiens in den späteren 80er Jahren, den Verfassungsänderungen von 1988 und den darauf folgenden Ereignissen stehen, die zum Zerfall Jugoslawiens führten4.
Nationalismus als Strategie zur Erlangung der Macht
Von der Gründung der Partei 1919 bis zum Ende des Krieges 1945
Unsere Parteien müssen wissen, dass sie nicht nur für den Achtstundentag usw. kämpfen, sondern auch dafür, unter den gegebenen Umständen die Massen zu gewinnen, sie müssen wissen, dass die nationale Frage in vielen Ländern eine unserer stärksten Waffen im siegreichen Kampf gegen das bestehende Regime ist.
Sinowjew, Schlussbemerkung
Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale
III. Erweitertes Plenum, Juni 1923
Der Erste Weltkrieg brachte die als jugoslawisch geltenden Völker in eine ungleiche politische Lage. Das serbische Bürgertum hatte einen Nationalstaat und strebte die Befreiung und Vereinigung der noch nicht befreiten Serben an. Die kroatische Bourgeoisie war gespalten, ohne Nationalstaat, aber mit einer gewissen Autonomie und einem starken Einfluss des Staatsrechts auf ihre nationale Ideologie. Albanien war Teil des Osmanischen Reiches. Die slowenische Bourgeoisie lebte in mehreren Kronländern, ohne Nationalstaat und Staatstradition. Die montenegrinische Bourgeoisie baute ihren Nationalstaat auf und betrachtete sich gleichzeitig als Teil Serbiens, aber mit eigenen nationalen Merkmalen. Das mazedonische Segment wurde nicht als Nationalität anerkannt und war das Objekt der Aneignung durch mehrere Bourgeoisien der Balkanstaaten. Bis zur Gründung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens stand die Arbeiterbewegung in Slowenien, Bosnien und Herzegowina, der Vojvodina und Kroatien unter dem Einfluss Österreichs und Ungarns, während die Bewegung in Serbien von der deutschen Sozialdemokratie beeinflusst wurde. Die sozialdemokratischen Parteien in den jugoslawischen Ländern, die Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet wurden, machten in Bezug auf die nationale Frage eine lange und unterschiedliche Entwicklung durch. Die Sozialdemokratische Partei Serbiens (SSDP) agierte in einem unabhängigen Nationalstaat, in dem die serbische Bourgeoisie ihr nationales Programm aufstellte, und im Zusammenhang mit der noch nicht abgeschlossenen Befreiung und Vereinigung des serbischen Volkes. Als Partei eines unabhängigen Staates genoss die SSDP größere Unabhängigkeit in der II. Internationale und die nationale Frage war für sie in erster Linie eine politische und ökonomische Frage. Auf der anderen Seite, war die nationale Frage bis zum Krieg aufgrund der Unterentwicklung der sozialistischen Bewegung und ihrer Unterordnung unter die Sozialdemokratische Partei Österreichs in der II. Internationale, für die sozialdemokratischen Parteien unter der österreichisch-ungarischen Herrschaft die nationale Frage eine kulturelle Frage innerhalb der Grenzen des Legitimismus und der Forderung nach einer demokratischen und föderalistischen Umgestaltung der österreichisch-ungarischen Monarchie. Die Wahrnehmung der nationalen Frage als kulturelle Frage änderte sich jedoch nach den Balkankriegen und dem Sieg Serbiens.5 Die SSDP war die erste, die das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker, die Idee des Zusammenhangs zwischen dem Kampf um soziale und nationale Befreiung und die Föderation auf dem Balkan als Formel für die Lösung der Balkanfrage aufstellte. Nach der Vereinigung des Königreichs Serbien, Montenegro und der südslawischen Teile Österreich-Ungarns im Jahr 1918 zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (ab 1929 Königreich Jugoslawien)6 verstand die SSDP den neuen Staat als Nationalstaat und die Serben, Kroaten und Slowenen als eine Nation. In der Frage der Staatsform befürwortet sie den Zentralismus, der ihrer Meinung nach große Vorteile für den Kampf des Proletariats bietet, und in der nationalen Frage den Unitarismus.7
Im Dezember 1918 initiierten die Führungen der sozialdemokratischen Parteien in Serbien und Bosnien und Herzegowina die Vereinigung der Arbeiterorganisationen im neuen Staat. Der Kongress zur Vereinigung der sozialdemokratischen Parteien und Organisationen fand vom 20. bis 23. April 1919 in Belgrad statt. Auf diesem Kongress wurde die Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei Jugoslawiens (Kommunisten) (Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista) – SRPJ(k)) beschlossen. Neben den Mitgliedern der sozialdemokratischen Parteien bestand sie hauptsächlich aus unabhängigen Linken, von denen viele, zumindest in den ehemaligen österreichisch-ungarischen Gebieten, aus den Reihen der Nationalistischen Jugend kamen8. Die Einigung Jugoslawiens 1918 wurde von der gesamten jugoslawischen Sozialdemokratie unterstützt. Die SRPJ(k) akzeptierte die Vereinigung als Ergebnis der nationalen Revolution der jugoslawischen Bourgeoisie, lehnte aber den Monarchismus und Zentralismus des rechtlichen und politischen Systems ab. Sie erkannte drei nationale Bourgeoisien an – die kroatische, die serbische und die slowenische -, aber nicht, dass es drei Völker gibt. Für sie waren das vielmehr drei historische Bezeichnungen für ein und dasselbe Volk. Nationalistische Konflikte sind also die Konflikte der nationalen bürgerlichen Parteien, die sich aus dem kapitalistischen System und aus der Art und Weise ergeben, wie die Einigung vollzogen wurde. Als Lösung der nationalen Frage traten sie für eine Reorganisation der Monarchie in eine Republik und einen Nationalstaat mit weitestgehenden Selbstverwaltungsrechten der Regionen, Bezirke und Gemeinden ein.
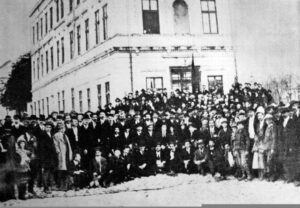
Delegierte des ersten Kongresses der SRPJ(k) vor dem Hotel Slavija, Belgrad, 1919
Von ihrer Gründung an akzeptierten die „Radikalen“ innerhalb der SRPJ(k) die Ideen der III. Internationale: die Idee eines bewaffneten Weges zum Sozialismus durch die Vereinigung der Arbeiterbewegungen der jugoslawischen Völker zu einer einzigen proletarischen Front; die These von der einheitlichen jugoslawischen Nation; die Idee, dass die Errichtung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen den reinen Klassenkampf des Proletariats erleichtert und dass die nationale Frage eine bourgeoise Frage ist. Auf der anderen Seite standen die „Zentristen“ für legale Formen der Aktion und soziale Reformen. Sie akzeptierten die Haltung zur nationalen Einheit der Serben, Kroaten und Slowenen, waren aber gegen die Zentralisierung der Partei und glaubten, dass ihre Föderalisierung der Idee der nationalen Einheit dienen könnte.
![]()
Es sollte erwähnt werden, dass der Standpunkt der Komintern zur Vereinigung der jugoslawischen Völker, der in der Proklamation an die kommunistischen Parteien des Balkans 1920 zum Ausdruck kam, darin bestand, dass das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen durch die bewaffnete Macht der Entente und Serbien als deren Verbündeten geschaffen wurde, ohne die Meinung der Nation zu berücksichtigen. Gestützt auf die Entente, die Bourgeoisie und die nationalistische sozialdemokratische Bewegung, bestand seine Aufgabe darin, eines der Zentren der weltweiten Konterrevolution zu werden und so revolutionäre Bewegungen auf seinem Territorium zu verhindern und sich der russischen und internationalen sozialistischen Revolution entgegenzustellen. Die Komintern lehnte eine solche Vereinigung ab, weil sie nicht auf der Selbstbestimmung der Nation beruhte und weil sie eine erhebliche territoriale Ausdehnung Serbiens bedeutete, was die nationale Frage auf dem Balkan noch komplizierter machte. Ihre Idee war, dass das Proletariat des Balkans nach einer erfolgreichen proletarischen Revolution seine staatliche Vereinigung in einer föderierten sozialistischen Balkan- (oder Balkan-Donau-) Sowjetrepublik erreichen würde.
Auf dem Zweiten Kongress der SRPJ(k) in Vukovar vom 20. bis 25. Juni 1920 wurde die „radikale“ Strömung zur dominierenden. Die Partei änderte ihren Namen in Kommunistische Partei Jugoslawiens (KPJ) und trat der Komintern bei. Ein Teil der Zentristen verließ den Kongress, und die übrigen wurden im Dezember 1920 aus der Partei ausgeschlossen. Die Position der Komintern, dass das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen8 durch die Sowjetrepublik Jugoslawien ersetzt werden müsse, die der Föderation der Balkan-Donau-Länder9 beitreten und Teil der internationalen Föderation der Sowjetrepubliken sein sollte, wurde nun akzeptiert. Sie lehnten jedoch die Vorstellung der Komintern von einem erweiterten Serbien und einer serbischen Hegemonie ab und behaupteten, dass es in dem neuen Staat nur eine Nation, die jugoslawische Nation, sowie nationale Minderheiten geben würde.

Zweiter Kongress der SRPJ(k) in Vukovar , 1920
Trotz des großen Erfolgs der Partei bei den Wahlen im August 1920 wurden bereits Ende des Jahres die Mandate der KPJ in der Nationalen Vollversammlung durch das Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und der staatlichen Ordnung (zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi) annulliert, die Führung wurde verhaftet, ins Exil gezwungen und illegalisiert. Zwei zentrale Fragen wurden für die Partei zentral, die Frage der Fortsetzung der kommunistischen Tätigkeit unter den Bedingungen der Illegalität und die nationale Frage. In den Debatten bildeten sich zwei Lager heraus – „links“ und „rechts“. Die so genannte „Linke“ begann zu glauben, dass die Unterdrückung der Nation und der Klasse miteinander verbunden sind, und akzeptierte schließlich die Position der Komintern, dass die serbische Bourgeoisie die slowenische und kroatische Bourgeoisie unterdrückte, was deren Tendenz zum Föderalismus oder sogar offen antijugoslawische Gefühle fördert. Sie waren der Meinung, dass nationalistische Initiativen in bestimmten Regionen nicht erstickt werden sollten, da dies den Separatismus nur stärken kann. Vielmehr sei es notwendig, die ererbten politischen Traditionen zu respektieren, da die Arbeiterklasse unterdrückter Nationen nicht gleichgültig gegenüber der nationalen Position ihrer Nation sein könne. Nach Ansicht der „Linken“ muss die KPJ mit Separatismus und Föderalismus rechnen, auch wenn es sich dabei um Illusionen handelt. Einige der prominenten „Linken“ waren Đuro Cvijić, Vladimir Ćopić, Ante Ciliga10, Kamilo Horvatin, Kosta Novaković und Triša Kaclerović.
Der „rechte“ Flügel begann zunächst, von den drei Nationen zu sprechen. Die nationale Frage wurde jedoch von den Aufgaben des Klassenkampfes getrennt. Sie vertraten die Auffassung, dass der Staat nicht auf einer ethnisch-föderalen Basis organisiert werden sollte, sondern auf der Grundlage der Autonomie der einzelnen Segmente der jugoslawischen Völker, eine Idee, die der ursprünglichen Idee von Jugoslawien als zentralistischem Staat, die die KPJ 1919 vertrat, nahe kam. Die nationale Frage sollte von der nationalen Bourgeoisie gelöst werden, und die KPJ muss die auf dem Klassenkampf beruhenden sozialen Veränderungen beschleunigen, die dazu führen werden, dass diese Frage von der Tagesordnung verschwindet. Die Einschätzung der „Rechten“ lautete, dass die Revolution noch weit entfernt sei und dass die Autonomie das beste Mittel sei, um ethnische Spaltungen zu verhindern. Sie lehnten die These von der serbischen Bourgeoisie als einziger Ursache für das Entstehen nationaler Spannungen ab und unterschieden nicht zwischen den bürgerlichen Parteien an der Macht und denen in der Opposition, was nach Ansicht der „Linken“ eine Position sei, die die Möglichkeit der Ausweitung der verbündeten Front einschränke. Prominente „Rechte“ waren Sima Marković11, Lazar Stefanović und Ljuba Radovanović, die alle der Sozialdemokratischen Partei Serbiens aus der Vorkriegszeit angehörten.
Sowohl für die „Linken“ als auch für die „Rechten“ war die nationale Frage ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen, nämlich die sozialistische Revolution. Die „Linken“ beschuldigten jedoch die „Rechten“, sich den separatistischen und föderalistischen Ideen der kroatischen Arbeitermassen entgegenzustellen und bürokratische Zentralisten zu sein. Die „Linken“ glaubten, dass der Föderalismus den revolutionären Prozess beschleunigen würde, weil die beschleunigte Lösung der nationalen Frage den Staat destabilisieren würde. Die „Rechten“ hingegen glaubten, dass der Autonomismus zum selben Ziel beitragen würde, da die Vermeidung der nationalen Frage die ungünstigen Auswirkungen des Nationalismus auf die Einheit der Arbeiterklasse verhindern würde. Diese Meinungsverschiedenheit über die nationale Frage wird bis nach der III. Nationalen Konferenz (1924) bestehen. Interessant ist die Willkürlichkeit, mit der diese Positionen als „links“ und „rechts“ bezeichnet werden. Die Position, die sich durchsetzte, nannte sich später „die Linke“. In der Geschichtsschreibung aus der Zeit des sozialistischen Jugoslawien findet sich eine durchgängige Übereinstimmung mit der Position der „Linken“, meist gefolgt von der Feststellung, dass die „Rechte“ die Situation nicht „realistisch“ gesehen habe. Eine „realistische“ Position war also diejenige, die zu mehr Macht führte.
Nach dem IV. Kongress 1922 gewann die Komintern mehr und mehr Autorität über die Mitgliedsparteien, und es wurde eine Sonderkommission für die KPJ gebildet. Die Kommission stellte fest, dass die nationale Frage von zentraler Bedeutung für den Konflikt innerhalb der KPJ war. Als Lösung für die Situation auf dem Balkan betonte der KPJ-Delegierte auf dem IV. Kongress den „Kampf gegen den imperialistischen Frieden und den imperialistischen Krieg“ sowie die Föderative Sowjetrepublik der Donau- und Balkanländer.
Die nationale Frage wurde offiziell auf die Tagesordnung der II. Nationalen Konferenz der KPJ in Wien im Mai 1923 gesetzt. Eines der Hauptprobleme war die so genannte kroatische Frage, d.h. die massenhafte Unterstützung der kroatischen Arbeiterinnen und Arbeiter und der Bauernschaft für die Kroatische Bauernpartei (Hrvatska seljačka stranka, HSS), und eine ähnliche Situation in Bosnien und Herzegowina und Slowenien. Die serbische hegemoniale und zentralistische Politik wurde zur Hauptursache einer solchen Situation erklärt. Nationale Konflikte wurden nun als Konflikte ganzer Stämme und nicht nur der Stammesbourgeoisie interpretiert. Die Konflikte der Bourgeoisie wurden durch die ungleiche ökonomische Entwicklung dieser Bourgeoisien verursacht. Die Frage der national getönten Bewegungen der mazedonischen Türken, Deutschen, Ungarn, Bunjevci und Rumänen wurde angesprochen. Die Mazedonier wurden nicht als Nation oder Stamm bezeichnet, und der Begriff „Stamm“ wurde für Serben, Slowenen und Kroaten verwendet, obwohl es auch hier ein Dilemma bei der Verwendung dieses Begriffs gab. Der Begriff „Nation“ wurde für nichtslawische Völker wie Deutsche, Ungarn usw. und der Begriff „Bevölkerung“ nur für Mazedonier verwendet. Im Rahmen der Konferenz wurde beschlossen, dass es notwendig ist, eine Debatte über die nationale Frage zu eröffnen und dass die Genossen, die an dieser Frage interessiert sind, sie in der Parteipresse diskutieren sollen. Die Debatte wurde im Rahmen der Unabhängigen Arbeiterpartei Jugoslawiens (Nezavisna radnička partija Jugoslavije, NRPJ) geführt, der legalen Partei, über die die KPJ bis zum Verbot der NRPJ im Jahr 1924 tätig war. Im selben Jahr rief die Zeitschrift Borba (1924 verboten, ebenso wie die Zeitschrift Radnik) zu einer Debatte über die nationale Frage auf.
Das Buch Die nationale Frage im Lichte des Marxismus von Sima Marković stellt einen besonderen Beitrag zu dieser Debatte dar. Es war die erste umfassende theoretische Arbeit über die nationale Frage nach der Vereinigung. Marković vertrat die Ansicht, dass der politische Diskurs bis 1920 von sozialen und danach von nationalen Themen dominiert wurde, was dazu neigt, „die soziale Struktur des politischen Lebens zu verschleiern und den Klassenkampf zu verwischen…“. Die erste Periode ist gekennzeichnet durch ein Klassenbündnis der Bourgeoisie mit dem Ziel, ihre Macht zu stabilisieren, und in dieser Periode hatten weder die slowenische noch die kroatische Bourgeoisie ein Interesse daran, ihre nationalen Themen zu betonen. In der zweiten Periode wurde die bourgeoise Herrschaft konsolidiert und die slowenische und kroatische Bourgeoisie schlossen sich zusammen, während die Hegemonie der serbischen Bourgeoisie stärker wurde. Marković akzeptierte die These der Komintern über die Hegemonie der serbischen Bourgeoisie, betonte aber, dass es sich nicht um eine politische, sondern um eine ökonomische Hegemonie handele. Er lehnte die Idee des nationalen Jugoslawismus ab und ersetzte sie durch das Konzept des jugoslawischen Staates als einer multinationalen Gemeinschaft. Marković zufolge würden die republikanische demokratische Ordnung und der nationale Frieden Raum für den Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter schaffen. Er vertrat die Auffassung, dass Föderation und Konföderation unter den jugoslawischen Bedingungen nur eine Parole des separatistischen bourgeoisen Nationalismus sein können, gegen den die Arbeiterklasse ebenso kämpfen muss wie gegen den serbischen zentralistischen Imperialismus. Als Lösung zwischen Zentralismus und Föderalismus schlug er kulturelle und politische Autonomie für die Provinzen, für alle Nationen, Teile von Nationen und nationale Minderheiten vor, die erklärt haben, dass sie in einem gemeinsamen Staat sein wollen. Eine solche Lösung würde den Slowenen und Kroaten eine Garantie gegen die serbische Hegemonie bieten. Marković betrachtete das Selbstbestimmungsrecht der Völker bis hin zur Sezession nicht als verbindliche Angelegenheit, sondern als eine sinnvolle Frage, die durch die Verfassung geregelt werden sollte. Dennoch glaubte er, dass sich die Mehrheit der Nationen für den jugoslawischen Staatsrahmen entscheiden würde.12
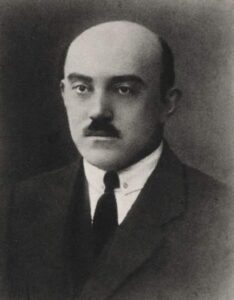
Sima Marković
Während der Debatte kristallisierten sich drei Positionen heraus. Die erste, die in der extremen Minderheit war, leugnete die Existenz der nationalen Frage im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Die zweite, die versuchte, die frühere Politik der Partei zu rechtfertigen, behauptete, dass die nationale Frage erst nach 1920 aufkam. Die dritte Position lautete, dass die nationale Frage seit Beginn der Gründung des Königreichs bestanden habe und dass die Idee, sie zu leugnen, zutiefst irrig sei.
Auch die Idee des Föderalismus wurde diskutiert, wobei August Cesarec13 den größten Beitrag leistete. Er betrachtete die Föderation nicht als ein Prinzip, sondern als eine Etappe, die als Übergangsform auch nach der proletarischen Revolution notwendig sein wird. Seiner Meinung nach kann das Ziel, eine Föderation zu erreichen, nicht nur deshalb als bourgeois betrachtet werden, weil ihr Träger die Bourgeoisie ist, was er mit dem Gedanken erklärt, dass es nationale Bewegungen unterdrückter Nationen gibt, die nach der Vollendung ihrer nationalen Revolution streben. Selbst wenn dies zu zusätzlichen nationalen Spannungen führe, könne die Föderation deren Lösung erleichtern, indem sie die Menschen sensibilisiere, nationalistische Wahnvorstellungen aufzugeben und Beziehungen zu schaffen, die für den Klassenkampf bereit seien, so Cesarec. So deutete er an, dass die Interessen der Bourgeoisie, nationale Revolutionen zu vollenden, mit den Interessen der Menschen übereinstimmen, die dieser Nation zugerechnet werden. Gleichzeitig wird der Nationalismus als eine Obsession betrachtet, die die Menschen aufgeben werden, sobald sie in einen ökonomischen und institutionellen Rahmen gebracht werden, der nationalistische Gefühle und Konflikte tatsächlich fördert.
![]()
August Cesarec
Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale (EKKI) verweist in seinem Bericht auf dem III. erweiterten Plenum im Juni 1923 auf den großen Erfolg der HSS bei den Wahlen zur Nationalen Vollversammlung. Sie schrieben, dass die HSS das revolutionäre Gefühl des bäuerlichen Proletariats hervorragend ausnutzt und in ihrer Agitation eine revolutionäre, antimonarchistische Rhetorik verwendet14. Die nationalen Gefühle der arbeitenden Massen werden ihrer Meinung nach auch von der slowenischen und kroatischen Bourgeoisie ausgenutzt. Im Gegensatz zu ihnen nimmt die KPJ keine „richtige Position“ zur nationalen Frage ein, weshalb sie auch keine entsprechenden Parolen formuliert und letztlich keine Verbindung zu den Bauernmassen und dem Industrieproletariat herstellt15. Darüber hinaus wurde auf dem Plenum selbst festgestellt, dass es unter einigen kommunistischen Parteien einen „Nihilismus gegenüber der nationalen Frage“ gibt, und auch die KPJ wurde unter diesen Parteien genannt. Sinowjew hob Sima Marković als den einzigen aus der Führung der KPJ hervor, der die nationale Frage richtig verstanden habe, und er selbst glaubte, dass die nationale Frage einer der wichtigsten Hebel für den Sturz des Regimes im Reich der Serben, Kroaten und Slowenen sei16. Das EKKI kam zu dem Schluss, dass die kommunistischen Parteien ihre Haltung gegenüber dem „reinen Klassenkampf“ überdenken und ihren Kampf als den Kampf der gesamten Nation für den Sozialismus verstehen müssen. Die KPJ muss die Front der Verbündeten unter der Bauernschaft und der petite Bourgeoisie erweitern.
Nach dem III. Plenum des EKKI beginnt die KPJ, die Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker bis zur Sezession zu vertreten und die Idee der Teilung Jugoslawiens abzulehnen, es sei denn, es ist im Interesse des Fortschritts und des Klassenkampfes des Proletariats, d.h. es ist nicht opportun. Diese Entscheidung lag jedoch bei der NRPJ (KPJ). Von diesem Moment an begann die KPJ, an der Zusammenarbeit mit den Bauernparteien zu arbeiten und über Serben, Slowenen und Kroaten als Nationen zu sprechen. Dementsprechend wurde die Position zur Vereinigung im Jahr 1918 revidiert – man glaubte nun, dass die Vereinigung der drei jugoslawischen Nationen zum ersten Mal vollzogen wurde. Diese Nationen sind zwar ethnisch verwandt, aber dennoch unterschiedlich.
Auf der III. Nationalen Konferenz im Januar 1924 tauchte der Gedanke auf, dass die Erhaltung der Einheit des jugoslawischen Staates die Richtung des historischen Fortschritts und das Interesse des Klassenkampfes des Proletariats sei. Neben der Frage der politischen Stellung der kroatischen und slowenischen Nation befasst sich die KPJ auch mit der Frage der Autonomie Montenegros und der Gewalt, Kolonisierung und Assimilierung Mazedoniens, sowie mit den Bewegungen für die Autonomie Bosniens und der Vojvodina. Zum ersten Mal wird die Existenz der mazedonischen und montenegrinischen Nation anerkannt. Für den künftigen Staat wählten sie den Namen Föderative Arbeiter- und Bauernrepublik Jugoslawien, und für die derzeitige Monarchie forderten sie die Abschaffung der vidowdischen Verfassung und die Annahme einer republikanisch-föderalistischen Verfassung, die mehr Gleichheit für alle Nationen ermöglichen sollte. Es wird der Zusammenhang zwischen der nationalen und der bäuerlichen Frage diskutiert und die Schlussfolgerung gezogen, dass die proletarische Revolution unter den Bedingungen der sozialen und nationalen Struktur des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen unmöglich ist, ohne den Kampf der Arbeiterklasse mit dem Kampf der Bauernmassen zu verbinden. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, Unterstützung für die Eroberung der Macht zu gewinnen, muss sie Teil des Klassenkampfes sein.
Als Ergebnis der Konferenz wurde die Resolution zur nationalen Frage verabschiedet. Sie kamen zu dem Schluss, dass es im Interesse des „historischen Fortschritts und des Befreiungskampfes des arbeitenden Volkes ist, dass 1) die Hegemonie der serbischen Bourgeoisie und ihrer militaristischen Clique, die eine der Haupthochburgen der Konterrevolution auf dem Balkan ist, durch die Verwirklichung des vollen Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung beseitigt wird, 2) dass die Arbeiterklasse den Kampf der Bauernmassen und der unterdrückten Nationen gegen den Kapitalismus unterstützt, 3) dass durch die Vereinigung der Werktätigen verschiedener Nationen in einem gemeinsamen Kampf gegen den Kapitalismus die Voraussetzungen für die Schaffung einer föderativen Arbeiter- und Bauernrepublik in Jugoslawien, auf dem Balkan und im Donauraum geschaffen werden.“ Darüber hinaus wurde die Resolution zur antimilitaristischen Propaganda verabschiedet, die sich für den Schutz der Nationalitäten in der Armee aussprach, d.h. für die aktive Unterstützung der Bestrebungen der einzelnen Nationen nach Gleichstellung mit der serbischen Armee und für das Recht eines jeden, auf dem Territorium der eigenen Nation in der Armee zu dienen. Nach Ansicht der KPJ ist die Existenz nationaler Armeen daher ein antimilitaristisches Ziel.
Auf ihrem 5. Kongress (Juni-Juli 1924) konkretisiert die Komintern die Idee der Zerschlagung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, die sie bereits 1920 vorgeschlagen hatte. Sie ist der Meinung, dass die allgemeine Losung der KPJ über das Selbstbestimmungsrecht der Völker in der Form ausgedrückt werden muss, dass Kroatien, Slowenien und Mazedonien aus der Zusammensetzung des Königreichs herausgelöst und unabhängige Republiken geschaffen werden. Die KPJ akzeptierte diese Entscheidung nicht. Die Komintern fand eine Rechtfertigung für diese Idee in der Rede von Filip Filipović, einem Delegierten der Kommunistischen Föderation des Balkans, der das Königreich der Serben, der Kroaten und der Slovenen als eine Einheit als eine Einheit interpretierte, als Agenten der konterrevolutionären Politik des französischen Imperialismus und erklärte, dass die KPJ die Idee der Selbstbestimmung bis zur Abspaltung und vollständigen Unabhängigkeit Mazedoniens, Thrakiens, Dobrudschas, Sloweniens und Kroatiens vertrete, die bereits 1923 auf der Konferenz deder Kommunistischen Föderation des Balkans angenommen wurde.
Im April 1925 verabschiedete das erweiterte Plenum des Exekutivkomitees der Komintern eine Resolution zur jugoslawischen Frage. In der Resolution hieß es: „Keine Furcht, nationale Leidenschaften zu entfachen, darf die Partei daran hindern, in dieser wichtigsten Frage (der nationalen Frage) mit aller Kraft an die Massen zu appellieren. Wenn die Partei Angst vor den aufflammenden Elementen der nationalen Bewegungen hat, wird sie niemals der siegreiche Anführer der großen revolutionären Volksbewegung werden, die in Jugoslawien aus einer revolutionären Verbindung von Arbeitern, Bauern und nationalen Befreiungsbewegungen hervorgehen wird“.17
1925 geriet Sima Marković – der bereits auf dem III. Plenum der Komintern 1921 mit dem Exekutivkomitee der Komintern und Sinowjew wegen ihrer Position zur KPJ aneinandergeraten war, weil er der Meinung war, dass das Exekutivkomitee nicht ausreichend über die Situation im Königreich informiert war – erneut mit Stalin und Dimitri Manuilski wegen der nationalen Frage aneinander. Sie hielten Markovićs Position zur nationalen Frage für sozialdemokratisch und anti-leninistisch, und Stalin warf ihm vor, die nationale Frage auf eine Verfassungsfrage zu reduzieren.18
Auf dem III. Kongress (1926) ignorierte die KPJ weiterhin die Forderung der Komintern nach der Auflösung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen. Nach Ansicht der KPJ ist das Königreich ein multinationaler Staat, in dem die serbische Nation als die herrschende erscheint. Die KPJ hatte begonnen, die Frage der nationalen Ausbeutung auf alle gesellschaftlichen Gruppen innerhalb einer Nation auszuweiten, weshalb die Haltung gegenüber zivilen Oppositionsparteien aus unterdrückten Nationen aufgewertet wurde. Damit erweitert sich auch das Spektrum der möglichen Verbündeten.
1927 bricht der Konflikt um die nationale Frage erneut aus, Sima Marković wurde rausgeworfen und an seiner Stelle trat Đuro Cvijić19, ein Vertreter der gemäßigten „Linken“ auf. Mit dem Ziel, die KPJ zu bolschewisieren, gründete die Komintern das Parallelzentrum der KPJ in Moskau. Die ideologische Grundlage des Parallelzentrums bildete das Frühwerk von Đuro Cvijić, der in den 1920er Jahren dem Parlamentarismus und den reformistischen Gewerkschaften/Syndikate skeptisch gegenüberstand und das föderalistische Modell Jugoslawiens unterstützte, in dem die einzelnen Nationen das Recht auf Selbstbestimmung bis zur Abspaltung haben.
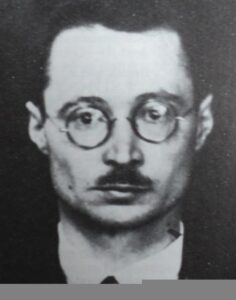
Đuro Cvijić
Die KPJ akzeptierte die Idee der Komintern über die Notwendigkeit der Aufteilung des Reiches auf dem IV. Kongress 1928 in Dresden. In der Zwischenzeit wurde nämlich der Anführer der HSS, Stjepan Radić, in der Nationalen Vollversammlung erschossen, und auf dem VI. Kominternkongress wurde die Möglichkeit eines imperialistischen Weltkrieges diskutiert. In der KPJ glaubte man, dass die Ermordung von Radić Auswirkungen auf die Radikalisierung der HSS in Richtung der Zerstörung des Königreichs haben würde, und man kam zu dem Schluss, dass ihre neue Aufgabe darin bestand, die kroatische Bauernbewegung und die Bewegungen anderer unterdrückter Nationen mit dem Klassenkampf des Proletariats zu koordinieren. Der integrierte revolutionäre Kampf des Proletariats und der Bauernschaft auf dem Territorium des Königreichs wäre jedoch die zukünftige bourgeois-demokratische Revolution, die nur den Boden für die sozialistische Revolution bereiten würde. Die nationale Frage ist also nicht Teil des Klassenkampfes, sondern muss durch die bourgeoise Revolution gelöst werden. Neben der slowenischen, mazedonischen und kroatischen Frage wurden auf der Konferenz auch die montenegrinische, albanische und ungarische nationale Frage diskutiert.
Im Januar 1929 wurde die Diktatur vom 6. Januar (šestojanuarska diktuatura) eingeführt. König Aleksandar I. Karađorđević löste die Nationale Vollversammlung auf, verbot die Arbeit aller Parteien, Gewerkschaften/Syndikate und politischen Versammlungen, führte die Zensur ein, proklamierte die Ideologie des „integralen Jugoslawiens“ und änderte den Namen des Landes in Königreich Jugoslawien. Als Reaktion auf die Einführung der Diktatur gab die KPJ-Führung eine Direktive für einen bewaffneten Aufstand heraus.
Nach dem Dresdner Kongress begann die KPJ, verschiedene militante nationalistische Organisationen, die gegen die serbische Herrschaft kämpften, zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, darunter das Komitee zur Verteidigung des Kosovo (Komitet narodne odbrane Kosova), die Interne Mazedonische Revolutionäre Organisation (Unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija, VMRO) und die Ustascha. Während der Diktatur, Anfang der 1930er Jahre, arbeitete die KPJ oft direkt mit kroatischen und mazedonischen Nationalisten zusammen. So organisierten die Ustascha im September 1932 den so genannten „Lika-Aufstand“ („lički ustanak“, auch bekannt als Velebit-Aufstand), d. h. einen Angriff auf eine Polizeistation, an dem zehn Personen beteiligt waren. Aus diesem Anlass schrieb die KPJ eine Proklamation im Parteiorgan Proleter:
„… aus der Tatsache, dass die Ustascha-Bewegung in Lika und Norddalmatien – den ärmsten Regionen Jugoslawiens – ihren Anfang nahm, lässt sich schließen, dass soziale und ökonomische Faktoren eine große Rolle in dieser Bewegung spielen. Aber auch das nationale Element ist von großer Bedeutung, da die Bewegung in den kroatischen Teilen Likas und Norddalmatiens am stärksten entwickelt ist. Die Kommunistische Partei begrüßt die Ustascha-Bewegung der Bauern von Lika und Dalmatien und steht voll und ganz auf ihrer Seite. Es ist die Pflicht aller kommunistischen Organisationen und jedes Kommunisten, diese Bewegung zu unterstützen, zu organisieren und zu führen. …“
Es ist wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass die Ustascha-“Bewegung“ zu diesem Zeitpunkt nur aus einigen hundert Personen bestand. Es handelte sich um eine terroristische Organisation, die von Mussolinis faschistischem Italien unterstützt und finanziert wurde, das auch als Basis für diese Organisation diente. Darüber hinaus wurde der Lika-Aufstand nicht von der lokalen Bevölkerung initiiert, sondern von den Ustascha ohne jegliche Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung. Das beweist die Tatsache, dass die Ustascha die für den „Aufstand“ benötigten Waffen aus Italien über Zadar (damals unter italienischer Kontrolle) schmuggelten. Als die jugoslawischen Behörden die Repression gegen die örtliche Bevölkerung durchführten, eine Ausgangssperre verhängten und viele unschuldige Bauern verhafteten, entdeckten sie, dass die örtliche Bauernschaft voll mit Waffen war, da viele aufgrund ihrer Armut in den Waffenschmuggel verwickelt waren. Wären die Ustascha in irgendeiner Weise mit der lokalen Bevölkerung verbunden gewesen, wäre der Waffenschmuggel aus Italien nicht notwendig gewesen. Es stellt sich die Frage, inwieweit die KPJ über die Umstände des Lika-Aufstandes und das Wesen der Ustascha-“Bewegung“ falsch informiert war und inwieweit es sich um ein autoritäres Missverständnis dessen handelt, was soziale Bewegungen sind.
Drei Monate später, in der Proleter-Ausgabe vom Februar/März 1933, wurden die zuvor beschriebenen Positionen des Zentralkomitees der KPJ in Bezug auf die Ustascha-Bewegung bestätigt und die Mitglieder der KPJ zur Unterstützung der „nationalrevolutionären Bewegung“ aufgerufen. Der auf den versuchten Aufstand folgende Polizeiterror brachte die KPJ und die Ustascha, insbesondere die Gefangenen, noch näher zusammen. Im Februar 1933 veröffentlichte Proleter einen großen Artikel mit dem Titel „Für die Hilfe und Befreiung der politischen und militärischen Gefangenen“, in dem die Freilassung aller politischen Gefangenen aus den „großserbischen Gefängnissen“, darunter zahlreiche Ustascha, befürwortet wurde. Anfang 1934 wurde die „Gemeinschaft der politischen Gefangenen: Kroatische Nationalrevolutionäre, mazedonische Nationalrevolutionäre und Kommunisten“ im Gefängnis von Lepoglava mit dem Ziel eines gemeinsamen Kampfes gegen die Diktatur gegründet. Die KPJ war sich des faschistischen Charakters der Ustascha-“Bewegung“ von Anfang an bewusst und verurteilte offiziell die „faschistischen Elemente“, ihre Ideologie und Methoden. Es ist schwer zu sagen, wie es möglich ist, eine Organisation zu unterstützen und gleichzeitig ihre Ideologie und Methoden zu verurteilen. Die leninistische Ideologie der Unterstützung so genannter nationaler Befreiungsbewegungen ermöglichte es der KPJ, eine faschistische Organisation zu unterstützen, in dem Glauben, dass sie damit die armen Bauern von Lika und Dalmatien unterstützte, die gegen Polizeigewalt, Armut und „nationale“ Unterdrückung kämpften.
Während der IV. Nationalen Konferenz der KPJ im Jahr 1934 wurde beschlossen, dass zur Stärkung des Interesses der kroatischen und slowenischen Massen an der Partei und zur Bekämpfung des bourgeoisen Nationalismus innerhalb der KPJ die KP Kroatiens und die KP Sloweniens und in naher Zukunft die KP Mazedoniens gegründet werden sollten, um die Mazedonier zu mobilisieren, da die beiden Nachbarstaaten die Existenz des mazedonischen Volkes weder politisch noch historisch anerkannten.20 Die Idee einer Föderation der Arbeiter- und der Bauernrepubliken auf dem Balkan wurde nicht mehr aufrechterhalten. Das Ziel, Jugoslawien aufzulösen, war viel weniger ausgeprägt und wurde nach der Konferenz ganz aufgegeben. Die KPJ strebte nach größtmöglicher Unabhängigkeit von der Komintern. Die dominierende Linie der Partei wurde der Kampf für nationale und soziale Gleichheit, die Umwandlung Jugoslawiens in einen demokratischen Staat mit gleichberechtigten Nationen und Nationalitäten und die Schaffung einer breiten antifaschistischen Front demokratischer Kräfte.
Bald darauf richten sich die Propagandatexte nicht mehr an die Arbeiterklasse, sondern an die Völker. Ein Text aus dem Jahr 1937 heißt zum Beispiel „Arbeiter! Arbeitendes Volk! Slowenen!“, und die Proklamation der Kommunistischen Partei Kroatiens aus demselben Jahr beginnt mit „Kroatisches Volk!“. In beiden Texten sprechen sie viele soziale Schichten an – Bauern, kleine Händler und Handwerker, ehrliche Intelligenzija, Staatsbürger. In diesen und anderen Texten erklären sie, wie der Kampf der Arbeiter und der Kampf für die nationale Befreiung zusammenhängen, wie die slowenische und kroatische Industrie und die Arbeiter vor fremden Kapitalisten und vor Belgrad geschützt werden sollten. Ihre Interessen sollten vor der Belgrader Bank und der Zentralisierung durch Steuern, finanzielle Mittel und günstige Kredite geschützt werden.
Im selben Jahr 1937 veröffentlichte Stjepan Cvijić, der Bruder von Đuro Cvijić, in Chicago ein Pamphlet über die Volksfront unter dem Titel The Working Class and the Croatian National Movement. Sie wurde in Jugoslawien bald verboten, aber illegal verbreitet. Die in der Broschüre zum Ausdruck gebrachte Haltung von Cvijić entsprach der Haltung der meisten führenden Parteimitglieder zu dieser Zeit. Er unterstützte uneingeschränkt die Linie der Volksfront und forderte die Einsetzung einer neuen verfassungsgebenden Vollversammlung in Jugoslawien, die eine Lösung herbeiführen sollte, die die Mehrheit der Serben, Slowenen und Kroaten zufriedenstellen würde. Darüber hinaus forderte er das nationale Selbstbestimmungsrecht der Montenegriner und Mazedonier. Für ihn ist der Sozialismus das Endziel des Kampfes für ein demokratisches Jugoslawien, das unter anderem den nationalistischen Spannungen im Land ein Ende setzen wird. Er betonte, dass alle „Nationen“ ihre eigenen verfassungsmäßigen Vollversammlungen haben sollten, in denen sie frei über den Beitritt zu Jugoslawien entscheiden könnten. Auch die Völker von Bosnien und Herzegowina, Kosovo und der Vojvodina sollten Vollversammlungen haben. Diese Idee kommt dem Modell von Josip Broz Tito nahe, das während des Krieges eine neue verfassungsgebende Vollversammlung (AVNOJ) sowie Provinzvollversammlungen vorsah und die Grundlage für die Republiken und Provinzen im sozialistischen Jugoslawien bildete.
Während der Periode der Volksfront (1935-1939) erhielt die Politik der KPJ durch die Mobilisierung gegen den Faschismus einige neue Elemente. Obwohl die „großserbische Hegemonie“ der Hauptfeind blieb, griff die KPJ die Versuche der imperialistischen Mächte an, die Nationalismen der Peripherie auszunutzen. In dieser Zeit tauchten vor allem unter dem Einfluss von Tito vorübergehend Elemente des jugoslawischen Patriotismus in der Rhetorik der KPJ auf.
Die Debatten über die nationale Frage verschärften sich im März 1938 nach der Annexion Österreichs durch die Nationalsozialisten und der Ankunft deutscher Truppen an der jugoslawischen Grenze. Mit dem Ziel, den Staat zu verteidigen, gab die KPJ-Führung eine Proklamation heraus, in der sie zur Zusammenarbeit nicht nur mit der Vereinigten Opposition21, sondern auch mit den jugoslawischen monarchistischen Zentralisten und Nationalisten, die gegen die Regierung waren, aufrief. Die Proklamation rief scharfe Kritik der KP Kroatiens (KPH) hervor, deren Führung behauptete, dass eine solche Zusammenarbeit für sie nicht in Frage käme. Einige kroatische Kommunisten machten die Lösung der kroatischen nationalen Frage zur Vorbedingung für ihre Unterstützung eines vereinigten Jugoslawiens. Tito kritisierte eine solche Haltung scharf als sektiererisch. Die kroatische Nationalfrage eskalierte im Dezember desselben Jahres während der Wahlen erneut. Da Kroatien bei den Wahlen 1920 eine der kommunistischen Hochburgen war, hoffte die KPJ, diesen Erfolg wiederholen zu können. Unstimmigkeiten zwischen der Führung der KPJ und der KPH machten dies jedoch unmöglich. Die KPH sahen in der massenhaften Unterstützung für die HSS ein Zeichen dafür, dass in der öffentlichen Meinung nur diese Partei die wahren Vertreter der kroatischen nationalen Interessen war, und glaubten daher, dass eine Konfrontation mit der HSS die Unterstützung der KPJ bei den „Kroaten“ weiter verringern würde. Die KPH betonte immer wieder, dass Kroatien ein Sonderfall in Jugoslawien sei und dass es für die Volksfront das einzig Richtige sei, sich mit der Partei zu verbünden, die die Interessen der „Kroaten“ vertrete und die sie als unterdrückt in Jugoslawien betrachte. Während die KPH eine Taktik der Unterwanderung der HSS und anderer Organisationen der Vereinigten Opposition verfolgte, warfen Tito und die Provisorische Leitung22 ihr vor, sich gegenüber den kroatischen Nationalisten herablassend zu verhalten, obwohl die KPJ bei anderen Gelegenheiten dieselbe Taktik anwendete. Die durch den Fall KPH23 ausgelösten Konflikte um die nationale Frage setzten sich in der Partei auch nach 1940 fort.
![]()
Milan Gorkić
Die nationalistische und opportunistische Politik der KPJ wurde während des Krieges besonders deutlich. Die Proklamation des Zentralkomitees der KPJ vom 12. Juli 1941 beginnt mit „Volk von Jugoslawien!“ und wendet sich in getrennten Absätzen an das „kroatische Volk“ und die „Serben“. Er ruft zum Aufstand gegen die Faschisten, die deutschen Besatzer und die Ustascha auf und betont, dass es notwendig ist, das „nationale Erbe“ und die „glorreichen Traditionen“ zu bewahren. Erwähnt werden auch die „Söhne der kroatischen Nation“, der „strahlende kroatische Name“ und die „illustren Vorfahren“. Während der gesamten Kriegszeit betonte die KPJ das Prinzip der nationalen Emanzipation weit mehr als die Idee der sozialen Gerechtigkeit und der sozialistischen Revolution. Abgesehen von politischem Opportunismus war dies auch ein Ausdruck der Loyalität gegenüber den Hauptverbündeten, dem Vereinigten Königreich und der so genannten Sowjetunion, die empfahlen, mitten im Krieg zur Befreiung des Landes von den Besatzern keine politischen Fragen (und schon gar nicht in Form eines Bürgerkriegs) zu eröffnen.
Neben der nationalistischen Politik und Rhetorik spiegelte sich der Opportunismus auch in politischen Bündnissen mit bourgeoisen Parteien wider. Zur Volksfront in Jugoslawien gehörten sowohl reformistische sozialistische Parteien als auch bourgeoise Parteien, die die Führung der KPJ akzeptierten. Für Josip Broz Tito bedeutete die Volksfront im Wesentlichen, legale Parteien zu infiltrieren und in ihnen Zellen zu schaffen, die dem Zentralkomitee der KPJ entsprachen. Mit dieser Taktik gelang es der KPJ, sich in allen großen Parteien zu etablieren und ihre Mitgliederzahl von 1.500 im Jahr 1937 auf 8.000 im Jahr 1942 zu erhöhen.

Erste Sitzung der AVNOJ, Bihać 1942
Es dauerte lange, bis sich die Spitze der Partisanenbewegung offen zu ihrer kommunistischen politischen Ausrichtung bekannte. Stattdessen betonten sie den patriotischen Charakter ihres Kampfes und sprachen von Brüderlichkeit und Einheit, ein Ideal, das leicht mit liberal-demokratischen Werten identifiziert werden konnte. Selbst als Ende 1943 klarer wurde, dass sich das neue Jugoslawien politisch vom alten unterscheiden würde, stand der Sozialismus immer noch nicht im Programm der neuen Regierung, der Kampf gegen den Kapitalismus wurde mit keinem Wort erwähnt, und die Monarchie wurde nicht verboten. Die Partisanenrhetorik verband geschickt bestimmte nationalistisch-patriotische Elemente mit jugoslawischen Elementen, die für viele attraktiv waren. Außerdem versprach sie radikale Veränderungen, ohne jedoch zu sagen, um welche Art von Veränderungen es sich dabei handelte. Die Partisanenbewegung und die Idee eines neuen Jugoslawiens sprachen viele verschiedene Strömungen und Bevölkerungsgruppen an und boten allen etwas, aber niemandem etwas Bestimmtes.
In der Geschichtsschreibung und in theoretischen Texten aus der Zeit des sozialistischen Jugoslawien heißt es, dass „das erste historische Verdienst der Kommunistischen Partei Jugoslawiens gerade darin besteht, dass sie die Verbindung zwischen Klasse und Nation als einzige Möglichkeit des Kampfes für den Sozialismus in Jugoslawien erkannt hat und dass sie es verstand, einen revolutionären Kampf auf der Plattform des demokratischen Patriotismus erfolgreich zu organisieren, der die tägliche Durchdringung von Klasse und Nation, nationaler Freiheit und Klassenemanzipation, nationaler Affirmation und sozialem Fortschritt immanent beinhaltet „24. Die historischen Ereignisse werden aus einer Perspektive bewertet, die bereits weiß, welche Strömungen innerhalb der KPJ dominieren werden und wie die Ergebnisse des Krieges aussehen werden. Nur Siege – entweder als Dominanz einer Strömung innerhalb der Partei oder als Sieg im Krieg und die Eroberung der Macht – diktierten, welche Position als richtig und „links“ und welche als Wahnvorstellungen und „rechts“ bezeichnet werden würde. Dabei handelte es sich nicht nur um die Ideologisierung der Literatur aus der sozialistischen Zeit, denn auch in der sehr jungen Literatur aus der postsozialistischen Zeit werden Kategorien wie z.B. „links“ und „rechts“ in der Partei nicht in Frage gestellt. In der Zwischenkriegszeit hatten viele Kommunisten der KPJ originelle und ausgefeilte Ideen zur nationalen Frage und ihr Herz am rechten Fleck. Dennoch basierte die Politik der Partei selbst in vielen Fragen, einschließlich der nationalen, nicht auf der Analyse der kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse und der Macht, die die Arbeiterklasse hatte, um diese Verhältnisse potenziell zu beenden, sondern ausschließlich auf der Analyse der politischen Macht. Sie wurde auch nicht von dem Ziel geleitet, die kommunistische Idee unter einer möglichst breiten Bevölkerung zu verbreiten, denn sonst wären diese Ideen nicht absichtlich versteckt worden. Das Ziel war ausschließlich die Stärkung der Macht der Partei, unabhängig von der Methode. Wenn Marxisten/Bolschewiki über den Unterschied zwischen Reform und Revolution sprechen, meinen sie damit nur unterschiedliche Methoden der Machtergreifung. Das Ziel selbst, die Eroberung der Macht, wird nicht in Frage gestellt. Wenn dies das Ziel ist, ist es klar, dass die Taktik je nach den Umständen ständig geändert werden muss. In der Zwischenkriegszeit hat die KPJ in der nationalen Frage fast alle Standpunkte ausprobiert, die im damaligen jugoslawischen Kontext möglich waren. Um nur einige Momente in groben Zügen zusammenzufassen: von der anfänglichen Akzeptanz des jugoslawischen nationalen Unitarismus (1919-1921) und dem Eintreten für Jugoslawien als Sowjetrepublik, die Teil der Föderation der Balkan-Donau-Länder sein sollte (1919-1934), über die Anerkennung, dass „Serben“, „Slowenen“ und „Kroaten“ drei verschiedene Nationen darstellen (Anfang der zwanziger Jahre), die Befürwortung der Föderativen Arbeiter- und Bauernrepublik Jugoslawien (1924), die offene Unterstützung nationalistischer Bewegungen (1926-1935), eine vorübergehende Rückkehr zum jugoslawischen Patriotismus während der Zeit der Volksfront, aber mit einer parallelen Verschärfung der kroatischen Frage und der Unterwanderung der bourgeoisen Parteien (1935-1939), bis hin zur Intensivierung der nationalistischen Rhetorik während des Krieges. Alles, was irgendwann dazu beitragen konnte, die Macht der KPJ zu stärken, wurde zur „richtigen marxistischen Position“ und alles, was dem widersprach, zur „Illusion“.
Nationalismus und primitive Akkumulation
Die Periode des sogenannten revolutionären Etatismus 1945-1963.
Eine Nation ist eine spezifische nationale Gemeinschaft, die auf der Grundlage der gesellschaftlichen Arbeitsteilung in der Epoche des Kapitalismus entstanden ist, d.h. auf dem Entwicklungsniveau der Produktivkräfte, als die Quantität der überschüssigen gesellschaftlichen Arbeit begann, sich in eine neue Qualität der sozialen Integration auf einem höheren Niveau zu verwandeln, d.h. auf einem kompakten nationalen Territorium, im Rahmen einer gemeinsamen Sprache und einer engen ethnischen und kulturellen Verwandtschaft im Allgemeinen.
Edvard Kardelj, Entwicklung der slowenischen Nationalfrage, 1939.
Während des Krieges wurden im Rahmen der fünf „Nationen“ (Montenegro, Mazedonien, Serbien, Kroatien und Slowenien) und Bosnien und Herzegowina25 die wichtigsten Hauptquartiere, regionalen Räte und gemeinsamen Gremien auf Föderationsebene gebildet – das Oberste Hauptquartier, der Antifaschistische Rat der Volksbefreiung Jugoslawiens (AVNOJ) und andere. Auf der zweiten Sitzung des AVNOJ im Jahr 1943 wurde der Verfassungsbeschluss gefasst, Jugoslawien auf einem föderalen Prinzip aufzubauen, „das den Serben, Kroaten, Slowenen, Mazedoniern und Montenegrinern, d. h. den Völkern Serbiens, Kroatiens, Sloweniens, Mazedoniens, Montenegros und Bosniens und Herzegowinas volle Gleichberechtigung garantiert“. Nach dieser Sitzung konstituierten sich die nationalen antifaschistischen Räte aller Nationen Jugoslawiens als oberste Instanzen in den föderativen Einheiten und bestätigten die Beschlüsse des AVNOJ, die die verfassungsrechtlichen und rechtlichen Grundlagen für „Jugoslawien als gleichberechtigte Gemeinschaft der jugoslawischen Nationen und Nationalitäten“ schufen.
![]()
Zweite Sitzung des AVNOJ, Jajce, 1943
Die erste Verfassung der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien (FNRJ)26 , die 1946 verabschiedet wurde, bestätigte die Beschlüsse der zweiten Sitzung des AVNOJ. Jede Nation konstituierte sich als eigenständige politische Einheit, die in einer Volksrepublik zum Ausdruck kam, mit Ausnahme von Bosnien und Herzegowina (siehe Fußnote 21). Obwohl es in dieser Zeit nicht viele Diskussionen über die nationale Frage gab, waren die Identitäten der politischen und staatlichen Institutionen Jugoslawiens, wie sie von der politischen Elite konzipiert wurden, ethnisch und national begründet, denn Jugoslawien war ein Land südslawischer Völker und Nationen, und die Nationen konstituierten sich in Republiken. Daher war der Jugoslawismus auch ein nationales Projekt mit dem Ziel, eine bestimmte nationale Identität zu schaffen, auch wenn er mit einer geringeren Tendenz zur kulturellen und sprachlichen Homogenisierung einherging als andere nationale Projekte mit ethnischer Grundlage. In der Nachkriegszeit, als das Land noch in Gefahr war, konnte der Jugoslawismus noch als Grundlage für einen möglichen Widerstand dienen. Und wenn es nicht mehr nötig ist, steht ein System von Republiken mit nationaler Basis bereit, um die Kontinuität der Reproduktion von Staat und Kapital zu gewährleisten.
![]()
Wappen und Flaggen der FNRJ
Um die jugoslawische Nationalpolitik besser zu veranschaulichen, ist es sinnvoll, sie kurz mit derjenigen der so genannten Sowjetunion zu vergleichen. Beginnen wir mit den Gemeinsamkeiten. In beiden Ländern wurde das System des ethno-territorialen Föderalismus angewandt, d.h. „ethnische“ Gruppen wurden territorialisiert und durch eine komplexe Hierarchie von Einheiten in Bezug auf die Ebene der Staatlichkeit und Souveränität institutionalisiert: Sowjetische (UdSSR) und sozialistische Republiken (Jugoslawien), autonome Republiken (UdSSR) und autonome Provinzen (Jugoslawien), autonome Bezirke und Regionen (UdSSR, Jugoslawien) und Gruppen ohne eigenes Territorium (UdSSR und Jugoslawien). In beiden Fällen waren die Republiken grundlegende Partei- und Verwaltungseinheiten sowie territorial definierte Nationalstaaten von Titularnationen oder mehrheitlich ethnischen Gruppen. Ziel der nationalen Politik war es, die Vorherrschaft der dominierenden Nation (Russen und Serben) zu verhindern und gleichzeitig das „Recht“ der dominierenden ethnischen Gruppe in einem bestimmten Gebiet, d. h. des „konstituierenden Volkes“ auf Selbstbestimmung, zu erfüllen. Sowohl in der UdSSR als auch in Jugoslawien war Patriotismus ein akzeptabler Ausdruck der Loyalität gegenüber dem neuen System, und beide Systeme stärkten letztlich die Verbindung von Ethnie, Staat und Territorium und schufen so die Grundlage für die Entstehung neuer Nationen.
Anders als in der UdSSR, wo die Sowjetrepubliken Träger des Selbstbestimmungsrechts waren, wurde in der jugoslawischen Verfassung nicht festgelegt, ob dieses Recht den Republiken oder den „Nationen/Völkern“ zusteht. Die Frage der persönlichen nationalen Identifikation war in der Sowjetunion ein Merkmal, das bei der Geburt zugewiesen wurde, während es in Jugoslawien eine Frage der persönlichen Entscheidung war, die bei der Volkszählung zum Ausdruck gebracht wurde, die den Wechsel der nationalen Identifikation sowie die Wahl der Identität „Jugoslaw“ ermöglichte27. Während es in der UdSSR zu Überschneidungen zwischen sowjetischen und russischen Institutionen kam, weil die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR) den Status eines Restgebiets hatte, nachdem andere nationale und autonome Republiken ihren Teil des gemeinsamen Territoriums eingenommen hatten, wurde der Föderalismus in Jugoslawien auch auf Serbien angewandt, weil die KPJ verhindern wollte, dass Serbien eine dominante Nation nach dem Vorbild der Russen in der UdSSR wurde. Aus demselben Grund wurden zwei autonome Provinzen geschaffen – Kosovo und Metohija (Kosmet) und die Vojvodina28. Schließlich wurde in Jugoslawien eine Republik ohne eindeutige Titularnation geschaffen – Bosnien und Herzegowina, für die es in der UdSSR kein vergleichbares Beispiel gab.

Jugoslawien, 1946 – 1990
Diese Periode, die mit der Verabschiedung der neuen Verfassung im Jahr 1963 endete, wird als Periode des „revolutionären Etatismus“ bezeichnet und war durch die Herausbildung eines zentralistischen Staatssystems, das Staatseigentum an den Produktionsmitteln und die zentralisierte Planung von Produktion und Verteilung gekennzeichnet, so dass der Staat noch immer nicht als Föderation funktionierte. Nach den offiziellen historiographischen Interpretationen dieser Zeit aus den 1970er Jahren gab es zwei Gründe für eine solche Regelung. Der erste Grund war die Verteidigung des neu errichteten sozialistischen Systems gegen konterrevolutionäre Angriffe. Ein weiterer Grund war der Mangel an anderen Modellen für den Aufbau des Sozialismus, abgesehen vom sowjetischen Modell, im schwierigen Kontext komplexer internationaler Beziehungen. Ein solides staatszentralistisches System wurde von der KPJ als einzige Möglichkeit angesehen, den Staat zu retten. Dementsprechend wurde die Idee vom Tod des Staates, die auf dem Dritten Kongress der Volksfront Jugoslawiens 1949 als eines der zentralen Konzepte des jugoslawischen Sozialismus festgelegt wurde, nur auf internen Parteiversammlungen erwähnt und hatte keinen Einfluss auf politische Entscheidungen.
Die Verstaatlichung erfolgte in Jugoslawien nach 1946 in mehreren Etappen und bildete, wie in anderen sozialistischen Ländern, die materielle Grundlage der Macht der professionellen Verwalter. Damit diese Schicht ihre politische Bestimmung erfüllen konnte, die in den Ländern des entwickelten Kapitalismus bereits von der Bourgeoisie erfüllt worden war, musste sie die Industrialisierung und den ökonomischen Fortschritt zu ihrem Hauptziel machen. Da das Territorium Jugoslawiens industriell unterentwickelt und die Mehrheit der Bevölkerung bäuerlich war, bestand die historische Rolle der neuen Nation-Staaten darin, den rechtlichen, institutionellen und ideologischen Rahmen für die weitere Entwicklung des kapitalistischen Warenproduktionssystems zu sichern und zu stärken. Die Bauernschaft musste enteignet und proletarisiert werden, um in das neue ökonomische System einbezogen zu werden. Und damit die Bevölkerung im Einklang mit der neuen Ideologie rechtmäßig als Ressource genutzt werden konnte, musste sie als konstituierendes Volk oder Nation betrachtet werden. Für die Angehörigen einer von äußeren Besatzern befreiten Nation war Arbeit nicht länger eine Last und Ausbeutung, sondern eine nationale Pflicht, die mit Freude erfüllt werden sollte. Bereits 1937 wird in der Proklamation der Kommunistischen Partei Kroatiens29 deutlich, wie die KP die Arbeitskräfte als Ressource ansah: „Allen Verleumdern, die die Kommunistische Partei verleumden, weil sie ihr Land und ihr Volk vernachlässigen, rufen wir Kommunisten zu: Wir Kommunisten lieben unser Vaterland und unser Volk!“, „…es ist notwendig, dass die kroatischen Arbeiter, die in diesen Organisationen organisiert sind, einen gemeinsamen Kampf gegen die gemeinsamen Feinde – kroatische und ausländische Kapitalisten – führen, die das kostbare nationale Kapital – die kroatische Arbeiterschaft – am rücksichtslosesten ausbeuten und zerstören.“ Der Nationalismus als Teil des KP-Diskurses hatte nicht nur die Aufgabe, das Volk während des Krieges gegen die ausländischen Besatzer zu mobilisieren, sondern auch die Aufgabe, die Menschen nach dem Krieg aktiv zum Kampf für den Staat zu ermutigen. Die Aufgabe der nationalen Einheiten und Institutionen bestand nicht in der Pflege von Sprache, Kultur und Bräuchen, sondern in der Entwicklung der Ökonomie, der Umwandlung der Bauernschaft in Arbeiterinnen und Arbeiter, der Armee und der petite bourgeoise Betriebe in kapitalistische Großbetriebe.
In der Nachkriegszeit war die Umwandlung der Bauernschaft in eine Arbeiterklasse noch nicht vollständig abgeschlossen, und es bedurfte der Akkumulation von Primärkapital, um dem System der Warenproduktion neuen Schwung zu verleihen. Wie in anderen Ländern ohne externe Kolonien konnte die Primärakkumulation durch die Enteignung der Bauernschaft erfolgen, vorzugsweise derjenigen Bauern, die noch nicht den Status einer Nation hatten. Der größte Druck auf die Bauernschaft wurde in der Zeit von 1946 bis 1953 ausgeübt und beinhaltete die Zwangsaneignung von landwirtschaftlichen Produkten und eine Kollektivierung nach dem Vorbild der sogenannten Sowjetunion. Die Menge bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die die Bauern an den Staat verkaufen mussten, war oft höher als die durchschnittliche Menge der in dem betreffenden Jahr erzeugten Produkte, was zu mehreren Bauernrevolten führte. Einer dieser Aufstände war der bewaffnete Aufstand der Bauern aus Cazinska Krajina in Bosnien und Kordun in Kroatien, der am 6. Mai 1950 ausbrach. Die überwiegende Mehrheit der Aufständischen aus dem bosnischen Teil war bosniakisch. Viele Menschen hatten ihre Häuser nach dem Krieg noch nicht wieder aufgebaut, sie konnten ihre Familien nicht ernähren, und die Erfüllung der ohnehin unrealistischen Verpflichtungen gegenüber dem Staat wurde in jenem Jahr durch eine große Dürre noch erschwert. Daher unterdrückte der Staat sie brutal mit Polizeigewalt, Beschlagnahmung von Eigentum und Mobilisierung zur Zwangsarbeit in Wäldern, auf Baustellen und in Fabriken. Während des Aufstands steckten die Bauern mehrere lokale Regierungsarchive in Brand, entwaffneten Polizisten, rissen Telegrafenmasten um, beschlagnahmten eine Reihe von Genossenschaftslagern und nahmen mehrere politische Beamte fest. Der Staat schlug den Aufstand rasch nieder, indem er mehrere hundert Soldaten gegen die rebellierende Bauernschaft einsetzte. Mehr als siebenhundert Personen wurden verhaftet, fünfzehn von ihnen wurden bei der Gefangennahme getötet, achtzehn von ihnen wurden zum Tode verurteilt, 275 Personen wurden zu langen Haftstrafen, darunter lebenslänglich, verurteilt, mehrere Verurteilte starben an den Folgen der Überarbeitung in einem Bergwerk in Zenica, und einige begingen Selbstmord. Zwischen 70 und 100 Familien bosnischer Aufständischer wurden in Viehwaggons ohne Wasser und Lebensmittel zwangsweise nach Srbac verbracht. In Srbac bettelten die älteren Exilanten, und die Kinder hüteten das Vieh der wohlhabenderen Einheimischen.
1939 definierte Edvard Kardelj, der nach 1945 Vizepräsident der Bundesregierung und dann Außenminister war, in seinem Buch Die Entwicklung der slowenischen Nationalfrage die Nation wie folgt: „Eine Nation ist eine spezifische nationale Gemeinschaft, die auf der Grundlage der gesellschaftlichen Arbeitsteilung des kapitalistischen Zeitalters geschaffen wird, d.h. auf einem solchen Entwicklungsniveau der Produktivkräfte, wenn die Quantität der überschüssigen gesellschaftlichen Arbeit beginnt, sich in eine neue Qualität der sozialen Integration auf einem höheren Niveau zu verwandeln, d.h. auf einem kompakten nationalen Territorium, im Rahmen einer gemeinsamen Sprache und einer engen ethnischen und kulturellen Verwandtschaft im Allgemeinen“.30 Es muss jedoch gesagt werden, dass viele Elemente der Arbeitsteilung in Jugoslawien nur dank dem Nation-Staat, seinem rechtlichen Rahmen und der Armee möglich wurden. Das sozialistische Jugoslawien war bei dieser Aufgabe wesentlich erfolgreicher als die vorhergehenden Staaten. Mit seiner nationalen Befreiungsrhetorik während des Krieges, seinem national und ethnisch geprägten republikanischen System und seinen Institutionen, seiner Armee und später dem System der Selbstverwaltung der Arbeiterinnen und Arbeiter erreichte die KP ein noch nie dagewesenes Niveau und, wie Kardelj sagen würde, eine „Qualität der sozialen Integration“.
Das kapitalistische System der sozialen Regulierung ist nur dann wirksam, wenn alle Teile der Gesellschaft ihm untergeordnet und von ihm abhängig sind. Nach der Etablierung der Nation-Staaten fand die primäre Akkumulation nach dem Krieg in Jugoslawien in mehreren parallelen Prozessen statt: 1) die Enteignung der Bauernschaft; 2) die Domestizierung und Konzentration der Arbeitskräfte durch Schockarbeit, die Einführung einer wachsenden Zahl von Arbeiterinnen und Arbeitern in die Fabrikarbeit und die Verstädterung, 3) die Errichtung eines staatlichen Eigentumsmonopols. Bei all diesen Prozessen spielte der ethnisch begründete jugoslawische Nationalismus eine wichtige Rolle bei der Identifizierung der Bevölkerung mit dem neuen Regime der Arbeit und der Staatsmacht. Das vorübergehende zentrale Staatsmonopol als eines der Mittel zur Sicherung der Kontinuität des Staates und der kapitalistischen Produktion sollte in der nächsten Phase durch völlig andere Methoden ersetzt werden.
Nationalismus und die Herrschaft des Staates über die Gesellschaft
die Periode der so genannten sozialistischen Selbstverwaltung ab 1963
In den sozialistischen Selbstverwaltungsverhältnissen werden die Interessen der Arbeiterklasse, die sich die Stellung der herrschenden Klasse in der Nation erkämpft hat, zu den Interessen der Nation, und die Interessen der Nation werden zu den Interessen der Klasse.
Tito, Bericht
X. SKJ-Kongress
Auf dem VIII. Kongress des Bundes der Kommunisten 196431 wurde die nationale Frage aufgrund des Kampfes zwischen den Republiken um die Verteilung des zentralisierten Nationaleinkommens, der Krise der Produktion und anderer Probleme, die angeblich durch das zentralistische Staatssystem verursacht wurden, auf die Tagesordnung gesetzt. Plötzlich musste das Erbe des revolutionären Etatismus beseitigt werden, und so wurden noch im selben Jahr ökonomische Reformen eingeleitet, die „freiere sozioökonomische Beziehungen“ und die Arbeit an „objektiven ökonomischen Gesetzen“ ermöglichen sollten. Auf demselben Kongress stand auf den Stimmzetteln neben Titos Namen zum ersten Mal kroatisch und nicht jugoslawisch.
Ein Jahr zuvor hatte die neue Verfassung die Selbstverwaltung der Arbeiterinnen und Arbeiter als Grundlage der gesellschaftlichen Organisation bestätigt und im Prinzip die rechtlichen Voraussetzungen für ihre weitere Entwicklung geschaffen. Die Einführung der Selbstverwaltung begann Anfang der 1950er Jahre und wurde zweimal – in den 1960er und 1970er Jahren – in Richtung eines zunehmend freien Marktes reformiert.
Die Schlüsselperson bei der Schaffung der neuen ökonomischen Politik war Boris Kidrič, der langjährige Anführer der Kommunistischen Partei Sloweniens. Kidrič vertrat die Ansicht, dass die jugoslawische Alternative zur sowjetischen „sozialistischen Primärakkumulation“ in der „sozialistischen Warenproduktion“ zu finden sei, die in der Übergangszeit vom Kapitalismus zum Kommunismus notwendig sei. Die Notwendigkeit eines solchen Modells ergab sich für ihn aus dem Scheitern der UdSSR – der Staatssozialismus führt unweigerlich zur Stärkung der Bürokratie, zur Unterdrückung der sozialistischen Demokratie und schließlich zur Umwandlung des Staatssozialismus in einen Staatskapitalismus. Um die weitere Entwicklung des Kapitalismus zu verhindern, ist es laut Kidrič notwendig, die Gesellschaft nach dem Wertgesetz zu organisieren, auch wenn dieses Prinzip das eigentliche Wesen der kapitalistischen Produktionsweise und der sozialen Regulierung darstellt. Bereits auf dem Plenum des Zentralkomitees der KPJ im Januar 1949 wies Kidrič darauf hin, dass die zentrale Kontrolle über die Verteilung das freie Funktionieren der ökonomischen Gesetze bedroht, die die Hauptantriebskraft der Produktion sind. Auf dem sechsten Kongress der KPJ im Jahr 1952 beharrte er auf diesem Ansatz: „…das neue ökonomische System muss auf objektiven ökonomischen Gesetzen beruhen, und es muss die administrative Unterdrückung dieser Gesetze so weit wie möglich vermeiden“. Um das Wachstum, die Qualität und die Vielfalt der materiellen Waren sowie die Normalisierung der Lebensbedingungen zu gewährleisten, hielt er es für notwendig, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, d. h. arbeitsintensive Innovationen in der Produktion einzuführen.
![]()
Boris Kidrič
Die SKJ stand vor dem Problem, wie man die Arbeiterinnen und Arbeiter zu mehr Arbeit zwingen und gleichzeitig im Rahmen der sozialistischen Ideologie bleiben konnte. Die in der vorangegangenen Periode vernachlässigte Idee der Abschaffung des Staates war nun zur herrschenden Doktrin erhoben worden. Sie diente der Partei nicht nur dazu, die Vorteile der sozialistischen Demokratie gegenüber dem nichtsozialistischen Charakter der UdSSR zu beweisen, sondern ermöglichte auch die ideologische Legitimierung institutioneller Veränderungen in Richtung einer Stärkung der Rolle des Marktes und wurde vor allem durch das Konzept der Selbstverwaltung der Arbeiterinnen und Arbeiter institutionalisiert. Das Konzept der Selbstverwaltung, das von oben und nicht als Ergebnis des Kampfes der Arbeiterinnen und Arbeiter eingeführt wurde, ermöglichte eine Reihe von Dingen. Da das Einkommen eines Arbeitskollektivs nun von seinem Erfolg auf dem Markt abhing, wurde jedes Individuum durch sein eigenes Überleben motiviert, so hart wie möglich zu arbeiten. Auf diese Weise wurde die Produktivität gesteigert und die sozioökonomischen Voraussetzungen für eine weitere Industrialisierung wurden geschaffen. Gleichzeitig sicherten die ideologischen Konzepte der Abschaffung des Staates und der Selbstverwaltung der Arbeiterinnen und Arbeiter letztlich das Überleben der jetzigen Regierung und im weiteren Sinne, wie wir sehen werden, auch das Überleben des Staates. Die Arbeiterschaft war gezwungen, mehr zu arbeiten, die Legitimität des Staates war gesichert, so dass er weiterhin in aller Ruhe für den Fortbestand der „objektiven ökonomischen Gesetze“, d. h. des Kapitals, sorgen konnte.
László Sekelj zufolge war die Selbstverwaltung von Anfang an ausschließlich als ein Modell der administrativen Dezentralisierung gedacht, und das einzige wirkliche Ergebnis der Selbstverwaltung war seiner Meinung nach die Verlagerung des Machtzentrums von der Föderation zu den Republiken. Im Vergleich zur Zeit des „revolutionären Etatismus“ übt der Staat weiterhin seine Umverteilungsfunktion aus, nur mit etwas anderen institutionellen Methoden.
Die Idee der Brüderlichkeit und der Einheit, die in der vorangegangenen Periode vorherrschend war, wurde allmählich aufgegeben und Anfang der sechziger Jahre durch das Konzept des sozialistischen Jugoslawiens und dann Anfang der siebziger Jahre durch das Konzept der Einheit der jugoslawischen Völker und Nationalitäten ersetzt. Vom Achten bis zum Zehnten Kongress wurden parallel zur Betonung der Bedeutung der marktwirtschaftlichen Unabhängigkeit der Arbeitskollektive immer wieder Änderungen in Richtung einer Stärkung und Ausweitung der Befugnisse der Republiken und Provinzen vorgenommen, was mit der Notwendigkeit der Bestätigung der Nationen in der Selbstverwaltung begründet wurde.
Die ersten Anzeichen für die Abkehr vom Jugoslawismus zeigten sich bereits auf dem bereits erwähnten VIII. Kongress des Bundes der Kommunisten, als die Republikanisierung der Partei stattfand und Tito zum ersten Mal „Kroaten“ neben seine Unterschrift setzte. Auf demselben Kongress erhalten die obersten Parteiführer der Republiken (auf dem 9. Kongress auch der Provinzen) das Recht, ihre eigene Politik zu gestalten. Nach der Kongressresolution sowie nach dem Bericht von Kardelj und Tito waren die Hauptelemente der Reform des ökonomischen Systems: die Entnationalisierung der Fonds und der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen der sozio-politischen Gemeinschaften, die Abschaffung aller zentralen Fonds, die für ökonomische Investitionen bestimmt waren; die Unabhängigkeit der Arbeitskollektive bei der Entscheidung über die gesamte erweiterte Reproduktion; die Arbeiterorganisationen und ihre Interessen als Träger der Integrationsprozesse; das freie Wirken der ökonomischen Gesetze der Warenproduktion, usw. Titos Bericht zufolge ist „die jugoslawische sozialistische Integration eine neue Art von sozialer Gemeinschaft, in der alle Nationalitäten gemeinsame Interessen haben“, „die internationalen ökonomischen Beziehungen müssen so gestaltet werden, dass sie die volle Entwicklung der gesamten sozialen Gemeinschaft und aller ihrer nationalen Teile gewährleisten“. In seinem Bericht entwickelte Kardelj die These von der nationalen ökonomischen Unabhängigkeit und den Nationalstaaten mit sozialistischem Charakter: „Der Ausgangspunkt der internationalen ökonomischen Beziehungen ist sicherlich die ökonomische Unabhängigkeit jeder Nation, die die Unabhängigkeit der Arbeit und der Verfügung über das Produkt der Arbeit, d.h. des Aufbaus der materiellen Basis der eigenen Kultur und Zivilisation, gewährleistet.“ Während er glaubte, dass der Staat historisch gesehen im Sterben liegt und durch eine Vereinigung freier Produzenten ersetzt wird, bestand Kardelj gleichzeitig darauf, dass die Nationen von Natur aus zu ihren Staaten tendieren, so dass Jugoslawien nur dann eine historische Bedeutung hat, wenn es allen jugoslawischen „vollendeten“ Nationen ermöglicht, dieses Ziel zu erreichen. Auch andere Redner des Kongresses betonten die größere Bedeutung der Republiken. So sagte Veljko Vlahović, einer der drei Sekretäre im Exekutivkomitee, dass „unsere Entwicklung, deren Ausdruck die neue Verfassung ist, die Nation in der Selbstverwaltung bekräftigt“, und er verwendete in seinem Vortrag auch den Begriff der sozialistischen Warenproduktion.
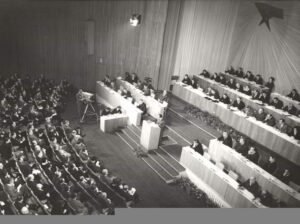
VIII. Kongress des Bundes der Kommunisten, Belgrad, 1964
Nach dem Brioni-Plenum, d.h. der vierten Plenartagung des Zentralkomitees des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens (CK SKJ) 1966, ging das Recht zur Ernennung der oberen und mittleren Führungskräfte vom Organisationssekretär des CK SKJ auf die republikanischen Personalkommissionen über, was die Macht der Republiken weiter stärkte.
1968 fanden die bis dahin massivsten und am stärksten artikulierten Studentenrevolten in Jugoslawien statt, die wegen der schlechten Lebensbedingungen der Studenten begannen und sich bald zu Demonstrationen gegen die Klassengesellschaft und die herrschende bürokratische Klasse entwickelten, die dann zur „roten Bourgeoisie“ erklärt wurde. Die Art und Weise, wie die SKJ auf die Ausschreitungen der Studenten reagierte, bestätigte den Charakter ihrer nationalistischen Politik und zementierte den Weg, den die SKJ einschlagen würde, weiter. Der Nationalismus wird zu einem Mittel der politischen Manipulation und der Umlenkung von Konflikten, die auf anderen Ebenen, z. B. auf Klassenlinien, ausgetragen werden. Während die Demonstrationen in Zagreb, Belgrad, Pristina und anderen Städten stattfanden, wurden nur in Pristina Polizei und Armee gegen die Demonstranten eingesetzt. In Zagreb hingegen bestand das Hauptquartier zur Unterdrückung der Studentenbewegung aus denjenigen, die bald zu Ideologen des kroatischen Nationalismus werden sollten, und autorisierte Mitglieder des SKJ verkündeten auf Vollversammlungen der Studenten, dass „die Tschetniks die Macht in Belgrad übernommen haben“. Der Nationalismus wurde zunehmend zur neuen Legitimationsgrundlage der SKJ.
Auf dem Neunten Kongress der SKJ im Jahr 1969 wurde die nationale Unabhängigkeit offen als konstitutives Prinzip des jugoslawischen Sozialismus hervorgehoben. Neben dem Begriff der nationalen Unabhängigkeit wurde auch der Begriff der nationalen Souveränität verwendet. Auf dem Kongress wurden die allgemeinen Standpunkte der Partei zur nationalen Unabhängigkeit dargelegt: „Die wirkliche Freiheit, Souveränität und Gleichheit der Nationen beruht auf der sozialen und ökonomischen Stellung des arbeitenden Menschen. Umgekehrt kann die gesellschaftliche Stellung des arbeitenden Menschen ohne die Verwirklichung der Freiheit, der Souveränität der Nationen, keinen sozialistischen Inhalt bekommen“; „nur als führende Kraft ihrer Nation, d.h. ihrer Republik, kann sich die Arbeiterklasse als führende Kraft der sozialistischen Gesellschaftsbewegung in der gesamten Gesellschaft behaupten“, und „unter den heutigen materiellen und gesellschaftlichen Verhältnissen ist es nicht möglich, die Widersprüche der nationalen Interessen in den ökonomischen Beziehungen vollständig zu überwinden“. Die offizielle Politik des SKJ sah also eine weitere Heterogenisierung der Arbeitskräfte auf nationaler Ebene und eine Homogenisierung innerhalb der Grenzen der Republiken vor. Laut SKJ sind die Widersprüche der nationalen Interessen grundlegende gesellschaftliche Widersprüche, und die Arbeiterklasse einer Republik hat mehr mit den Machtzentren der Republik, der sie angehört, gemeinsam als mit der Arbeiterklasse anderer Republiken. Auf demselben Kongress bezeichnete der Präsident des SKJ die Unruhen im Kosovo als nationalistisches und irredentistisches Ablenkungsmanöver.
Während die SKJ auf dem Achten, Neunten und Zehnten Kongress die Bedeutung der Nation und die Stärkung der nationalen Ökonomien betont, kritisiert sie nominell Nationalismus, Unitarismus und Partikularismus. Das Problem des unitarischen Nationalismus besteht darin, dass er nationale Fragen im Namen eines „abstrakten Internationalismus“ ignoriert, und das Problem des partikularistischen Nationalismus besteht darin, dass er die nationalen Fragen anderer Nationen im Namen einer Nation ignoriert. Wir sehen, dass die Kritik an beiden Arten von Nationalismus nicht aus der Kritik am Nationalismus als solchem kommt, sondern selbst in nationalistischen Ideen verwurzelt ist. Im Grunde genommen ist der Nationalismus die Vernachlässigung des Nationalismus31. Mehr denn je wurde betont, dass die Kommunisten zuallererst den Nationalismus ihres eigenen Volkes angreifen müssen und erst dann den der anderen. Im Diskurs wird der partikularistische Nationalismus vor allem mit Slowenien, Mazedonien und insbesondere Kroatien in Verbindung gebracht, wofür die aussagekräftigere Formulierung „separatistischer Nationalismus“ verwendet wird. Es gab keine genaueren Erklärungen für diese Art von Nationalismus, außer der Idee, dass er mit dem Liberalismus und der Technokratie verbunden ist und dass er die politische Plattform verschiedener Gegner des Sozialismus darstellt.
Zwischen dem Neunten und Zehnten (1974) Kongress wurde das Prinzip der nationalen, republikanischen und provinziellen Souveränität kontinuierlich normativ und institutionell gestärkt, bei gleichzeitiger Verengung der Zuständigkeiten der Föderation. Darüber hinaus festigte der SKJ kontinuierlich seine Macht über die Gesellschaft, indem er eine Reihe von ökonomischen Privilegien für wichtige Schichten der Gesellschaft auf republikanischer, provinzieller und lokaler Ebene gewährte. Die wichtigsten Veränderungen in diesem Bereich wurden durch die 1972 verabschiedeten Verfassungsänderungen herbeigeführt, die die erste Phase der Verfassungsreformen darstellten, die in die neue Verfassung von 1974 aufgenommen wurden. Im Prinzip eröffneten die Änderungen jeder Republik den Raum, ihre politische Organisation mit eigenen Verfassungen zu definieren. Darüber hinaus bildeten die Änderungen die politische Grundlage für den zunehmend aggressiven Nationalismus der SKH in der SR Kroatien. Wenn Historiker aus der jugoslawischen Zeit über die Entstehung des so genannten „kroatischen Frühlings“, d. h. der so genannten „Massenbewegung“ (MASPOK, 1967-1971), schreiben, sagen sie oft, dass die „Nationalisten“ (ich verwende den Begriff „Nationalisten“ in Anführungszeichen, um die Nationalisten außerhalb der SKH zu bezeichnen, da der Begriff in der Literatur aus dieser Zeit nur sehr vage verwendet wurde, wahrscheinlich um die Tatsache zu verschleiern, dass die Führung und die Mitglieder des SKJ tatsächlich auch nationalistisch waren) und die Emigration der Ustascha die Taktik anwandten, sich auf die Nationalkommunisten zu stützen, indem sie den Diskurs des Bundes der Kommunisten übernahmen, dem sie dann ihren eigenen Akzent und ihre eigene Richtung gaben, um falsche Vorstellungen zu verbreiten und den Diskurs zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Dasselbe gilt jedoch auch für den SKJ, der den nationalistischen Diskurs schon seit einiger Zeit nutzte, um seine Macht über die Gesellschaft zu stärken und die Aufmerksamkeit von anderen sozialen Spaltungen abzulenken. Darüber hinaus ist es bezeichnend, dass es für die Ustascha-Emigration und die „Nationalisten“ so einfach war, sich auf den SKJ-Diskurs zu stützen. Schließlich waren die Anführer von MASPOK Mitglieder der SKH, Savka Dabčević-Kučar und Miko Tripalo, und nicht irgendwelche „Nationalisten“.
![]()
Savka Dabčević-Kučar, Zagreb, 1971
![]()
Miko Tripalo, Drniš, 1971
In den Jahren 1970 und 1971, parallel zu den Verurteilungen des Nationalismus durch das Zentralkomitee auf der 10. Sitzung und das Exekutivkomitee bei mehreren Gelegenheiten, sagten einige Mitglieder der SKH – während sie unzureichend nationalistische Mitglieder der SKH kritisierten – offen, dass Angriffe auf Nationalisten Angriffe auf das Zentralkomitee der SKH selbst sind. Die Frage der kroatischen nationalen Interessen wurde zur Hauptströmung, und diejenigen, die sie in der Partei vertraten, galten als „fortschrittlich“. Ein Treffen des SKH-Exekutivkomitees mit Tito32 am 4. Juli 1971 sollte dazu dienen, den nationalistischeren Teil der SKH zu besänftigen. Sie setzten jedoch ihre Bündnisse mit Nationalisten außerhalb der SKH fort und hatten darüber hinaus den Ehrgeiz, dass die SKH, d.h. ihr „progressiver Kern“, an der Spitze des MASPOK stehen sollte. Es ging nicht um ein paar marginale Mitglieder der SKH, sondern um Leute von ganz oben. Die Forderungen des MASPOK reichten von der Verringerung des Anteils der in der SR-Kroatien erwirtschafteten Profite, der an das Zentrum der Föderation überwiesen wird, über den Widerstand gegen eine stärkere Vertretung von Menschen serbischer Nationalität in der Politik, der Armee und den Geheimdiensten bis hin zur Förderung der Idee, dass die kroatische Variante der Sprache im Verhältnis zur serbokroatischen Sprache getrennt ist. SKH-Funktionäre und „Nationalisten“ sprachen dieselbe Sprache: Beide betonten die Notwendigkeit eines Nationalstaates und die These, dass Kroatien beraubt worden sei. Als sie sahen, in welche Richtung sich die Dinge entwickelten, begannen viele „gemäßigte“ SKH-Mitglieder, aus Opportunismus nationalistische Argumente zu akzeptieren. Bei Studentenprotesten, die die nationalistische Politik der SKH unterstützten, waren Slogans wie „Die kroatischen Banken müssen ihre Gelder in ihren Tresoren behalten“ und „Es lebe die Brüderlichkeit“ zu hören, allerdings ohne Einheitlichkeit. Innerhalb der Partei und in einigen Institutionen und Arbeitsorganisationen von strategischer Bedeutung wurde Druck auf diejenigen ausgeübt, die nicht mit dem MASPOK übereinstimmten, das bereits eine nationale Währung, eine nationale Armee und eine territoriale Ausdehnung forderte. Nationalisten außerhalb der SKH schufen ihre eigenen Organisationen in Arbeitskollektiven und führten im Namen der „Verjüngung“ und des „Fachwissens“ personelle Veränderungen nach Nationalität ein, was von einigen aus der Spitze der SKH, den Vertretungsorganen und Behörden sowie von einigen Abgeordneten der Föderalen Vollversammlung (z.B. Marko Veselica, Jure Sarić) unterstützt wurde. Schließlich wurden einige der Forderungen des kroatischen MASPOK als offizielle, für alle Republiken geltende Politik akzeptiert und in die Verfassung von 1974 aufgenommen. Zum Vergleich: Als 1981 im Kosovo Ausschreitungen ausbrachen, wurde eine Armee mit Panzern gegen die Demonstranten geschickt, und einige von ihnen wurden getötet, obwohl ihre Forderungen viel bescheidener waren als die des MASPOK. Sie forderten nämlich den Status einer Republik, eine Verfassung anstelle eines Statuts, besondere nationale Feiertage und eine Flagge.33 Die Kosovo-Albaner wurden nicht als Nation, sondern als Nationalität anerkannt, und es scheint, dass einige Nationalismen als gefährlicher angesehen wurden als andere. Die Nationalismen der „unvollendeten“ Nationen waren eindeutig gefährlicher, obwohl die Kriterien für die Anerkennung einer Nation als „vollständig“ völlig willkürlich waren, d.h. sie wurden von der liberalen Logik geleitet, dass vollendete Nationen diejenigen sind, deren politische „Vertreter“ Zugang zu mehr Macht haben.
Auf dem Zehnten Kongress im Jahr 1974 erklärte Tito: „In den sozialistischen Selbstverwaltungsbeziehungen werden die Interessen der Arbeiterklasse, die sich die Position der herrschenden Klasse in der Nation erkämpft hat, zu den Interessen der Nation, und die Interessen der Nation werden zu den Interessen der Klasse“ (Titos Papier, X. Kongress des SKJ, „Kommunist“ Belgrad 1974, S. 47). Im selben Jahr wurden eine neue föderale Verfassung, die Verfassungen der Republiken und zum ersten Mal auch die Verfassungen der autonomen Provinzen verabschiedet. Den Republiken wurde die staatliche Souveränität und den Nationen, d. h. den konstitutiven Völkern (narodi), die politische Legitimität verliehen. Das jugoslawische Volk und die jugoslawische Identität existierten im politischen Sinne nicht mehr. Darüber hinaus bestätigte die Verfassung die Verwendung des Begriffs „arbeitendes Volk“ anstelle der Arbeiterklasse, und alle Mitglieder einer Nation, d. h. einer administrativ-politischen Einheit (Republik, Provinz, Gemeinde, lokale Gemeinschaften) sind normativ gleich.

X. Kongress des Bundes der Kommunisten, Belgrad, 1974
Dieses Verfassungskonzept, das manchmal auch als „viertes Jugoslawien“ bezeichnet wird, wird hauptsächlich Edvard Kardelj zugeschrieben. Obwohl nicht alle Fraktionen des SKJ in dieser Frage völlig einig waren34, war das Konzept von Kardelj letztlich das dominierende. Er vertrat nämlich konsequent die These, dass die Kommunisten die Nation, der sie angehören, beherrschen müssen, und dass der Staat nach Stalins Formulierung „sozialistisch im Inhalt, national in der Form“ sein muss. Sein Konzept von Jugoslawien basierte auf der Idee des so genannten „Absterbens des Staates“, während er gleichzeitig die Bedeutung der Republiken als Staaten betonte, in denen die Nationen ihre Souveränität ausüben. Kardelj versuchte, dieses Paradoxon zu verbergen, indem er ständig nominell den Etatismus und den Bürokratismus angriff. Tatsächlich ist die Kritik am Etatismus und an der Bürokratie ein notwendiger Bestandteil fast aller Texte aus den späten sechziger und siebziger Jahren.

Edvard Kardelj
Wie genau wurde das Absterben des Staates konzipiert? Laut Kardelj sollten an die Stelle des Staates zahllose Basisorganisationen der vereinigten Arbeit (osnovne organizacije udruženoga rada, OOUR), selbstverwaltete Interessengemeinschaften (samoupravne interesne zajednice, SIZ), gesellschaftspolitische Organisationen, Institutionen der Landesverteidigung und zahlreiche andere Organisationen treten. Die OOUR sollten die Demokratisierung der Gesellschaft auf der Ebene der Produktion selbst darstellen, und durch sie sollten die Arbeiterinnen und Arbeiter ihre eigene Arbeit und die gesamte gesellschaftliche Reproduktion verwalten. In Verbindung mit dem Markt und den nationalen Republiken trugen sie jedoch nur zu einer extremen Atomisierung bei und stärkten die Vorherrschaft des Staates über die Gesellschaft und die nationale Spaltung der Arbeiterschaft. Die Ökonomien der Republiken wurden zu nationalen Ökonomien, und die horizontale Verbindung von Arbeiterinnen und Arbeitern über die Grenzen der Republiken hinweg wurde extrem schwierig. Bereits 1965 hatten die Republiken autonome Bankensysteme, nur ein einheitliches Steuersystem blieb bestehen. Ende 1976 gab es in 2.892 Arbeitsorganisationen (radna organizcija, RO) 15.302 OOURs, von denen sich der Sitz der OOUR in nur 2,1 % der Fälle in einer anderen Republik als das Zentrum der Arbeitsorganisation befand, und 1981 waren es 4.541 ROs mit 21.488 OOURs und in der zweiten Republik sogar nur 1,5 % der OOURs. 1976 gab es in Jugoslawien 123 SOURs (Komplexe Organisationen der vereinigten Arbeit) mit 887 ROs, von denen nur zwei ihren Sitz außerhalb der Heimatrepublik der SOURs hatten. Ende 1980 gab es 364 SOURs mit 2.807 ROs, von denen nur 45 oder 1,6 % ihren Sitz in einer anderen Republik hatten (Korošić, 1988). Seit 1970, als die Inflation einsetzte, ging der Handel zwischen den Republiken auf 20% der gesamten ökonomischen Aktivität zurück.
Die OOURisierung zersplitterte nicht nur die Arbeiterklasse auf nationaler Ebene, sondern schuf entgegen Kardeljs Absicht auch eine riesige bürokratische Struktur des Staates, die ständig an Größe und Komplexität zunahm. Ein Jahr nach der Verabschiedung des Gesetzes über die einheitliche Arbeit (1980) gab es in Jugoslawien 94.415 OOURs. Um die Komplexität der Struktur zu verdeutlichen, sei hier das Beispiel der Post, des Telefons und des Telegrafen (PTT) genannt. Die PTT umfasste nicht weniger als 291 OOURs, zwei Arbeitsorganisationen ohne OOURs, 26 Arbeitsorganisationen mit OOURs, vier Arbeitsgemeinschaften, die OOURs hatten, und 22 andere Arbeitsgemeinschaften. Selbst die Flugsicherung auf Bundesebene war in 52 verschiedenen Einheiten organisiert, von denen 21 OOURs waren. Dieses System hatte in der Tat erreicht, dass mehr Arbeiterinnen und Arbeiter in den verschiedenen Verwaltungsgremien ihrer OOURs und SOURs mitwirkten. In der Realität waren die Arbeiterinnen und Arbeiter jedoch weit davon entfernt, die Fabriken und den gesamten Prozess der sozialen Reproduktion zu steuern. Sie waren nur in ihrer kleinen Einheit an der Entscheidungsfindung beteiligt, ohne wirklichen Einfluss auf das, was außerhalb dieser Einheit geschah.
In dieser Zeit wurde der Kongress der Selbstverwalter Jugoslawiens nur zweimal einberufen – 1971 und 1981. Die Idee, in der Föderalen Vollversammlung einen Rat der vereinigten Arbeit zu bilden, wie es in den Vollversammlungen der Republiken und Provinzen der Fall war, wurde von der Mehrheit nicht unterstützt und als einseitig angegriffen. Da die jugoslawische, d.h. die supranationale Arbeiterklasse nicht existiert, gibt es keine Notwendigkeit für die Existenz eines jugoslawischen parlamentarischen Rates. Obwohl Tito bis zu seinem Tod von einer einheitlichen Arbeiterklasse sprach, vertraten Politiker, die tatsächlich Einfluss auf die konkrete Politik hatten, wie Kardelj und Vladimir Bakarić, die Idee nationaler Arbeiterklassen bzw. Arbeiterklassen abgeschlossener Nationen.
In der Literatur der 1970er Jahre wird das Erstarken des Nationalismus ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre auf den Etatismus, die Bürokratisierung und die Technokratie zurückgeführt. Das heißt, die Bestrebungen der bürokratischen, republikanischen und technokratischen Schichten, ihre Autorität und Macht im Namen der Wahrung der Interessen ihrer Nation zu stärken, was auf Kosten der Selbstverwaltung geht. Der Nationalismus wurde auch auf die ökonomischen Ungleichheiten zwischen den Republiken, die Kämpfe der republikanischen Bourgeoisien und die Interessen der einzelnen republikanischen Anführer zurückgeführt. Wie jedoch aus den Debatten und Schlussfolgerungen der SKJ-Kongresse sowie aus der von ihr beschlossenen Politik hervorgeht, hat die SKJ selbst diesen Schichten Macht verliehen und sie systematisch gestärkt. Wie Jelka Kljajić-Imširović, die in der radikalen Strömung der Studentenbewegung von 1968 aktiv war, feststellte, „sind einige der kritisierten spezifischeren Erscheinungsformen des Nationalismus nicht – das ist mehr als offensichtlich – das Ergebnis der Aktion der parteifeindlichen nationalistischen Kräfte, sondern die logische Folge bestimmter systemischer Prinzipien der offiziellen Parteipolitik“ (Kljajić-Imširović, 221). „Die ideologische und normativ-institutionelle Unterordnung der Klassen- und Sozialinteressen unter die nationalen Interessen im Namen ihrer Einheit im Rahmen der ’nationalen Unabhängigkeit‘ (VIII. Kongress) und insbesondere im Rahmen der ’nationalen Souveränität‘ (IX. Kongress) behinderte und begrenzte integrative Prozesse innerhalb der jugoslawischen Gesellschaft, trugen zum Antagonismus von im Wesentlichen identischen Klassen- und Sozialinteressen auf nationaler Ebene bei und damit zur Erschwerung oder Blockierung der Möglichkeit, eine autonome Selbstverwaltungsbewegung und ein authentisches Klassen- und Sozialbewusstsein zu konstituieren“ (Kljajić-Imširović, 242).
In dem Text „Die Beziehung zwischen Klasse und Nationalismus im zeitgenössischen Sozialismus“ (in der gleichnamigen Sammlung von 1970) schreiben Stipe Šuvar, Andrija Dujić und Vatroslav Mimica:
„Die Nation entstand und besteht als eine Form der Organisation der Klasseneinteilung der Gesellschaft, die auf einem bestimmten Entwicklungsniveau der menschlichen Produktivkräfte die ’natürlichste‘ und daher fortschrittlichste ist. […] Um die Nation in Richtung Sozialismus zu führen und die sozialistische Praxis zu leiten, muss sie [die Arbeiterklasse] sich so weit wie möglich mit der Nation identifizieren und die ausbeutenden Klassen und Schichten aus der Nation ausschließen. Die Arbeiterklasse ist also weder supranational noch antinational noch nichtnational. Solange sie als Klasse existiert und solange die Nation existiert, kämpft die Arbeiterklasse um die Rolle der führenden Klasse ihrer eigenen Nation. Die Interessen der Arbeiterklasse und die Interessen der Nation, die sie anführt, stimmen notwendigerweise überein. Unter diesen Umständen bedroht die Verletzung der nationalen Interessen die Klasseninteressen und umgekehrt. […] In den nationalen Befreiungskämpfen kommt der wesentliche Zusammenhang zwischen nationalem und Klasseninteresse, ihre grundlegende Identität im Kampf um den Fortschritt, am deutlichsten zum Ausdruck.“
In der gleichen Sammlung sagt Šefko Međedović:
„Die Nation als soziale Gruppierung, als eine bestimmte Form des gesellschaftlichen Lebens, ist das Ergebnis der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die durch die kapitalistische Produktionsweise entwickelt wurde (und die selbst das Ergebnis dieser Arbeitsteilung ist); daher stellt die Nation den ‚Endpunkt‘ dieser Gesellschaft dar – die vollendete kapitalistische Gesellschaft. In diesem Sinne stellt sie als sozialgeschichtliche Form der sozialen Gemeinschaft (Gemeinschaft des sozialen Lebens) eine höhere historische Form des Zusammenschlusses von Menschen in der Gesellschaft dar, eine Form der Vergesellschaftung des Produktionsprozesses und des sozialen Lebens. Die nationale Verfassung drückt den gesellschaftlichen Prozess der Abschaffung der feudalen, mittelalterlichen, patriarchalischen Formen des gesellschaftlichen Lebens aus und repräsentiert ihn…“
Der Fortschritt, von dem Šuvar, Međedović und andere sprechen, ist ausschließlich eine für jugoslawische Ideologen und Theoretiker typische kapitalistische bourgeoise Beschäftigung. Um den Fortschritt zu erreichen, muss die gesamte Gesellschaft in die Produktion hineingezogen werden, der Staat und die Nation. Nichts kann außerhalb dieses Verhältnisses bleiben, und dies wird durch die so genannte Vergesellschaftung erreicht. Dank der jugoslawischen sozialistischen Selbstverwaltung und ihrer allgegenwärtigen verschlungenen Architektur von Basisorganisationen der vereinigten Arbeit (OOUR) hat das Kapital in diesen Bereichen schließlich triumphiert: Die abstrakte Arbeit wurde gewissermaßen rationalisiert und vermenschlicht, und als soziales Verhältnis wurde sie auf einen größeren Teil der Gesellschaft verallgemeinert, das Lohnverhältnis wurde zu einem etatistischen Verhältnis, die Gesellschaft wurde zum Staat. Die Nation als „Form der Vergesellschaftung des Produktionsprozesses und des gesellschaftlichen Lebens“, wie Međedović sagt, ist die Krone dieses Prozesses in zweifacher Hinsicht: erstens als Ergebnis der konkreten Politik der Föderation und der Republiken, die darauf abzielte, den Begriff und die Interessen der Nationen zu bewahren und zu stärken, und zweitens als subjektiver Klebstoff, der jedes Individuum weiter an die Interessen des Kapitals und der Republik/Nation, der es zugeordnet war, band. In diesem Kontext hätte eine autonome Selbstverwaltungsbewegung, wie sie Jelka Kljajić-Imširović erwähnt, keine Chance.
Fazit
Die Rolle der nationalistischen Politik der KPJ bei der Aufrechterhaltung der Kontinuität von Kapitalismus und Staat
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die marxistische Führung der SSDP besorgt über die Militanz der Arbeiterinnen und Arbeiter in Serbien zu jener Zeit. Sie waren besorgt über das mangelnde Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter am politischen Kampf (womit sie den Kampf um die Eroberung der Macht meinten) und befürchteten, dass aufgrund zu vieler Streiks „die Ausländer das Interesse verlieren werden, ihr begehrtes Kapital zu investieren“.35 Dušan Popović glaubte, dass die Klassenposition des serbischen Proletariats eher dem Lumpenproletariat entsprach, und Dimitrije Tucović erklärte, dass die Massen zum Anarchismus neigten und auf den richtigen Weg geführt werden müssten36. Auch hier hatte das Kapital seine „zivilisatorische Mission „37 zu erfüllen, und die Arbeiterinnen und Arbeiter verstanden und akzeptierten diesen Weg zum Kommunismus noch nicht. Also kämpft die Arbeiterklasse weiter. Während der gesamten Zeit des sozialistischen Jugoslawiens und auch während des Krieges in den 90er Jahren kam es immer wieder zu Streiks und Aufständen. Daher waren Kapital und Staat gezwungen, immer neue Strategien zu finden, um den Widerstand zu brechen.
In einem Gebiet, in dem viele Sprachen und Dialekte gesprochen wurden und die verschiedenen Vorstellungen von nationalen Identitäten und Beziehungen, die die Bourgeoisie langsam aufbaute, noch nicht vollständig stabil und von den Nationalstaaten bestätigt waren, konnten aufkommende Nationalgefühle der KPJ als eine der Strategien dienen, um Menschen anzuziehen und zu formen, damit sie für ihre Politik handhabbar wurden. Deshalb war die nationale Frage seit ihrer Gründung eines der zentralen Themen für die Kommunistische Partei Jugoslawiens (KPJ). Als sich die geopolitische Lage auf dem Balkan und in Europa in der Zwischenkriegszeit veränderte, änderte die KPJ ihre Haltung zur nationalen Frage. Die Zusammenarbeit mit bourgeoisen Parteien und faschistischen Organisationen war legitim, wenn sie zur Macht der Partei beitrug. Die KPJ führte den Volksbefreiungskampf bekanntlich auf der Plattform des bourgeoisen Antifaschismus, wobei sie spezifische nationalistische patriotische Elemente mit dem jugoslawischen Patriotismus verband, ohne antikapitalistische Ziele zu erwähnen. Bereits 1920 verschwand jeder Hinweis darauf, dass die Revolution die Befreiung des Volkes vom Staat bedeuten sollte – nicht von dieser oder jener Regierung, sondern vom Staat als solchem – aus den Diskussionen der Partei. Und wenn nach dem Sieg im Krieg das Ziel die Bildung eines neuen Staates ist, wird die Ideologie der nationalen Befreiung oder des nationalen Befreiungskampfes nur zu einer weiteren ideologischen Legitimation des eigenen Rechts, über andere zu herrschen.
Wie andere kommunistische Parteien in der Welt hat die KPJ in Jugoslawien historisch zur Durchsetzung des Kapitals als einzig möglicher Form der menschlichen Gemeinschaft beigetragen, was unterschiedliche Taktiken zur Domestizierung der Arbeitskräfte erfordert. Nach der Gründung des neuen Staates wurde der Nationalismus zunächst als eine der Strategien der Akkumulation und Konzentration der Arbeitskräfte eingesetzt, und dann ab den 60er Jahren als eine der Strategien der Atomisierung. Da Jugoslawien vor dem Krieg überwiegend ein Agrarland war und die Arbeiterinnen und Arbeiter militant und „zum Anarchismus neigend“ waren, bestand die Aufgabe des neuen Staates darin, den rechtlichen, institutionellen und ideologischen Rahmen für die weitere Entwicklung des kapitalistischen Warenproduktionssystems zu schaffen und zu stärken und die Bevölkerung zu funktionalen Staatsbürgern zu machen, die bereit waren, viel zu arbeiten. Mit anderen Worten: Der neue Staat musste aus der Masse eine Nation machen. In diesem Sinne war die Umwandlung der Bevölkerung in konstitutive Völker und Nationen funktional für ihre legitime Ausbeutung als Ressourcen durch Schockarbeit. Für die Mitglieder einer Nation, die sich von einem äußeren Besatzer befreit hat, hört die Arbeit auf, Ausbeutung zu sein, und wird zu einer nationalen Pflicht, die mit Freude erfüllt wird. (Parallel zur Schockarbeit der konstituierenden Völker und Nationen erfolgte die Akkumulation durch die Enteignung der Bauernschaft).
Die Starrheit des zentralen Staatsmonopols konnte die Kontinuität der Mehrwertabschöpfung nicht auf Dauer gewährleisten, so dass die Verwalter des jugoslawischen Kapitalismus erkannten, dass die soziale Regulierung den „objektiven ökonomischen Gesetzen“ überlassen werden sollte. Parallel zur immer stärkeren Hinwendung zur Logik des Marktes wurden seit den 60er Jahren immer wieder Veränderungen in Richtung einer Stärkung und Ausweitung der Befugnisse der Republiken vorgenommen, was mit der Notwendigkeit begründet wurde, die Nationen in ihrer Selbstverwaltung zu bestätigen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter wurden nicht mehr durch die Notwendigkeit der Verteidigung und des Aufbaus eines neuen gemeinsamen Staates der Südslawen gebändigt, sondern durch die Notwendigkeit der Verteidigung ihres eigenen Einkommens, des Einkommens ihres Arbeitskollektivs und des Profits, der in ihrer eigenen Republik geschaffen wurde, d.h. durch die Atomisierung. Das Erstarken des Nationalismus ist in diesem Zusammenhang nicht nur eine Frage der institutionellen und politischen Struktur, die ihn durch die Stärkung der Macht der ethnisch basierten Volksrepubliken und ihrer politischen Anführer begünstigt, sondern ein notwendiges Element der kapitalistischen Gesellschaft. Wenn die abstrakte Arbeit und die Form des Wertes die Grundlage der sozialen Regulierung sind und wenn die Arbeit von Institutionen und Organisationen absorbiert wird, die von oben auferlegt wurden, wie es bei den OOURs der Fall war, selbst wenn diese Institutionen Selbstverwaltung genannt werden, wird es eine Tendenz geben, dass die Menschen von ihren Partikularinteressen geleitet werden. Egoistisches, partikularistisches und unsolidarisches Denken ist das sinnvollste und logischste Denken in kapitalistischen Gesellschaften. Der Nationalismus ist eine solche Art des Denkens.
In den 1990er Jahren musste das globale Kapital eine neue Legitimationsgrundlage für noch härtere Regime der Wertschöpfung finden. Für die Länder der kapitalistischen Peripherie bedeutete dies oft erzwungene restriktive ökonomische Maßnahmen, deren Umsetzung durch die weitere brutale Atomisierung und Zerschlagung der Macht der Arbeiterinnen und Arbeiter durch Schüren von ethnischem Hass, militärische Operationen und ethnische Säuberungen, kurz: durch Krieg, erleichtert wurde. Der Zerfall Jugoslawiens und der Krieg waren keineswegs nur eine Frage des Drucks und der Interventionen von außen, sondern auch der Logik kapitalistischer Gesellschaften, wie es sie in Jugoslawien gab. Kapitalismus und Nationalismus sind nicht plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Vielmehr hatte das sozialistische Jugoslawien die historische Aufgabe, ihre Kontinuität in diesem Gebiet zu entwickeln, zu konsolidieren und zu erhalten. Mit dem Krieg und den neuen Staaten nahm der Nationalismus lediglich eine andere spektakuläre Form an.
LISTE DER VERWENDETEN TEXTE
Atlagić, David, 1970. „Teze o suštini nacije u socijalizmu i o odnosu nacije i radničke klase“; u: Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu [„Thesen über das Wesen der Nation im Sozialismus und über das Verhältnis zwischen Nation und Arbeiterklasse“; in: Klasse und Nationalität im zeitgenössischen Sozialismus], Zagreb
Banac, Ivo, 1988. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: porijeklo, povijest, politika [Die nationale Frage in Jugoslawien: Ursprung, Geschichte, Politik], Globus, Zagreb
Camatte, Jacques, 2003. Protiv pripitomljavanja [Gegen die Domestizierung], Anarhija blok 45, Beograd
Bedszent, Gerd, Staatsgewalt vom Beginn der Neuzeit bis heute. Der Nationalstaat als Geburtshelfer und Dienstleister der Warenproduktion, https://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=aktuelles&index=19&posnr=708
Gužvica, Stefan, 2020. Jugoslavija ili Balkanska federacija? Dileme jugoslovenskih komunista u doba Oktobarske revolucije [Jugoslawien oder die Balkanföderation? Dilemmas der jugoslawischen Kommunisten während der Oktoberrevolution], Tragovi, god. 4, br. 1, str. 102-133
Gužvica, Stefan, 2020. Prije Tita: frakcijske borbe u Komunističkoj partiji Jugoslavije 1936-1940. [Vor Tito: Fraktionskämpfe in der Kommunistischen Partei Jugoslawiens 1936-1940], Srednja Europa, Zagreb
Ješić, Rafajlo, 1969. „Ideološko-političke struje u radničkom pokretu Srbije 1903-1914“ [Ideologische und politische Tendenzen in der Arbeiterbewegung in Serbien 1903-1914], Tokovi revolucije, 4/1969, Beograd
Jović, Dejan, 2003. Jugoslavija: država koja je odumrla: uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije: (1974-1990) [Jugoslawien: der Staat, der starb: Aufstieg, Krise und Fall von Kardeljs Jugoslawien: (1974-1990)], Prometej, Zagreb
Kljajić-Imširović, Jelka, 1991. Od staljinizma do samoupravnog nacionalizma [Vom Stalinismus zum selbstverwalteten Nationalismus], Centar za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd
Korošić, Marijan, 1988. Jugoslavenska kriza [Die jugoslawische Krise], Naprijed, Zagreb
Marković, Sima, 1923. Nacionalno pitanje u svijetlu marksizma [Die nationale Frage im Lichte des Marxismus], Izd. Centralnog odbora N.R.P.J., Beograd
Mattick, Paul, 2007. Anti-Bolshevik Communism, Merlin Press, UK
Međedović, Šefko, 1970. „Aktuelni aspekti međunacionalnih odnosa u socijalizmu“ ; u: Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu [„Aktuelle Aspekte der inter-nationalen Beziehungen im Sozialismus“ ; in: Klasse und Nationalität im zeitgenössischen Sozialismus], 153-171, Zagreb
Nacionalno pitanje u djelima klasika marksizma i u dokumentima i praksi KPJ/SKJ [Die nationale Frage in den Werken der Klassiker des Marxismus und in den Dokumenten und Praktiken der KPJ/SKJ], 1978. Udžbenici i priručnici politologija 5, Zagreb
Our baba doesn’t say fairy tales, 2019. „How [not] to do a critique: Demystifying the anti-imperialist narrative of the collapse of Yugoslavia”, Antipolitika, br. 2, str. 118-129
Perlman, Fredy, 2003. Stalna privlačnost nacionalizma [Die anhaltende Reiz des Nationalismus], Anarhija blok 45, Beograd
Savez komunista Hrvatske, Centralni komitet, 1972. Izvještaj o stanju u Savezu komunista Hrvatske u odnosu na prodor nacionalizma u njegove redove [Bericht über die Situation im Bund der Kommunisten Kroatiens in Bezug auf das Eindringen des Nationalismus in seine Reihen], Zagreb
Sekelj, Laslo, 1990. Jugoslavija, struktura raspadanja: ogled o uzrocima strukturne krize jugoslovenskog društva [Jugoslawien, die Struktur des Zerfalls: ein Essay über die Ursachen der Strukturkrise der jugoslawischen Gesellschaft], Rad, Beograd
Simonović, Nina, 2019. „Against Every Yugoslavia: On the ideology of the transition from capitalism to capitalism, through capitalism”, Antipolitika, br. 2, str. 153-166
Socijalizam i nacionalno pitanje [Sozialismus und die nationale Frage], 1970. Centar za aktualni politički studij, Zagreb
Šuvar, Dujić und Mimica, 1970. „Odnos klasnog i nacionalnog u suvremenom socijalizmu“; u: Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu [„Das Verhältnis von Klasse und Nationalität im zeitgenössischen Sozialismus“; in: Klasse und Nationalität im zeitgenössischen Sozialismus], Zagreb
Vinaver, Vuk, 1964. „Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji (1903-1910)“ [Die sindikalistische Streikbewegung in Serbien (1903-1910),], Istorija 20. veka, 6/1964, Beograd
Vlajčić, Gordana, 1974. KPJ i nacionalno pitanje u Jugoslaviji 1919 – 1929 [Die KPJ und die nationale Frage in Jugoslawien 1919 – 1929], August Cesarec, Zagreb
1Es gab Ideen eines exklusiven kroatischen und serbischen Nationalismus, aber auch Ideen eines jugoslawischen Nationalismus, d. h. Ideen zur Schaffung einer einheitlichen jugoslawischen Nation (z. B. innerhalb der illyrischen Bewegung in Kroatien in den 1930er Jahren, die die Idee der Einheit der Südslawen oder „Illyrer“ vertrat). Es ist anzumerken, dass die Ideen der exklusiven Nationalismen oft ganz anders formuliert wurden als sie heute formuliert werden. So glaubte beispielsweise der wichtigste Ideologe des kroatischen Nationalismus im 19. Jahrhundert, Ante Starčević, dass es auf dem Balkan nur zwei slawische Völker gab – Bulgaren und Kroaten, was für ihn bedeutete, dass „Serben“ „Kroaten“ genannt werden sollten. Vuk Karadžic hingegen war der Meinung, dass alle Sprecher des štokavischen Dialekts Serben, die Sprecher des Kajkavischen Slowenen und die Sprecher des Chakavischen Kroaten seien.
2Zum Beispiel die Ideen von Ante Starčević (1823-1896) und der Angriff auf Stjepan Radić 1928 in der Vollversammlung des Königreichs Jugoslawien für das kroatische nationale Narrativ, oder die Ideen von Dositej Obradović (1739-1811), Vuk Karadžić (1787-1864) und der serbischen Revolution (1804-1835) für das serbische nationale Narrativ.
3Rosa Luxemburg warnte immer wieder vor dem Opportunismus der nationalen Politik Lenins und schrieb in ihrem Buch Die russische Revolution (1918), dass die Bolschewiki mit ihrer Ideologie der nationalen Befreiung und des Selbstbestimmungsrechts der Nationen die Ideologie der Konterrevolution sicherten und die Position der Bourgeoisie stärkten und die Position des Proletariats schwächten.
4Zur Frage des Zusammenbruchs Jugoslawiens siehe den Text „How [not] to do a critique: Demystifying the antiimperialist narrative of the collapse of Yugoslavia“ des Kollektivs Our baba doesn’t say fairy tales in der zweiten Ausgabe von Antipolitika, die Jugoslawien gewidmet ist.
5Sozialdemokratische Parteien aus anderen jugoslawischen Ländern warfen den serbischen Sozialisten vor, den anderen Balkanstaaten große Bedeutung beizumessen und die slawischen Völker unter Österreich-Ungarn nicht zu berücksichtigen. Bis zum Ersten Weltkrieg akzeptierte die SSDP das jugoslawische Nationalprogramm weder als Programm der Annäherung und Gegenseitigkeit noch als Programm für die Befreiung der Völker unter Österreich-Ungarn und ihre Vereinigung mit Serbien im Rahmen Jugoslawiens. Die serbischen Sozialdemokraten hielten an der Idee einer Balkanföderation fest, und die unter Österreich-Ungarn an Jugoslawien. Die serbischen Sozialdemokraten begründeten ihre Balkanpolitik mit der Notwendigkeit, die Balkanvölker zur Verteidigung gegen den Imperialismus, vor allem gegen Österreich-Ungarn, zu vereinen.
6Obwohl König Aleksandar vor dem Krieg die Politik eines Großserbiens befürwortete, favorisierte er während des Krieges aus strategischen Gründen die Idee eines Jugoslawiens. Um nämlich einen starken, stabilen und legitimen Staat unter einem einzigen Herrscher zu schaffen, mussten Nation und Staat gleichberechtigt sein, und deshalb musste es eine Nation geben – eine jugoslawische Nation. Obwohl die Idee des Jugoslawismus ethnische (und sogar rassische) Wurzeln hatte, weil sie auf der Vorstellung beruhte, dass es eine Art Einheit zwischen den slawischen Völkern, insbesondere den südslawischen Völkern, gibt, die zu ihrem Zusammenschluss zu einer Nation – der jugoslawischen – führt, wurde sie mit der Schaffung des Staates eher zu einem politischen Projekt, das die Anerkennung kultureller Unterschiede nicht ausschloss.
7Interessant ist, dass es seit 1918 eine südslawische kommunistische Gruppe unter der bolschewistischen Partei in Russland gab, die aus Tausenden von Slowenen, Serben, Bulgaren und Kroaten bestand und eine eigene Zeitung, Svetska revolucija [Weltrevolution], herausgab. In der Frage des politischen Systems der Nachkriegszeit spaltete sich die Gruppe bald in zwei Fraktionen: Die eine trat für Jugoslawien als Staat der Südslawen ein, die andere für eine Balkanföderation, die auch Albaner, Griechen und Rumänen und in einigen Varianten auch Ungarn umfassen sollte. Nach der Rückkehr aus Russland und unmittelbar vor der Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei Jugoslawiens (Kommunisten) akzeptierten viele von ihnen, nach der Abschaffung des Königreichs der Schs, die Idee der nationalen Einheit der Jugoslawen.
8Die KPJ verwendet in ihrer Propaganda gelegentlich den Begriff „Verlies des Volkes“, der sich auf das Königreich shs bezieht. Derselbe Begriff wurde von anderen Kommunisten für die österreichisch-ungarische Monarchie und das Russische Imperium verwendet.
9Während die Idee einer Balkanföderation im XIX. Jahrhundert unter den Sozialisten präsent war, war die vorherrschende Vorstellung einer solchen Föderation damals die einer Föderation von Gemeinden oder Kommunen unter dem Einfluss von Proudhon, des Anarchismus und des russischen populistischen Sozialismus. Die Frage nach der Methode zur Vereinigung der jugoslawischen Völker wurde von den sozialistischen Parteien erstmals 1908 im Zusammenhang mit der Frage der österreichisch-ungarischen Annexion von Bosnien und Herzegowina aufgeworfen. Die slowenischen und kroatischen Sozialisten glaubten, dass die Aufnahme weiterer slawischer Völker in die Grenzen Österreich-Ungarns deren Umwandlung in eine Konföderation der Nationen beschleunigen würde. Die serbischen Sozialisten hingegen betonten, dass die Vereinigung der jugoslawischen Völker nicht im Rahmen Österreich-Ungarns, sondern durch eine einheitliche sozialistische Politik auf dem Balkan erreicht werden könne. Bereits 1903 entwickelten sie die Idee der Balkanföderation, und 1910 wurde auf der Balkan-Konferenz der Sozialisten in Belgrad, an der Delegierte der sozialistischen Parteien Serbiens, Sloweniens, Slawoniens, Bosniens und Herzegowinas, der Türkei, Rumäniens, Griechenlands und Kroatiens sowie Delegierte der sozialistischen Organisationen Mazedoniens und Montenegros teilnahmen, die Idee der Sozialistischen Föderativen Balkanrepublik bestätigt. Allerdings gab es keine Einigung über die Methode der Vereinigung, und nur die bulgarischen und serbischen Sozialisten akzeptierten die Idee der Balkanföderation als politischen Ausdruck der Vereinigung der Balkanvölker. Die Idee wurde auch von der II. Internationale unterstützt. Nach dem Ausbruch des ersten Balkankrieges unterstützte die II. Internationale die Idee einer demokratischen Föderation der Balkanstaaten, die Serbien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, die Türkei und Albanien umfassen sollte, und schlug vor, dass die Völker unter der österreichisch-ungarischen Monarchie an der Umsetzung des Rechts auf demokratische Selbstverwaltung arbeiten sollten. So schlug die Internationale den einzelnen Nationen unterschiedliche Optionen vor und zog die staatliche Vereinigung nicht in Betracht. Die serbischen Sozialisten hielten auch während des Ersten Weltkriegs an der Idee einer Balkanföderation fest, die 1915 auf der Zweiten Sozialistischen Balkankonferenz in Bukarest bestätigt wurde. Die Sozialisten in Österreich-Ungarn näherten sich der Idee der Vereinigung durch die Sozialistische Föderative Balkanrepublik erst nach der Februarrevolution in Russland und insbesondere nach der so genannten Oktoberrevolution.
10A.d.Ü., die Biographie von Ante Ciliga – Im Land der verwirrenden Lüge kann man hier lesen.
11Vor dem Ersten Weltkrieg war Sima Marković ein revolutionärer Gewerkschafter/Syndikalist, d. h. ein Mitglied des radikalen Flügels der SSDP, der wegen seines Beharrens auf direkten Aktionen „direktaši“ genannt wurde.
12Er schrieb, dass Slowenen, Serben und Kroaten als drei Zweige einer einzigen Nationalität behandelt werden können. Ethnisch sind sie nämlich ein Volk, aber sie fühlen sich nicht mehr so, weil sie jahrhundertelang unter unterschiedlichen kulturellen, ökonomischen, politischen und sozialen Bedingungen gelebt haben. Dass sie sich nicht als eine Nation fühlen, ist außerdem die Schuld der slowenischen, serbischen und kroatischen Bourgeoisie. Im Moment sind diese drei Zweige noch nicht bereit, in einem Staat zu leben, aber sie könnten im Laufe der zukünftigen historischen Entwicklung zu einer Nation werden. In einigen seiner Schriften schreibt er, dass die Lösung der nationalen Frage im Zeitalter des Imperialismus (die Periode von den 1870er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg) unmöglich ist. Er fügt jedoch hinzu, dass diese Frage im Rahmen des Kapitalismus generell nicht gelöst werden kann.
13August Cesarec (1983-1941) war Schriftsteller, Übersetzer und Mitglied der KPJ seit deren Gründung. Vor dem Ersten Weltkrieg beteiligte er sich an der sozialdemokratischen Bewegung und war Mitglied der Nationalistischen Jugend. Im Jahr 1912 wurde er verhaftet und beschuldigt, an der Ermordung des königlichen Kommissars Slavko Cuvaj beteiligt gewesen zu sein, wofür er zu fünf Jahren und dann zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ende 1918 trat er der erneuerten Sozialdemokratischen Partei bei und entschied sich für die so genannte „Linke“, die 1919 die SRPJ(k) (ab 1920 KPJ) gründete. Im Jahr 1919 gründete und redigierte er zusammen mit Miroslav Krleža die Zeitschrift Plamen, die im August desselben Jahres verboten wurde. Im Herbst 1922 schickte ihn die KPJ als Delegierten zum IV. Kongress der Kommunistischen Internationale in Moskau. Nach dem Kongress blieb er fünf Monate in Moskau und wurde auf dem Rückweg an der Grenze verhaftet und anschließend zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Nach Bekanntwerden seiner Verhaftung und Inhaftierung forderten die Zeitungen Borba und Savremenik seine Freilassung, und Miroslav Krleža kritisierte in seinem berühmten Artikel „Der Fall August Cesarec“, der in der Zeitung Nova Evropa (Nr. 16, 1923) veröffentlicht wurde, die damaligen Zustände im Königreich. Während der NDH wurde er in Kerestinac inhaftiert, von wo aus er in einem organisierten Fluchtversuch entkam. Die Flucht scheiterte an der schlechten Organisation, und alle überlebenden Flüchtlinge wurden gefangen genommen. Einige Tage später wurden sie wegen versuchter Rebellion gegen die Regierung zum Tode verurteilt. Wahrscheinlich wurde er zusammen mit anderen Genossen am 17. Juli 1941 in der Zagreber Dotrščina erschossen.
14In den Jahren 1924 und 1925 schloss die Komintern auf Initiative von Zinoviev die HSS der Krestintern (von der Komintern gegründete Bauerninternationale) an.
15Der Delegierte der KPJ „Vladetić“ Đuka Cvijić verteidigte die KPJ und sagte, dass die Frage nicht wegen der Illegalität behandelt wurde, sondern dass die KPJ fest in Opposition zur serbischen Hegemonie, für die Revision der Verfassung und die Selbstbestimmung aller Nationen und Stämme steht.
16Zinoviev’s letzte Rede auf der Sitzung: „Radić und anderen ist es weitgehend gelungen, viele Arbeiter in ihren nationalistischen (separatistischen) Netzwerken zu fangen, weil die jugoslawische Partei die nationale Frage falsch verstanden hat… Unsere Parteien müssen wissen, dass sie nicht nur für den Achtstundentag usw. kämpfen, sondern auch dafür, die Massen unter den gegebenen Umständen zu gewinnen, sie müssen wissen, dass die nationale Frage in vielen Ländern eine unserer stärksten Waffen im siegreichen Kampf gegen das bestehende Regime ist. Zweifellos müssen unsere Parteien Arbeiterparteien bleiben, aber diese Arbeiter müssen auch wissen, wie sie auf die nationale Frage in all den Ländern, in denen sie brennend ist, richtig reagieren können. Deshalb fordern wir, dass unsere Parteien in den Ländern, in denen die nationale Frage eine große Rolle spielt, in der Lage sind, das nationale Element im Kampf gegen das bürgerliche Regime zu nutzen.“ Interessant ist, dass der Erfolg der HSS ausschließlich auf die Ausnutzung der nationalen Frage zurückgeführt wird und nicht etwa darauf, dass sich die Partei in einem überwiegend bäuerlichen Land an die Bauernschaft wendet, während die Bauernschaft bei der KPJ nie im Mittelpunkt stand.
17Zum Vergleich schrieb Sima Marković, dass der Sozialismus nicht aus flammenden nationalen Leidenschaften entwickelt werden kann, sondern aus der Demokratie.
18Die Debatte wurde in der Broschüre über die Position der Kommunistischen Internationale zum KPJ-Streit und in Bolshevik veröffentlicht. Marković wurde 1939 bei Stalins Säuberungen hingerichtet.
19Đuro Cvijić (1896-1938) gehörte wie August Cesares als junger Mann der nationalistischen Jugend an und beteiligte sich an der Ermordung des königlichen Kommissars Slavko Cuvaj, wofür er erst zu fünf und dann zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde. 1917 trat er der Sozialdemokratischen Partei Kroatiens und Slawoniens bei. Ab November 1918 wurde er Chefredakteur der sozialistischen Zeitung Sloboda, für die er mit Krleža zusammenarbeitete. Als Delegierter der Linken der Sozialdemokratischen Partei beteiligte er sich an der Vorbereitung der Dokumente für den Gründungskongress der SRPJ(k) im Jahr 1919. Am 9. August 1919 wurde er wegen seiner Beteiligung an der Diamantstein-Affäre (einem angeblichen Versuch eines kommunistischen Aufstandes im Königreich) verhaftet. Angesichts der Gefahr einer erneuten Inhaftierung emigrierte er im September nach Österreich. Zusammen mit Kamilo Horvatin war er seit der Gründung der Parteizeitung Borba im Jahr 1922 deren Herausgeber. 1923 wurde er in die Leitung der sogenannten „Linken“ der Partei gewählt und gleichzeitig für die KPJ Delegierter auf der erweiterten Tagung des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale in Moskau. Im Laufe des Jahres 1924 beteiligt sich Cvijić in Borba an der innerparteilichen Debatte über die nationale Frage, die er auch auf dem 5. erweiterten Plenum des Exekutivkomitees der Komintern erörtert. Aufgrund von Fraktionskämpfen in der KPJ entlässt die Komintern die auf ihrer Dritten Konferenz gewählte Parteiführung und ernennt Đuro Cvijić 1925 zum Sekretär der Provisorischen Führung. Auf dem Plenum des Zentralkomitees der KPJ im November 1926 wurde Cvijić zum politischen Sekretär gewählt. Im April 1928 nahm er an den Moskauer Beratungen teil, wo der Offene Brief des Exekutivkomitees der Komintern an die KPJ angenommen wurde, in dem die Fraktionen in der KPJ verurteilt wurden. Er war einer der ersten, der diesem Brief zustimmte. 1928 wurde Cvijić als Chefredakteur von Borba verurteilt. Es wurden 32 Anklagen gegen ihn erhoben, und er wurde wegen der in Borba geschriebenen Artikel zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Intervention von Miroslav Krleža wurde er 1931 freigelassen. Nach dem von der KPJ unterstützten „Velebit-Aufstand“ der Ustascha in den Jahren 1933-1934 gab Cvijić auf Anweisung der Partei die Zeitung Hrvatski put (Der kroatische Weg) heraus, die das Organ der im Lande gebildeten sogenannten nationalrevolutionären Gruppen war. Aufgrund seiner Opposition zur Führung wurde er 1937 aus der Partei ausgeschlossen. Bei Stalins Säuberungen in der so genannten Sowjetunion wurde er 1938 liquidiert.
20Die KP Kroatien und die KP Slowenien wurden 1937 gegründet, die KP Mazedonien und die KP Bosnien und Herzegowina 1943, die KP Serbien 1945. Die KP Kosovo und die KP Vojvodina wurden 1944 als Provinzkomitees der KPJ gegründet, die ab 1945 Teil der KP Serbiens sein werden. Spezielle Parteiorganisationen, d. h. der Bund der Kommunisten (SK) des Kosovo und die SK Vojvodina, wurden erst 1968 gegründet.
21Die Vereinigte Opposition oder die Liste der Nationalen Opposition des Blocks der Volksvereinigung war eine politische Liste, die bei den Wahlen für die Abgeordneten des Königreichs Jugoslawien 1935 gegen die regierende Jugoslawische Nationalpartei antrat. Die Liste bestand aus folgenden Parteien: der Bauern-Demokraten-Koalition, der Jugoslawischen Muslimischen Organisation, einem Flügel der Demokratischen Partei (Ljubomir Davidović) und einem Teil der Agrarpartei. Die Liste wurde von Vlatko Maček angeführt. Die Vereinigte Opposition befürwortete eine föderalistische Organisation des Königreichs Jugoslawien.
221936 wurde Tito zum organisatorischen Sekretär des Zentralkomitees der KPJ und zum Stellvertreter von Milan Gorkić ernannt, der Generalsekretär wurde. Im Mai 1937 bildete Tito die provisorische Verwaltung des Landes. Milan Gorkić, mit bürgerlichem Namen Josip Čižinski (1904-1937), war von 1936 bis 1937 Generalsekretär der KPJ. Im Alter von 17 Jahren wurde er Sekretär des SKOJ-Bezirkskomitees für Bosnien und Herzegowina, im Alter von 18 Jahren war er stellvertretender Chefredakteur der Gewerkschaftszeitung Radničko Jedinstvo. Im Jahr 1923 verließ er heimlich das Land und nahm am Zweiten Parteitag der SKJ in Wien teil. Von Wien aus wurde er zur Ausbildung nach Moskau geschickt. Er arbeitete im Apparat der Komintern und übernahm verschiedene Aufgaben. Zwischen 1928 und 1935 war Gorkić der organisatorische Sekretär der Kommunistischen Jugendinternationale. Er verfasste zahlreiche Broschüren und Artikel in verschiedenen Zeitschriften. Als Instrukteur der Kommunistischen Internationale reiste er in verschiedene europäische Länder. Im September 1936 entlässt das Exekutivkomitee der Komintern alle Mitglieder des Zentralkomitees der KPJ außer Gorkic. Am 9. September 1936 wurde er zum Generalsekretär der KPJ ernannt, während Josip Broz organisatorischer Sekretär wurde. Im Jahr 1937 wurde er nach Moskau eingeladen, wo er im Juli oder August verhaftet wurde. Angeblich wurde er als Gestapo-Spion angeklagt und anschließend liquidiert.
23Aus Gründen des Kontextes ist es notwendig, kurz auf die Politik des Königreichs in dieser Zeit einzugehen. Die Befürchtung, dass interne Spaltungen in der kroatischen Frage in Verbindung mit dem Einfluss externer Kräfte (vor allem des faschistischen Italiens) zu einer Bedrohung für das Überleben und die Sicherheit des jugoslawischen Staates werden könnten, veranlasste Fürst Pavle I. (der nach der Ermordung Alexanders von 1934 bis 1941 Regent des Königreichs war) und die politische Elite, das konstitutive Konzept der nationalen Einheit zugunsten eines Kompromisses mit dem kroatischen Konzept der Nation zu ändern. Das bisherige Konzept der nationalen Einheit, demzufolge der jugoslawische Staat eine einzige jugoslawische Nation darstellt, wurde im August 1939 durch eine Vereinbarung zwischen der Krone und kroatischen Politikern unter der Führung von Vladko Maček aufgegeben. Mit diesem Abkommen wurde die autonome Banovina von Kroatien innerhalb des Königreichs Jugoslawien gebildet. Historikern zufolge verringerten sich durch dieses Abkommen die Spannungen zwischen den „Kroaten“ und anderen Teilen der südslawischen Völker, die kroatische Frage wurde ad acta gelegt und zwei radikale Optionen für die Zukunft Jugoslawiens wurden kurzzeitig ausgeschaltet: die Doktrin des radikalen jugoslawischen Integralismus und die Doktrin des kroatischen Separatismus. Es reduzierte auch die Präsenz radikaler antijugoslawischer, antiserbischer und antikroatischer Rhetorik in der Öffentlichkeit. Andererseits wurde durch das Abkommen ein Konzept gefördert, das mit der ursprünglichen Idee der Identität des jugoslawischen Staates und der jugoslawischen Nation nicht mehr vereinbar war.
24Zitiert nach: Šuvar, Dujić i Mimica: Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu [Die Klasse und das Nationale im zeitgenössischen Sozialismus], Zagreb: Naše teme, 1970.
25Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde Bosnien und Herzegowina als gemeinsames Territorium zweier Nationen betrachtet – der Serben und der Kroaten sowie der Muslime, die vor dem Zweiten Weltkrieg von der KPJ als separate ethnische Gruppe ohne die Merkmale einer Nation betrachtet wurden. Im Mai 1968 vertrat das Zentralkomitee von Bosnien und Herzegowina die Auffassung, dass sich die Muslime zu einer Nation entwickelt hätten, was 1971 in der neuen jugoslawischen Verfassung bestätigt wurde. Es sollte betont werden, dass einige Republiken mehrere konstituierende Nationen hatten, z. B. war Kroatien ein Nationalstaat aus Kroaten und Serben, während Bosnien und Herzegowina eine Nation aus Serben, Kroaten und Muslimen war.
26Mit der Verabschiedung der Verfassung von 1963 wurde es in Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien umbenannt.
27Entgegen der Tendenz der offiziellen Politik, die in dieser Zeit die Identifizierung als „Jugoslawe“ als Ausdruck der Loyalität zum sozialistischen Jugoslawien förderte, was ab 1960 nicht mehr der Fall sein wird, wird diese Identifizierung gerade in der nächsten Zeit zunehmen und in den 80er Jahren ihren Höhepunkt erreichen.
28In der RSFSR gab es auch autonome Republiken, die jedoch nicht das gleiche symbolische Gewicht hatten wie Kosmet und Vojvodina für Serbien.
29Siehe die Erklärung der Kommunistischen Partei Kroatiens, in: Die nationale Frage in den Werken der Klassiker des Marxismus und in den Dokumenten und Praktiken der KPJ/SKJ, Zagreb: Udžbenici i priručnici politologija 5, 1978.
30In der zweiten, geänderten Auflage von 1957 kritisiert Kardelj Stalin und behauptet im Gegensatz zu ihm, die nationale Frage sei nicht nur eine Frage der Bauernschaft, sondern der gesamten Gesellschaft – des städtischen petite und mittel Bourgeoisie der unterworfenen Nation und der Intelligenz, die beide in den nationalen Befreiungsbewegungen eine Rolle spielen.
31Ein Beispiel für eine solche Haltung geben Šuvar, Dujić und Mimica in „The relationship between the class and the national in contemporary socialism“; in: Die Klasse und das Nationale im zeitgenössischen Sozialismus, Zagreb 1970: „Nationalismus ist die Theorie und Praxis der Unterordnung des Klasseninteresses unter das nationale Interesse, ihre Trennung und gegenseitige Aufhebung.“
32Als Tito gezwungen war, die MASPOK zu kritisieren, betonte er mehr als je zuvor, dass er ein Kroate sei. Angeblich hatte das MASPOK ein kleines Liedchen auf Tito: „Druže Tito / ich küsse dich auf die Stirn / komm zieh dir / einen Ustascha-Anzug an“.
33Das Garantieren oder Verweigern bestimmter Rechte für einzelne Gruppen wurde häufig mit dem Ausmaß der Kriegsbeteiligung dieser Gruppe begründet. So war zum Beispiel eines der Hauptargumente gegen die Gründung der Republik Kosovo im Jahr 1945 die geringe Beteiligung von Kosovo-Albanern an den Partisanen.
34Seit dem achten Kongress, dann intensiv während der Verfassungsdebatte bis zur Spaltung des SKJ im Januar 1990, gibt es Debatten zwischen den Anhängern von Kardeljs Konzept und den Befürwortern des früheren Konzepts des sozialistischen Jugoslawiens. Die Frage ist jedoch, wie grundlegend unterschiedlich diese beiden Konzepte waren, da beide auf der Errichtung und Stärkung ethnisch definierter Nation-Staaten beruhen.
35Vinaver, Vuk, 1964. „Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji (1903-1910)“ [Die sindikalistische Streikbewegung in Serbien (1903-1910)], Istorija 20. veka, 6/1964, Beograd, str. 37.
36Ješić, Rafajlo, 1969. „Ideološko-političke struje u radničkom pokretu Srbije 1903-1914“ [Ideologische und politische Tendenzen in der Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter in Serbien 1903-1914)], Tokovi revolucije, 4/1969, Beograd, str. 101.
37Marx, Das Kommunistische Manifest, Grundrisse, etc.
]]>
Aus der letzten Ausgabe von Antipolitik, der Nummer Drei, die Übersetzung ist von uns. Mehr Texte gegen den Nationalismus.
(Antipolitika # 3) Jungslawen und nihilistischer Nationalismus 1907-1914
1.
Die Jungslawen waren die jungen jugoslawischen revolutionären Nationalisten aus Bosnien und Kroatien, die sich in den Jahren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg politisch entwickelten.
Weil sie so sehr von den europäischen nationalistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts inspiriert waren und weil es unter ihnen einen starken deutschen intellektuellen Einfluss gab, gab der Historiker Milorad Ekmečić ihnen den Namen „Jungslawen“.
Heute ist die bekannteste und am meisten geschätzte Sektion dieser Bewegung das Mlada Bosna (Junges Bosnien), eine Gruppe, die 1914 das Attentat auf Franz Ferdinand in Sarajewo verübte. Viele Anarchisten und Anarchistinnen auf dem Balkan sind heute bereit, auf die anarchistischen Einflüsse dieser Gruppe hinzuweisen oder sie sogar zu Anarchisten und Anarchistinnen zu erklären, obwohl die Mitglieder von Mlada Bosna (A.d.Ü., ab hier Junges Bosnien oder JB) den Anarchismus zugunsten des Nationalismus klar ablehnten.
Mit diesem Text soll versucht werden, diese Verwirrung zu beseitigen.
Um besser zu verstehen, was die Jungslawen waren, werden wir mit einigen Aspekten der Geschichte Serbiens, Kroatiens und Bosniens beginnen und dann die Ideen untersuchen, die die jugoslawische revolutionäre nationalistische Bewegung zu Beginn des 20sten Jahrhunderts beeinflussten.
2.
In dem von 1804 bis 1835 andauernden Prozess, den Leopold von Ranke als „Serbische Revolution“ bezeichnete, wurde Serbien als de facto unabhängiger Staat gegründet, und diese Unabhängigkeit wurde auf dem Berliner Kongress 1878 offiziell anerkannt.
Während dieses Prozesses wurden die feudalen Verhältnisse in Serbien abgeschafft und erste Versuche unternommen, ein liberales Verfassungssystem zu etablieren. Es wurden einige politische Parteien gegründet, die in einem ungleichen Verhältnis zu den oft autokratisch gesinnten Herrschern (zunächst Fürsten, später Könige) der beiden rivalisierenden Dynastien (Obrenović und Karađorđević) standen.
Die bei weitem zahlreichste Klasse in Serbien waren die Kleinbauern, die kleine Grundstücke besaßen. Aus der kleinen Zahl der Gebildeten bildete sich eine neue herrschende Klasse: die Bürokratie. So schrieb Bakunin in seinem Buch Staatlichkeit und Anarchie (1873) über die serbischen Bürokraten:
„Solange sie jung und noch nicht durch den Staatsdienst korrumpiert sind, zeichnen sich diese Individuen größtenteils durch glühenden Patriotismus, Liebe zum Volk, einen recht aufrichtigen Liberalismus und neuerdings sogar durch das Bekenntnis zu Demokratie und Sozialismus aus. Sobald sie jedoch in den Staatsdienst eintreten, macht sich die eiserne Logik ihrer Position, die Kraft der Umstände, die bestimmten hierarchischen und profitablen politischen Beziehungen innewohnt, bemerkbar, und die jungen Patrioten werden von Kopf bis Fuß zu Bürokraten, während sie vielleicht weiterhin sowohl Patrioten als auch Liberale sind. Aber jeder weiß, was ein liberaler Bürokrat ist; er ist unvergleichlich schlimmer als eine einfache und geradlinige bürokratische Geißel.“
1903 wurde König Aleksandar Obrenović, der ein pro-österreichischer Autokrat war, von einer Gruppe von Verschwörern ermordet, die alle Offiziere des serbischen Militärs waren. Petar Karađorđević (aus der rivalisierenden Dynastie) wurde König. Während dieser ganzen Zeit war die vorherrschende politische Partei die Radikale Volkspartei, die die Ermordung unterstützte und versuchte, Serbien enger an Russland und Frankreich anzugliedern.
Dieses Ereignis führte zu großen Spannungen zwischen dem österreichisch-ungarischen Kaiserreich und Serbien. Diese Spannungen wurden durch eine Reihe von Ereignissen weiter verschärft, wie z.B.: der so genannte „Schweinekrieg“ 1906-1908, ein Handelskrieg, in dem Österreich-Ungarn ein Handelsembargo gegen Serbien verhängte; die einseitige Annexion Bosniens durch Österreich-Ungarn im Jahr 1908 (serbische Nationalisten betrachteten Bosnien als serbisches Land, und dieser Schritt wurde von den europäischen Mächten als illegal angesehen); und die unerwarteten Siege Serbiens in den Balkankriegen 1912-1913 mit der anschließenden territorialen Expansion Serbiens auf Kosten der Türkei.
3.
Der Nationalismus entwickelte sich in Kroatien unter Bedingungen, die vor allem durch die Tatsache bestimmt und begrenzt waren, dass Kroatien ein Gebiet innerhalb des Kaiserreichs Österreich-Ungarn war. Im Jahr 1867 wurde das Habsburger Reich als Kaiserreich Österreich-Ungarn reformiert. Mit dem so genannten „österreichisch-ungarischen Kompromiss“ wurde das Kaiserreich zu einer Doppelmonarchie, einem Bündnis zweier souveräner Staaten. Im darauf folgenden Jahr, 1868, wurde der „Kroatisch-Ungarische Ausgleich“ geschlossen, mit dem ein weiterer Dualismus eingeführt wurde, diesmal im ungarischen Teil des Kaiserreiches. Im kroatischen Verständnis dieses Kompromisses sollte Kroatien als ein Staat und eine Nation gesehen werden, die in einem Bündnis mit Ungarn steht, das wiederum als größere Einheit in einem Bündnis mit Österreich steht. Da die ungarische Seite eine andere Auffassung von der Regelung hatte, führte dies zu nationalistischen Spannungen.
Kroatien hatte ein Parlament, eine Regierung und einen ernannten „Ban“ – praktisch einen Premierminister.
Die verschiedenen politischen Parteien, die sich in Kroatien bildeten, wurden in der Regel durch ihre Ansichten über den Vergleich von 1868 bestimmt. Eine weitere entscheidende Frage war die nach der großen serbischen Bevölkerung in Kroatien.
Die kroatischen Nationalisten näherten sich dieser Frage auf unterschiedliche Weise, aber es gab zwei Hauptströmungen des Denkens.
Zum einen gab es die ilirische und später jugoslawische Bewegung der Volkspartei, später der Unabhängigen Volkspartei und noch später der Progressiven Jugend und anderer Gruppen. Nach dieser Auffassung waren die Kroaten und die Serben Kroatiens Teil ein und derselben Nation, die als jugoslawisch bezeichnet werden sollte. In Übereinstimmung mit dieser Idee traf das kroatische Parlament verschiedene Entscheidungen, wie z. B. 1861, als es beschloss, dass die Amtssprache Kroatiens jugoslawisch genannt werden sollte.
Im Gegensatz dazu bestand der zweite Strang, der von dem kroatischen nationalistischen Ideologen Ante Starčević verkörpert wurde, auf der Bedeutung der Beibehaltung des kroatischen Nationalnamens und der „historischen Rechte“, die diesem Namen zugeschrieben wurden. Nach dieser Auffassung gab es auf kroatischem Gebiet keine serbische Nationalität. Die Serben als solche wurden jedoch nicht abgelehnt. Starčević (dessen Mutter Serbin war) betrachtete die Serben als Kroaten. Tatsächlich betrachtete Starčević auch alle slawischen Einwohner Serbiens, Bosniens und Montenegros als Kroaten. Starčević und seine Anhänger gründeten die Partei der Rechten, die später viele verschiedene Fraktionen hatte, die sich alle unter dem Namen „Rechte“ zusammenfassen lassen, im Gegensatz zu den jugoslawisch orientierten „Progressiven“.
4.
1878 beschloss derselbe Kongress in Berlin, der die Unabhängigkeit Serbiens (und Montenegros) anerkannte, dass Bosnien, obwohl es offiziell immer noch zur Türkei gehörte, von Österreich verwaltet werden sollte.
Von allen Gebieten, die später zu Jugoslawien gehören sollten, war Bosnien vielleicht dasjenige, das sich am deutlichsten in einer kolonialen Position befand. Das alte, vom Osmanischen Reich geschaffene Feudalsystem war noch in Kraft, und das Gebiet wurde von einem von Österreich ernannten Gouverneur verwaltet.
Im Jahr 1914 gab es in Bosnien 93.336 Leibeigenenfamilien. Die orthodoxe Bevölkerung, die mehr als 40 % der Gesamtbevölkerung ausmachte, kontrollierte nur 6 % des Bodens. Mehr als 90 % des Landes hatten muslimische Eigentümer – was natürlich nicht bedeutet, dass alle Muslime Landbesitzer waren. Andererseits bestand der größte Teil der staatlichen Bürokratie aus Ausländern. Die Minderheit der Einheimischen, die vom Staat beschäftigt wurden, waren fast ausschließlich Katholiken.
Das bedeutet, dass die Serben von den drei in Bosnien lebenden ethnischen Hauptgruppen die am meisten entfremdete Gruppe waren. Dennoch setzte sich die nationalistische Jugendbewegung, die sich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entwickelte, aus Angehörigen aller drei Ethnien zusammen und stand den jungen Nationalisten aus Kroatien persönlich und ideologisch nahe.
5.
Obwohl die jungen Nationalisten aus Bosnien (Junges Bosnien, JB) und Kroatien (Junges Kroatien, JK) eng miteinander verbunden waren, kann man nicht sagen, dass sie ein direktes Gegenstück in Serbien hatten.
Das, was einem jungen Serbien am nächsten kam, war eine Gruppe von Studenten, die sich um die Zeitschrift Slovenski Jug (Slawischer Süden) scharte, die 1903 veröffentlicht wurde. Die Gruppe wurde von Ljubomir Jovanović – Čupa angeführt, der einer der Anführer der Studentendemonstrationen gegen König Aleksandar im Jahr 1903 war und von einem der Ideologen der JB, Vladimir Gaćinović, als „Mazzini des jungen Serbiens“ bezeichnet wurde. Aber dies war offensichtlich eine ältere Generation als JB und JK.
Zu der Zeit, als die Jungslawen in Serbien aktiv waren und Verbindungen knüpften, gab es in Serbien noch keine entsprechende Gruppe. Was es dort gab, war eine Gruppe nationalistischer Offiziere, die sich 1903 zu einem Attentat auf den König verschworen hatten und nun einen Geheimbund mit dem Namen „Vereinigung oder Tod“ gründeten, besser bekannt als die Schwarze Hand.
Dies ist die Gruppe, mit der die Jungslawen in Serbien eine enge Verbindung eingingen. Die Gruppe von Čupa bildete den zivilen Teil der Schwarzen Hand. Sein Enthusiasmus für und sein Wissen über europäische nationalistische Geheimgesellschaften des 19. Jahrhunderts, wie die Carbonari, lieferte eine nützliche Vorlage für die Gründung der Schwarzen Hand sowie für ihre geheimen Rituale und Schwüre.
6.
Junges Bosnien als konkrete Organisation gab es nicht. Was es gab, waren viele Geheimklubs, die überall dort gegründet wurden, wo es in Bosnien Gymnasien gab. Der Name „Junges Bosnien“ wurde eher als Bezeichnung für eine Generation oder ein bestimmtes Milieu verwendet.
Die ersten Klubs dieser Art wurden im Gymnasium von Mostar gegründet. Sie wurden 1905 gegründet, einer von Dimitrije Mitrinović (dem späteren Hauptideologen von JB) und der andere von Bogdan Žerajić (dem späteren Märtyrer von JB). Schon bald verbreiteten sich die Gruppen in ganz Bosnien, und eine der wichtigsten Gruppen wurde 1911 in Sarajewo gegründet und nannte sich „Serbo-kroatische Fortschrittsorganisation“. Gavrilo Princip wurde ihr Mitglied.
1912 schrieb und veröffentlichte Dimitrije Mitrinović ein Programm mit dem Titel „Programm des Jugendclubs Nationale Vereinigung“ (eine solche Gruppe existierte nicht), und die Jungslawen-Gruppen in Bosnien und Kroatien machten es sich zu eigen.
7.
Im Gegensatz zu JB gab es eine konkrete Gruppe namens Junges Kroatien.
Dabei handelte es sich um eine Gruppe „rechter“ Jugendlicher, die sich 1910 von der Hauptpartei der Rechten abspaltete und die gleichnamige Zeitschrift herausgab. Sie begannen, sich von der älteren Generation abzugrenzen, ähnlich wie die Jungslawen in Bosnien, indem sie militantere Methoden des Kampfes annahmen und propagierten. Für eine Gruppe, die aus dem rechten Milieu stammte und sogar mit der am stärksten antiserbischen und chauvinistischen Fraktion dieser Bewegung um Josip Frank verbündet war, begannen sie, sich mehr und mehr für die Idee einer jugoslawischen kulturellen Zusammenarbeit zu öffnen, auch wenn sie vorerst noch ein exklusives kroatisches nationalistisches Programm vertraten, demzufolge in Kroatien und Bosnien nur die kroatische Nation existierte.
Dennoch gab es offensichtliche Widersprüche in der Gruppe, was sich daran zeigt, dass sowohl Mile Budak (ein schrecklicher Schriftsteller und zukünftiger Ustascha) als auch Tin Ujević (ein genialer Dichter und zukünftiger jugoslawischer revolutionärer Nationalist, der mit der Schwarzen Hand verbündet war) Mitglieder waren.
Dies ist jedoch nur ein engerer Rahmen, in dem der Name Junges Kroatien verwendet werden kann.
Die umfassendere Art ist die Bezeichnung einer neuen Bewegung, die sich in Kroatien vor allem während der Balkankriege (1912-13) entwickelte und die sich sowohl aus Teilen der rechten Jugend (wie der Ujević-Gruppe in der JK), die die jugoslawische nationalistische Position vertraten, als auch aus Teilen der pro-jugoslawischen „progressiven“ Jugend, die militantere Kampfmethoden anwandten, zusammensetzte. Diese neue Gruppierung wurde zu Junges Kroatien, die das direkte Gegenstück zu Junges Bosnien war und sich als die jugoslawische revolutionäre nationalistische Jugend verstand.
8.
In Serbien wurde bereits 1902 eine geheime Gruppe als „Privatinitiative“ gegründet, die als „Mazedonisches Komitee“, „Serbisches Komitee“ usw. bezeichnet wurde. Die Gruppe wurde von der militanten mazedonisch-bulgarischen Gruppe VMRO (Interne Mazedonische Revolutionäre Organisation) inspiriert, die den Guerillakrieg in Mazedonien, damals noch ein Teil der Türkei, koordinierte.
Das Ziel der Gruppe war es, proserbische Tschetnik-Kommandos zu organisieren, die als paramilitärische Formation den nationalistischen Interessen der serbischen Bourgeoisie dienen sollten, ohne offiziell an den serbischen Staat gebunden zu sein.
Bald wurde diese Gruppe vollständig vom Staat übernommen und existierte als geheime Organisation mit dem Namen „Serbische Verteidigung“, die sowohl ein nachrichtendienstliches Netzwerk als auch eine Struktur für den organisierten Guerillakrieg in Form von Tschetnik-Kommandos war.
Als Österreich 1908 beschloss, Bosnien zu annektieren – was bedeutete, dass es aufhörte, so zu tun, als würde es die Souveränität der Türkei über Bosnien anerkennen, und es einfach offen zu seinem eigenen Territorium erklärte – führte dies zu großen Spannungen innerhalb Serbiens.
Dies führte zu großen Spannungen in Serbien. Der Schritt wurde als große Provokation gegen die serbischen Interessen angesehen und eine intensive nationalistische Mobilisierung wurde in Gang gesetzt. Es wurde offen darüber spekuliert, dass ein Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Serbien ausbrechen könnte.
Unter diesen Umständen wurde die „Serbische Verteidigung“ in „Nationale Verteidigung“ umbenannt und als öffentliche nationalistische politische Organisation reorganisiert. Die Nationale Verteidigung war zuständig für öffentliche nationalistische Veranstaltungen und für die Rekrutierung von Menschen in Tschetnik-Kommandos zur Vorbereitung auf einen möglichen Krieg. Bald wurde die Organisation zu einer Massenorganisation.
Doch die serbische Bourgeoisie beschloss, dem Beispiel der Großmächte zu folgen, von einer kriegsbereiten nationalistischen Position abzurücken und sich mit der Annexion zu arrangieren. Dies wurde von den extremeren nationalistischen Kreisen in Serbien als Verrat angesehen.
9.
Die extremeren nationalistischen Kreise waren vor allem im serbischen Militär einflussreich. Bald beschloss eine Gruppe jüngerer Verschwörer und Attentäter aus dem Jahr 1903, dass die Regierung aus schwachen Männern und Verrätern bestehe und dass es an ihnen sei, zu handeln.
Ihre Organisation wurde in den Jahren 1910-11 unter dem Namen „Vereinigung oder Tod“ formalisiert und besser bekannt als die Schwarze Hand.
Die Schwarze Hand war ein extrem nationalistischer Geheimbund mit einigen protofaschistischen Elementen. Obwohl sie nicht öffentlich auftrat, beschloss sie, eine Zeitung mit dem Namen Pijemont (benannt nach dem italienischen Staat Piemont, der als der Staat angesehen wurde, der den Prozess der italienischen Einigung anführte) zu gründen, die ihren Zielen dienen sollte. Die Zeitung wurde von Čupa herausgegeben, der auch viele freimaurerische Einflüsse in die Gruppe einbrachte.
Die von der Gruppe propagierte Ideologie war ein extremer Nationalismus und eine offene Propagierung des Kultes der Nation und des Staates. Sie befürworteten die Aufhebung von Freiheiten, Menschenrechten und Demokratie, um die Interessen der Nation zu schützen. In ihrer Ideologie wurde die jugoslawische Idee oft mit der Idee eines Großserbiens verbunden.
Angeführt wurde die Gruppe von dem fanatischen und skrupellosen Oberst Dragutin Dimtrijević – Apis, der als graue Eminenz des serbischen politischen Lebens galt und von den Politikern gefürchtet wurde. Seine rechte Hand war Voja Tankosić, der wichtigste Tschetnik-Kommandant und Organisator von Tschetnik-Ausbildungslagern. Tankosić wurde von seinen Zeitgenossen als ein dummer Mann beschrieben, der dafür bekannt war, Deserteure und feindliche Soldaten persönlich mit einem Messer zu töten.
Die Schwarze Hand hatte eine wirksame Kontrolle über die Tschetnik-Organisation und platzierte ihre Mitglieder in einflussreichen Positionen innerhalb der Nationalen Verteidigung.
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Nationale Verteidigung weiterhin als Geheimdienstorganisation genutzt wurde, ein Netzwerk von Agenten, das eng mit der Tschetnik-Organisation und dem serbischen Staat zusammenarbeitete. Aber jetzt bekam die Nationale Verteidigung ihr paralleles Geheimnis, wir können sagen ein „tiefes staatliches“ Zentrum, das von der Schwarzen Hand kontrolliert wurde und von dem viele seiner Mitglieder nichts wussten.
Ab 1908 konzentrierte sich die Nationale Verteidigung zunehmend auf Bosnien und baute dort ihr Agentennetz aus. Nach den Siegen der serbischen Armee in den Jahren 1912-13, nach denen der serbische Staat die Kontrolle über große Teile Mazedoniens übernahm, verlagerte sich der Schwerpunkt vollständig auf Bosnien. Die Schwarze Hand war in der Lage, die von der Nationalen Verteidigung aufgebauten Netzwerke zu nutzen, ohne dass die serbische Regierung davon wusste. Genau über diese Kanäle wurden Mitglieder des Jungen Bosnien nach Sarajewo geschickt, um Franz Ferdinand zu ermorden.
Die Siege in Mazedonien bedeuteten nicht, dass die Spannungen zwischen der Schwarzen Hand und der serbischen Regierung verschwanden. Die Militärbehörden in den neu eroberten Gebieten Mazedoniens und des Kosovo, zu denen viele Mitglieder der Schwarzen Hand gehörten, weigerten sich, die Vormachtstellung der zivilen Behörden anzuerkennen, und diese Gebiete wurden als besetzte Gebiete von den Militärs regiert. In dieser Zeit wurde Apis‘ Macht offiziell anerkannt, als er die Position des Leiters des serbischen militärischen Geheimdienstes übernahm.
10.
Für die Jungslawen in Kroatien und Bosnien wurde Serbien immer attraktiver. Es war ein unabhängiger südslawischer Staat mit einem politischen und ökonomischen System, das den jungen Nationalisten sehr egalitär erschien, insbesondere im Vergleich zu Österreich.
Vladimir Čerina, der Anführer der nationalistischen Revolutionäre in Kroatien, sagte über die serbische Demokratie: „Serbien ist eine lebendige Demokratie, wie es sie nirgendwo in Europa gibt: Seine Sozialisten und Anarchisten sind zahlreicher als unsere Konservativen, und die Mädchen sind dort emanzipierter als hier.“ Dies war eine sehr typische Ansicht. Als die Mitglieder von JB vorübergehend in Belgrad lebten (sie wurden wegen ihrer Aktivitäten oft von bosnischen Schulen verwiesen und setzten ihre Ausbildung in Serbien fort, wo sie Beziehungen zur Schwarzen Hand knüpften), waren sie sehr beeindruckt von der egalitären Kultur in Belgrad, wo Menschen mit sehr unterschiedlichem sozialen Status in Bars zusammenkamen. Und obwohl sie nicht religiös waren, besuchten sie gerne die Liturgie in einer kleinen Belgrader Kirche namens Ružica, weil sie dort König Petar selbst bei der Messe sehen konnten.
Die Aktivitäten von JB inspirierten auch JK dazu, sich stärker in die proserbische Richtung zu bewegen. Als Bogdan Žerajić 1910 versuchte, den bosnischen Gouverneur Varešanin zu ermorden (und anschließend Selbstmord beging, wodurch er zum Märtyrer und zu einer großen Inspirationsquelle für die jungen Revolutionäre wurde), erklärte sein Freund und JB-Ideologe Vladimir Gaćinoć, dass Žerajić Varešanin töten wollte, um die kroatischen Nationalisten des 19. Jahrhundert Eugen Kvaternik und Vjekoslav Bach zu rächen. Kvaternik und Bach versuchten 1871 einen bewaffneten Aufstand gegen Österreich. Als der Versuch scheiterte, wurde Varešanin von den kroatischen „Rechten“ für ihren Tod verantwortlich gemacht. Sowohl Kvaternik als auch Bach waren enge Mitarbeiter von Ante Starčević und gehörten zu den Gründern der Partei der Rechten.
Dieses Opfer von Žerajić veranlasste junge „Rechte“ wie Tin Ujević, eine jugoslawisch-nationalistische und pro-serbische Position einzunehmen: „Die Serben schießen und rächen unsere Märtyrer“.
Aber ein wichtiger Anstoß für die proserbische Sache waren die Erfolge der serbischen Armee in den Balkankriegen – sie schufen einen proserbischen Rausch unter der Jugend sowohl in Kroatien als auch in Bosnien. Ujević verkündete: „Unsere Leute in der Monarchie begreifen nicht, wie sehr unser Serbien uns gehört, wie es hundertmal mehr, ich will nicht sagen serbisch, aber mehr kroatisch ist als Kroatien selbst, und das müssen sie begreifen, hören und sehen.“ Sein enger Mitarbeiter und ebenfalls ein ehemaliger „Rechter“, Krešo Kovačić, betonte: „Die Kroaten sollten nie vergessen, dass es einen freien kroatischen Staat gibt: Serbien, und ebenso sollte Serbien nie vergessen, dass es einen versklavten serbischen Staat gibt: Kroatien.“
Sowohl Ujević als auch Kovačić gingen nach Serbien, ebenso wie andere kroatische Jungslawen wie Vladimir Čerina, Luka Jukić, Oskar Tartaglia und Pavle Bastajić, die alle Beziehungen zur Schwarzen Hand knüpften. Wir wissen mit Sicherheit, dass Tartaglia und Bastajić Mitglieder der Schwarzen Hand wurden, dass Ujević und Kovačić eine revolutionär-nationalistische Broschüre schrieben, die vom Verlag Pijemont der Schwarzen Hand veröffentlicht wurde, und dass Luka Jukić von Voja Tankosić und seinen Tschetniks Waffen und Ausbildung erhielt. Er nutzte diese Ausbildung und die Waffen, um 1912 ein Attentat auf Ban Cuvaj in Zagreb zu verüben.
Die bosnischen nationalistischen Revolutionäre hatten eine noch engere Beziehung zur Schwarzen Hand, und nach den Erinnerungen eines von ihnen, Mustafa Golubić, „wurden alle Mitglieder des Jungen Bosnien Mitglieder der Schwarzen Hand“ – er bezog sich wahrscheinlich auf diejenigen, die nach Serbien gingen. Viele von ihnen wurden Tschetniks, gingen in die Ausbildungslager und sammelten Kampferfahrung in Mazedonien.
Einige von ihnen, wie Princip und seine Freunde, wurden von Tankosić als zu kränklich und ungeeignet für den Guerillakrieg eingestuft, aber die Tatsache, dass sie bei schlechter Gesundheit waren, über Tod und Opfer nachdachten und bereit waren, für eine nationalistische Sache zu sterben, machte sie zu sehr guten potenziellen Attentätern. Es ist unklar, ob Apis und Tankosić tatsächlich glaubten, dass das Attentat auf Franz Ferdinand erfolgreich sein würde. Es wurde spekuliert, dass sie tatsächlich glaubten, Princip und seine Freunde würden scheitern und dies würde die serbische Regierung, die die Schwarze Hand als ihren Feind betrachtete, in Verlegenheit bringen. Auf jeden Fall versorgten sie die Attentäter von Junges Bosnien mit Zyanidkapseln, damit sie nach dem Attentat Selbstmord begehen konnten.
11.
Die Ideologie der Jungslawen war in erster Linie von den nationalistischen Bewegungen inspiriert, die zu den Vereinigungen Deutschlands und Italiens führten. Die Anarchistinnen und Anarchisten, die Linken sowie die Nationalisten, die heute die Jungslawen bewundern, verleugnen, was der Kern ihrer Ideologie war: der Liberalismus.
Die Jungslawen hatten verschiedene ideologische Einflüsse, aber diejenigen, die ihre Ziele definierten – die Gesellschaft, die sie in der Zukunft sehen wollten – waren liberal.
So veröffentlichten sie zum Beispiel eine Broschüre des in Wien lebenden Anarchisten und Anarchisten Pierre Ramus Die Lüge des Parlamentarismus. Und das war tatsächlich eine anarchistische Kritik am Parlamentarismus als solchem. Aber wenn sie selbst über den Parlamentarismus schrieben, wie er in Bosnien oder Kroatien existierte, schrieben sie nicht über die Lüge des Parlamentarismus (auf serbokroatisch: „laž parlamentarizma“), sondern über den falschen Parlamentarismus (auf serbokroatisch: „lažni parlamentarizam“).
Immer wieder kamen sie zu dem Schluss, dass sie revolutionäre Mittel wählten, weil es sinnlos sei, in einem Land mit Scheindemokratie wie Bosnien parlamentarische Mittel des politischen Kampfes einzusetzen. Andererseits hielten sie das parlamentarische System, das in Serbien in Kraft war, für authentisch und attraktiv.
Darüber hinaus glaubten sie, dass die sozialen, ökonomischen und politischen Probleme, mit denen sie konfrontiert waren, automatisch gelöst würden, wenn auf den Trümmern des österreichischen Kaiserreichs ein jugoslawischer Nation-Staat gegründet würde, der sowohl das landwirtschaftliche als auch das parlamentarische System, das in Serbien (dem Kerngebiet dieses neuen Staates) existierte, einführen würde.
12.
Es bedurfte einer gewissen kognitiven Dissonanz, um eine solche Sichtweise auf Serbien aufrechtzuerhalten.
Erleichtert wurde dies durch die Tatsache, dass die Mitglieder von Junges Bosnien nach ihren eigenen Erinnerungen, während sie in Belgrad lebten, fast ausschließlich unter sich verkehrten. Einer von ihnen, Ratko Parežanin, sagte, er habe sich während seines monatelangen Aufenthalts in Belgrad (und als Zimmergenosse von Gavrilo Prinicip) nicht nur mit keinem der dortigen Jugendlichen angefreundet, sondern nicht einmal mit einem von ihnen gesprochen. Ihre einzigen Kontakte in Belgrad waren diejenigen, die mit der Schwarzen Hand verbunden waren.
Zu dieser Zeit gab es in Belgrad junge Anarchistinnen und Anarchisten und revolutionäre Syndikalisten. Hätten die bosnischen Jungslawen Kontakte zu ihnen gehabt, hätten sie ihnen schildern können, dass sie an vielen Streiks teilgenommen haben, dass einige dieser Streiks brutal niedergeschlagen wurden und dass es in einigen Fällen Arbeiterinnen und Arbeiter gab, die vom Staat erschossen wurden, und dass ihre Freunde, die Tschetniks, manchmal zur Niederschlagung der Arbeiterbewegung eingesetzt wurden. Sie hätten ihnen auch sagen können, dass anarchistische Zeitungen vom Staat verboten wurden.
Aber da solche Gespräche nicht stattfanden, mussten sich Junges Bosnien, die anarchistische Literatur lasen und mit einigen ihrer Inhalte sympathisierten, nicht der Realität stellen, wer ihre neuen Verbündeten waren, oder sie wollten sich dieser Realität vielleicht nicht stellen. So konnten sie engste Beziehungen zur antidemokratischen und protofaschistischen Schwarzen Hand knüpfen, während sie gleichzeitig die „serbische Demokratie“ bewunderten.
Der einzige unter ihnen, der sich später als Anarchist bezeichnete, Nedeljko Čabrinović, war auch der einzige, der einige Kontakte zu den jungen Anarchisten in Belgrad hatte. Aus diesem Grund schwankte er zwischen anarchistischen und nationalistischen Positionen und wurde als solcher von Gavrilo Princip verachtet, der ihn für „nicht intelligent genug“ und „nicht national genug“ hielt, weil er früher Anarchist und Sozialist gewesen sei.
13.
Die Sympathien für einige Aspekte des Anarchismus waren echt, aber sie waren auch bewusst oberflächlich.
Die Jungslawen sahen sich selbst als Revolutionäre und suchten nach Inspirationen bei anderen Revolutionären. Damals war es für jeden, der „das politische System stürzen“ wollte, schwer, sich nicht vom Beispiel anarchistischer Revolutionäre inspirieren oder teilweise beeinflussen zu lassen.
Die Sympathien galten vor allem den damals angewandten „anarchistischen Methoden“, die manchmal sogar als „russische Methoden“ bezeichnet wurden – aber in diesen Methoden (wie z. B. Attentaten) steckte nichts Anarchistisches, und die Jugend war sich dessen bewusst.
Während seines Prozesses erklärte Princip deutlich, dass er zwar der Meinung war, dass eine Gesellschaft im Sinne Kropotkins theoretisch möglich wäre, wenn sich die Umstände ändern würden, dass dies aber nicht ihr Anliegen war: „Aber da wir Nationalisten waren und obwohl wir sozialistische und anarchistische Literatur lasen, haben wir uns nicht so sehr mit diesem Thema beschäftigt, weil wir dachten, dass wir eine andere Pflicht haben, eine nationale Pflicht.“ Er stellte auch klar, dass ihr Ziel die Errichtung eines jugoslawischen Nation-Staats war, entweder in Form einer Republik oder einer Monarchie.
Auch Nedeljko Čabrinović, der sich zumindest eine Zeit lang als Anarchist sah, formulierte es so: „Ich bin ein Anhänger der radikalen anarchistischen Idee, damit wir mit Terrorismus das gegenwärtige System zerstören und an seine Stelle ein neues, liberaleres System setzen können; deshalb hasse ich alle Vertreter des heutigen angeblich konstitutionellen Systems, nicht als Personen, sondern als diejenigen, die in der Regierung sind, die das Volk unterdrückt.“
Die Gleichsetzung von „Anarchismus“ mit einer bestimmten Form des militanten Kampfes ist hier offensichtlich, ebenso wie der zugrunde liegende Liberalismus.
14.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand, wenn man bedenkt, dass die Jungslawen der Meinung waren, dass jede Nation ihre eigene „Französische Revolution“ haben sollte, und dass sie die „Erklärung der Menschen- und Staatsbürgerrechte“ mit Begeisterung gedruckt und verbreitet haben.
Einer der historischen Einflüsse, die für die Jungslawen sehr inspirierend waren, waren die deutschen liberal-nationalistischen Studentenvereine, des 19. Jahrhunderts, die Burschenschaften. Diese hatten großen Anteil an der Märzrevolution und an der Einigung Deutschlands 1871. Sie waren liberal und extrem nationalistisch, traten für Freiheit, Rechte und Demokratie ein, schlossen aber manchmal Juden von ihrer Mitgliedschaft aus, weil sie nicht „national genug“ waren.
Das Programm von Mitrinović, das von allen Jungslawen übernommen wurde und weitgehend ihre Phraseologie bestimmte, war ebenfalls von einem unterschwelligen Liberalismus geprägt. Darin hieß es, das Ziel des „Clubs“ sei die Verbreitung des Nationalbewusstseins unter den Teilen „unserer geteilten, vielnamigen und multikulturellen Nation“, die sich ihrer nationalen Rechte, ihrer nationalen Pflichten und ihres nationalen Wertes nicht oder nicht ausreichend bewusst seien: „Alle Elemente, die nicht national genug sind, sollten unterdrückt werden (anational und antinational im materiellen und geistigen Leben unseres Volkes).“
Das Ziel dieses Programms war die Modernisierung. Für JB bedeutete „Modernisierung“ die Übernahme der Werte des liberalen Europas und seiner Kultur. Mitrinović formulierte es so: „Wir können nicht unsensibel gegenüber dem reichen und vielfältigen Leben des modernen und starken Westens sein, denn in diesem Fall wird uns dieser reiche und starke Westen, unkultiviert und unmodern wie wir sind, mit der Kraft seiner Kultur überrollen.“ Und Vaso Čubrilović, der jüngste der Angeklagten, brachte es während des Prozesses um das Attentat auf Franz Ferdinand so auf den Punkt: „Ein Nationalist kämpft dafür, dass seine Nation das Niveau der anderen Nationen erreicht, um die Nation kulturell und politisch zu erheben.“ Dieser Gedanke, das Niveau anderer Nationen zu erreichen, ist in den JB-Schriften allgegenwärtig. So sagte Danilo Ilić auch während des Prozesses: „Wenn die Deutschen es geschafft haben, eine Nation zu sein, warum können Serben, Kroaten und Slowenen das nicht auch schaffen. „
Für sie war der Nationalismus eine notwendige Bedingung für die Einführung der Demokratie, des allgemeinen Wahlrechts, der nationalen Souveränität und der Abschaffung der aristokratischen Privilegien.
15.
Wie bereits erwähnt, hegten die Jungslawen vordergründig viele Sympathien für die von Anarchistinnen und Anarchisten und nihilistischen Revolutionären verübten Attentate. Aber es gab auch ähnliche Sympathien für die Methoden der revolutionären Syndikalisten. Dieser Einfluss kam aus Frankreich und Italien, wobei Sorel eine besonders wichtige Figur war.
Die Jungslawen sympathisierten mit den außerparlamentarischen Kampfmethoden und sahen sie als potentiell nützlich in ihrem eigenen Kontext an. In der Tat war es diese Generation, die das Wort “štrajk” (Streik) im Serbokroatischen popularisierte.
Aber auch hier veränderten sich die Grundlagen und Ziele dieser Methoden: Statt sich wie die Syndikalisten auf das Proletariat und die mit jedem neuen Streik wachsende Solidarität innerhalb des Proletariats zu konzentrieren, sah die nationalistische Jugend den Streik als Methode zur Umwandlung eines anationalen Volkes in eine Nation. Anstelle eines Generalstreiks, der den Kapitalismus stürzen würde, glaubten sie an eine Revolution, die den jugoslawischen Nation-Staat schaffen würde.
Im Jahr 1911 versuchte der Gymnasiast Šćerbak ein Attentat auf einen Lehrer zu verüben, und als es ihm nicht gelang, brachte er sich um. Dies führte zum ersten “Studentenstreik” in Kroatien, an dem hauptsächlich Gymnasiasten beteiligt waren. Šćerbak war in Wirklichkeit ein Anführer einer der vielen revolutionären nationalistischen Studentengruppen. Der zweite Studentenstreik brach 1912 aus, als Ban Cuvaj begann, das politische Leben in Kroatien mit absolutistischen Methoden zu regeln. Die Studenten besetzten das Universitätsgebäude und brachten eine schwarze Fahne an. Mehr als 300 Studenten nahmen daran teil.
In Sarajevo fanden Studentendemonstrationen in Solidarität mit den Studenten in Zagreb statt. Diese Demonstrationen wurden von den “serbokroatischen” Revolutionären organisiert, denen Gavrilo Princip angehörte. Dies entwickelte sich zu einem “studentischen Generalstreik” in Kroatien und war ein wichtiger Schritt für die Verbreitung der jugoslawischen nationalistischen Idee sowie für die Annäherung der serbischen und kroatischen Jugend, einschließlich der ehemaligen “Rechten”, die nun proserbische Ansichten vertraten und sich auf eine nationale Revolution mit dem Ziel der Errichtung eines jugoslawischen Staates vorbereiteten: In ihren Augen war Ante Starčević selbst ein Jugoslawe, weil er glaubte, dass alle Serben Kroaten seien. Sie glaubten, dass die jugoslawische Idee das gleiche Programm neu formulierte, aber auf einem höheren Niveau, und nun mit revolutionären Methoden zur Verfügung stand.
16.
Die Jungslawen entwickelten ihre Ideen in einer Zeit, als die Ideen des “integralen Nationalismus” unter jungen Nationalisten populär waren. Diese aus Frankreich stammende Doktrin betonte die Bedeutung einer kulturell homogenen Nation mit einer einheitlichen Kultur.
Die Einflüsse des integralen Nationalismus machen sich besonders in der Vorstellung der Jugend bemerkbar, dass die einzelnen Teile der jugoslawischen Nation nicht isoliert überleben können und dass eine Nation, die im Entstehen begriffen oder in Gefahr ist, ihren einzelnen Mitgliedern, insbesondere der Jugend, große Opfer abverlangen muss. Nach dieser Doktrin ist moralisch, was der Nation dient.
Die Vorstellung, dass die Einheit und Homogenität einer Nation eine Voraussetzung für ihr Überleben und ihre Entwicklung ist, führte bei den Anhängern des integralen Nationalismus zu einer aggressiven Tendenz, andere Nationen zu assimilieren. Der integrale Nationalismus war ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der reaktionären Ideen in der europäischen Geschichte, eines, das eine Verbindung zwischen den liberalen extremen nationalistischen Ideen des 19. Jahrhunderts und dem Faschismus herstellte. Und genau unter jenen Intellektuellen in Frankreich und Italien, die beschlossen, Aspekte des integralen Nationalismus und des revolutionären Syndikalismus zu kombinieren, entstanden die ersten faschistischen Programme.
Die Jungslawen wurden stark von der Tendenz geprägt, die oft als “Revolte gegen die Vernunft” bezeichnet wurde. Dazu gehörte nicht nur der bereits erwähnte Einfluss von Sorel in der Art und Weise, wie er seine syndikalistischen Ideen formte und auf der Bedeutung des Mythos bestand, sondern in erster Linie der Einfluss, den Nietzsche auf sie hatte.
Die nationalistische Jugend in Bosnien und Kroatien las viel, und zwar immer, und gab alles Geld, das sie hatte, für Bücher aus (oft liehen sie sich Bücher aus kleinen Buchhandlungen, die auch als Leihbibliotheken dienten): Sie lasen beim Spazierengehen auf der Straße, während der Mahlzeiten und am Abend vor dem Schlafengehen. Einer der beliebtesten Autoren, die sie lasen, war Nietzsche. Seine Freunde sagten, dass Gavrilo Princip immer wieder Nietzsche zitierte.
Die Motive des Willens und der Entschlossenheit, der Vitalität und der Aktivität, sind bei den Jungslawen sehr stark ausgeprägt. Eines der Mitglieder sagte später, dass sich das gesamte Programm von JB in einem Wort zusammenfassen lässt: Aktion. Princip glaubte, dass für die Entwicklung eines starken Willens das Schlafen mit einer Bombe (was er praktizierte) eine viel geeignetere Methode sei als alle populären Ideen französischer Pädagogen.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Jungslawen den Ideen der avanguardistischen Kunstströmungen, insbesondere dem Futurismus und dem Expressionismus, gegenüber sehr aufgeschlossen waren.
Miloš Vidaković, ein Mitglied von Junges Bosnien, schrieb über das Futuristische Manifest, noch bevor es bekannt wurde (1909). Die Jugend begrüßte das zerstörerische Programm der Futuristen mit Begeisterung, und laut Vidaković war das Ziel der Jugend ein radikaler Kampf bis hin zur Aufopferung. In den Gedichten dieser jungen Revolutionäre sind Tod und Blut ständig präsent, ebenso wie die Idee, das ultimative Opfer zu bringen, indem man sein Leben für das Wohl der Nation aufgibt, manchmal in einem Krieg, in dem alle, auch der Dichter selbst, sterben.
Dimitrije Mitrinović ging noch einen Schritt weiter und schrieb 1913 sein eigenes futuristisches Manifest: Ästhetische Kontemplation. Mitrinović war auch derjenige, der 1912 direkte Kontakte zwischen JB und den deutschen Expressionisten herstellte.
Die Idee eines Bruchs mit den älteren Generationen, deren gemäßigte Politik die jungen Nationalisten ablehnten, passte sehr gut zum Thema des Konflikts zwischen Vätern und Söhnen, das in expressionistischen Werken oft vorkommt, sowie zu Heinrich Mans Ansicht, dass der Expressionismus ein durch Aktion gestärkter Geist” sei.
17.
Die Begeisterung der Jungslawen für die deutschnationale Bewegung wurde erwidert, als Hitler in der ersten Ausgabe von Mein Kampf über die Ermordung Franz Ferdinands in Sarajewo durch die bosnischen Jugendlichen schrieb: „Es war die Hand der Göttin der Gerechtigkeit, die den größten und tödlichsten Feind Deutschösterreichs, den Erzherzog Franz Ferdinand, beseitigt hat“.
In den späteren Ausgaben wurde dieser Satz gestrichen, und heute wird Hitlers Haltung gegenüber Junges Bosnien gewöhnlich durch ein Foto veranschaulicht, das nach der Besetzung Jugoslawiens durch die Nazis aufgenommen wurde und zeigt, wie deutsche Soldaten Hitler die Gedenktafel für Gavrilo Princip und das Attentat überreichen.
Woran Hitler in diesem Moment genau gedacht hat, lässt sich nicht sagen, aber wir können etwas über die Beziehung zwischen einigen Mitgliedern der Jungslawen und dem Faschismus sagen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die den Jungslawen angeschlossenen Individuen unterschiedliche politische Entwicklungen, aber einige sehr prominente waren mit faschistischen Bewegungen verbunden und knüpften diese Bewegungen ausdrücklich an die Ideen der Jungslawen.
Ljubo Leontić, ein wichtiger Teil der jugoslawischen revolutionären nationalistischen Jugend aus Kroatien, arbeitete mit Enthusiasmus an der Gründung einer gemeinsamen revolutionären Organisation und wurde in seinen Bemühungen durch das Attentat von Sarajevo unterbrochen (an diesem Tag organisierte Leontić ein Treffen junger Nationalisten zur Gründung einer neuen Organisation).
In den 1920er Jahren war Leontić der Anführer der ORJUNA (Organisation der jugoslawischen Nationalisten), einer faschistischen Organisation, die für die Schaffung einer integralen jugoslawischen Nation eintrat. Diese Organisation trat auch für die Errichtung eines korporatistischen Systems ein, feierte „einheimisches produktives Kapital und Arbeit“ und verurteilte das Finanz- und Spekulationskapital als parasitär und anational.
Dobrosav Jevđević, ein Mitglied von Junges Bosnien, der Princip persönlich kannte, wurde einer der Anführer der ORJUNA, insbesondere ihrer paramilitärischen Tschetnik-Kommandos, die zur Zerschlagung der Arbeiterinnen und Arbeiter eingesetzt wurden. Während des Zweiten Weltkriegs war Jevđević ein Kollaborateur.
Niko Bartulović war ein nationalistischer Revolutionär aus Dalmatien und verfasste nach dem Krieg als Mitglied der ORJUNA eine Broschüre, deren ausdrückliches Ziel es war, zu erklären, dass die faschistische Organisation ihre Wurzeln in der Jugendbewegung vor dem Ersten Weltkrieg hatte. In den 1930er Jahren tauchte in Jugoslawien eine neue faschistische Organisation auf. Es handelte sich um den Zbor, der später zur wichtigsten kollaborierenden Organisation während der Besetzung Serbiens durch die Nazis werden sollte. Einer ihrer Anführer war Ratko Parežanin, ein Mitglied von Junges Bosnien und ehemaliger Zimmergenosse von Gavrilo Princip.
Der kommunistische und antistalinistische Schriftsteller Miroslav Krleža, der viele der Jungslawen-Führer persönlich kannte, schrieb Folgendes über Vladimir Čerina, einen der Anführer der Jungslawen in Kroatien: „Seine Stimme zeigte die protofaschistischen Symptome eines hysterischen Chauvinismus.“
Es fällt schwer, Krleža zu widersprechen, wenn man bedenkt, was Čerina über den Dichter Vladimir Nazor schrieb: „Dieser Apostel unserer nationalen Energie, unseres Optimismus und unserer Religion, der Zerstörer der barbarischen Kultur und der Herold der zivilisierten Barbaren, von uns, den Erneuerern und Siegern von morgen, die feinste und leidenschaftlichste Stimme unseres Blutes und unserer Rasse, der Dichter der zukünftigen Revolution der Seelen, ein Visionär des neuen Vaterlandes, der Erleuchter des Landes und des Lebens und der Offenbarer der neuen Helden, er kommt von Gott. „
Interessant ist vielleicht auch, dass Dimitrije Mitrinović, als das Attentat 1914 geschah, die Nachricht davon in Deutschland erhielt, während er sich im Haus des deutsch-britischen Rassentheoretikers und antisemitischen Schriftstellers Houston Stewart Chamberlain aufhielt, den Mitrinović für eines seiner Zeitschriftenprojekte anzuwerben versuchte (Mitrinović war in dieser Hinsicht sehr eklektisch und versuchte, sowohl Chamberlain als auch Kropotkin für seine Ideen anzuwerben).
18.
Wie bereits erwähnt, debattierte Nedeljko Čabrinović während seines Aufenthalts in Belgrad im Gegensatz zu allen anderen Mitgliedern von Junges Bosnien mit jungen lokalen Anarchistinnen und Anarchisten und war hin- und hergerissen zwischen nationalistischen und anarchistischen Positionen.
Letztendlich kehrte er zum Nationalismus zurück, was sich vielleicht auch teilweise dadurch erklären lässt, dass er in Belgrad auch Krsto Cicvarić kennenlernte. Cicvarić war der prominenteste Verfechter des Anarcho-Syndikalismus im Serbien der Vorkriegszeit.
Zu der Zeit, als er Čabrinović traf, wechselte Cicvarić selbst zu nationalistischen Positionen und war einer der Herausgeber der von der Schwarzen Hand betriebenen Zeitung Pijemont. Doch obwohl er immer mehr nationalistische Positionen einnahm, bezeichnete er sich vorerst weiterhin als Anarchisten.
Tatsächlich versuchte Cicvarić in einer von ihm verfassten Broschüre mit dem Titel „Wie werden wir Österreich besiegen“, die er Čabrinović übergab, Anarchismus und Nationalismus zu vereinen (Čabrinović bestätigte ausdrücklich, dass er diesen Text während seines Prozesses gelesen hatte).
Dies ist ein außergewöhnlicher Text und vielleicht ein erstes Beispiel für etwas, das man als „nationalen Anarchismus“ bezeichnen kann. Darin ruft Cicvarić zu einer „gesamtserbischen Revolution“ unter Führung des „serbischen Proletariats“ (das seiner Meinung nach hauptsächlich aus Bauern besteht) auf, die eine Fortsetzung und Vollendung der serbischen Revolution vom Anfang des 19. Jahrhunderts darstellen würde. Das Ziel einer solchen Revolution sei die Errichtung eines „Großserbiens“, in dem soziale Gerechtigkeit und Gleichheit herrschen würden, ohne „Tränen und Blut“. Dies war ein klarer Versuch, anarchistisches Gedankengut mit nationalistischer Rhetorik zu verbinden, der jedoch letztlich im Nationalismus endete. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Cicvarić zu einem offenen Nationalisten, Antisemiten und Befürworter des Faschismus, und während der Besetzung Serbiens durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg war er ein Kollaborateur.
Während Čabrinović also in einem Dilemma steckte, was seinen Nationalismus einerseits und seinen Anarchismus andererseits betraf, wurde er von jemandem angesprochen (bei dem es sich möglicherweise um einen Agenten der Schwarzen Hand handelte), der ihm sagte, er könne beides sein. Unter den intellektuellen Einflüssen der Jungslawen gab es viele Beispiele für die Vermischung von Nationalismus und eher revolutionären, anarchistischen und syndikalistischen Einflüssen (in einer oberflächlichen Form), aber dieser Text war einzigartig in seinem Versuch, solche gegensätzlichen Ideen explizit zu kombinieren.
19.
Aber natürlich schlugen nicht alle Jungslawen, die den Ersten Weltkrieg überlebten, die offiziell faschistische Richtung ein.
Ein äußerst interessanter Fall ist Vaso Čubrilović. Čubrilović war der jüngste der Attentäter von Sarajevo, der vor Gericht gestellt wurde, und er wurde ein bekannter Historiker, der 1990 in hohem Alter starb.
In den 1930er Jahren wurde Čubrilović Mitglied einer nationalistischen Intellektuellengruppe, die sich „Serbischer Kulturklub“ nannte, und 1937 schrieb er für die jugoslawische Regierung ein Papier mit dem Titel „Die Vertreibung der Albaner“, in dem er wissenschaftlich Methoden für das „Albanerproblem im Kosovo“ entwickelte, indem er verschiedene Wege empfahl, um eine totale ethnische Säuberung der Albaner aus Jugoslawien durchzuführen. Einige der empfohlenen Methoden waren: gewaltsame polizeiliche Repression, Niederbrennen von Dörfern und Stadtvierteln, ökonomischer Druck, religiöse Diskriminierung und andere.
Doch im Gegensatz zu vielen anderen nationalistischen Intellektuellen unterstützte Čubrilović während des Zweiten Weltkriegs die Partisanen und nicht die kollaborierenden Streitkräfte. Nach dem Krieg wurde er 1945 Minister in der Regierung des neuen titoistischen Regimes. Bereits 1944 schrieb er eine neue wissenschaftliche Abhandlung über ethnische Säuberungen mit dem Titel „Das Minderheitenproblem im neuen Jugoslawien“, diesmal für das von der Kommunistischen Partei Jugoslawiens geführte Regime. Darin sprach er sich für die Ausweisung von Albanern, Deutschen, Italienern, Ungarn und Rumänen als „nichtnationale Elemente“ aus Jugoslawien aus und erklärte, dass der laufende Krieg der geeignetste Zeitraum für solche Lösungen sei und dass der Krieg die Möglichkeit biete, in Monaten oder einem Jahr zu erreichen, was in Friedenszeiten viele Jahre oder Jahrzehnte erfordern würde. Das neue Regime beschloss in der Tat, den größten Teil der einheimischen deutschen und italienischen Bevölkerung zu vertreiben. Obwohl es viele Repressionen gegen die albanische Bevölkerung gab, wurde die Entscheidung, den Čubrilović-Plan gegen die albanische Bevölkerung umzusetzen, erst 1999 getroffen, als es dem Milošević-Regime gelang, vorübergehend mehrere hunderttausend Albaner aus dem Kosovo zu vertreiben und Tausende von ihnen zu töten.
20.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass es mindestens ein Mitglied der Jungslawen-Generation gab, das sich nach dem Ersten Weltkrieg öffentlich vom Nationalismus lossagte und gleichzeitig den revolutionären Sozialismus annahm. Dies war Rudolf Hercigonja, der vor 1914 in Zagreb wegen seiner Zugehörigkeit zu einer revolutionären nationalistischen Gruppe vor Gericht stand, nach dem Krieg aber zum Kommunismus übertrat.
Hercigonja schrieb 1919 ein Pamphlet, in dem er sich von den jugoslawischen nationalistischen Ideen lossagte und den neuen Staat als ebenso repressiv wie das österreichisch-ungarische Kaiserreich verurteilte und ihn als großes Gefängnis bezeichnete, das gesprengt werden müsse. Er unterzeichnete den Text mit den Namen toter Genossen und Genossinnen der Jungslawen-Generation. Hercigonja gehörte zu einer kommunistischen Gruppe in Jugoslawien, die wegen ihrer antiparlamentarischen Ausrichtung manchmal als Anarchistinnen und Anarchisten bezeichnet wurde. Diese Gruppe hatte auch Kontakte zu den Rätekommunisten aus Deutschland. Nachdem die Gruppe 1921 den jugoslawischen Polizeiminister ermordet hatte, ging Hercigonja in die UdSSR, wo er bei den stalinistischen Säuberungen ermordet wurde.
21.
Miroslav Krleža schrieb, dass für Junges Bosnien der Nationalismus viel wichtiger war als die Idee der sozialen Gerechtigkeit. In seinem Roman Zastave (Fahnen) schrieb er, dass JB die serbische imperialistische Politik in Kosovo und Mazedonien unterstützte. Dem können wir sicher zustimmen, wenn wir wissen, dass viele Mitglieder sich Tschetnik-Kommandos anschlossen, die in diesen Gebieten viele Verbrechen begingen und extreme nationalistische Ziele verfolgten. Gleichzeitig waren sich diese jungen Nationalisten der arbeiterinnen- und arbeiterfeindlichen und antisozialistischen Gewalt, die dieselben Tschetnik-Kommandos in Serbien ausübten, nicht bewusst oder wollten sie ignorieren.
Die Jungslawen verbanden ihre nationalistischen Ziele vollständig mit der Verwirklichung einer Art von sozialer Gerechtigkeit. Dies zeigt sich in der Art und Weise, wie Tin Ujević über die serbischen Siege in den Balkankriegen 1912-1913 schrieb. Er charakterisierte diese serbischen Gebietserweiterungen als „Verwirklichung einer Utopie“ und „das Unmögliche wird zur Realität“.
Diese Verwirrung rührte daher, dass die Jungslawen zwar in der Lage waren, begrifflich zwischen Nation und Staat zu unterscheiden, aber nicht in der Lage waren, das richtige Verhältnis zwischen diesen beiden Phänomenen zu bestimmen.
In einem nationalistischen Rausch, der teils durch Unterdrückung und Armut, teils durch eine nihilistische Veranlagung und einen starken Todestrieb und den Willen, sich auf dem Altar des Vaterlandes zu opfern, ausgelöst wurde, überzeugten sie sich, dass die Nation die Verwirklichung einer Utopie sei.
Heute sind wir leider noch nicht über diese Verwirrung hinweg.
Vor einigen Jahren behauptete ein „serbischer Anarchist“ während einer Diskussion über das Erbe von Krsta Civarić, dass es kein Widerspruch sei, wenn Cicvarić eine nationalistische Sprache benutze, während er sich noch in seiner anarchistischen Phase befinde, und dass, wenn Cicvarić von der Schaffung von „Großserbien“ spreche, er damit „Jugoslawien“ meine, und dass beides mit der Verwirklichung der Anarchie gleichgesetzt werde (Großserbien = Jugoslawien = Anarchie). Dieser Person zufolge war das, was Cicvarić und Junges Bosnier wollten, die „Vereinigung eines Volkes zur Anarchie“ – diese Umschreibung einer soziologischen Definition einer Nation kommt einer tatsächlichen Definition der Absurdität, die der nationale „Anarchismus“ ist, am nächsten.
In den Straßen Belgrads kann man außerdem Graffiti einer antifaschistischen Gruppe sehen, auf denen steht, dass der kollaborierende Premierminister und Nazi Milan Nedić „ein Verräter“ war. Hier, mehr als 100 Jahre nach Cicvarić, sehen wir einen Versuch, libertäre Politik durch die Verwendung einer nationalistischen Sprache zu formulieren.
Dies ist ein unmögliches Ziel, und jeder Versuch, Anarchismus mit Nationalismus zu verbinden, wird nur zu Nationalismus führen.
Wir sollten in der Tat in der Lage sein, Nation und Staat begrifflich zu unterscheiden, aber nur, damit wir besser gerüstet und effektiver in der Ablehnung beider sind. Aus dem Beispiel der Jungslawen können wir lernen, dass das Hinauswerfen eines bestimmten Staates durch die Tür, während man sich immer noch den Nationalismus zu eigen macht, nur den Staat durch das Fenster zurückbringen wird. Und mit dem Staat die ganze Repression, die damit einhergeht, wie Rudolf Hercigonja auf brutalste Weise erfuhr, als er ganz Jugoslawien zu einem riesigen Gefängnis erklärte. Aus diesem Beispiel können wir auch lernen, dass, wie edel und sympathisch einige nationalistische Kämpfer auch erscheinen mögen, aufgrund der Ungerechtigkeiten, die sie ihr ganzes Leben lang als Opfer von Unterdrückung und Ausbeutung erlitten haben, und ungeachtet ihrer edlen Absichten und Illusionen, die Art und Weise, wie sie den Kampf geführt haben, und die Ziele, die sie sich selbst gesetzt haben, nur Unterdrückung und Ausbeutung reproduzieren werden.
Wir sollten dies nicht lernen, um irgendjemanden moralisch zu verurteilen, sondern um den miserablen Zustand der Welt, der zum Teil durch Nationalismus und Nation-Staaten geschaffen wurde, wirksamer bekämpfen zu können.
Alles in allem ist dies eine sehr traurige, wenn auch lehrreiche Geschichte, und es scheint mir unangemessen, sie mit einem aufmunternden Slogan zu beenden. Aber manchmal ist traurig sein ein angemessenes Gefühl. Anstatt aus den Jungslawen anarchistische Helden zu machen, sollten wir vielleicht lieber um ihren Glauben trauern und um alle, deren Leben durch den Nationalismus noch elender geworden ist.
Aber ich kann hier einen Trick anwenden und den Artikel mit ein paar Fotos vom bosnischen Aufstand 2014 beenden, einem Aufstand, bei dem ein sehr guter Slogan an die Wände bosnischer Städte geschrieben wurde, während die Zentralen nationalistischer Parteien in Brand gesetzt wurden: „Tod dem Nationalismus!“.
Verwendete und nützliche Bücher:
Miloš Vojinović, Političke ideje Mlade Bosne, Filip Višnjić, 2015.
Josip Horvat, Pobuna omladine 1911-1914, SDK Prosvjeta – Gordogan, 2006.
Vladimir Dedijer, Sarajevo 1914, Prosveta, 1966.
Veselin Masleša, Mlada Bosna, Kultura, 1945.
Mirjana Gross, Nacionalne ideje studentske omladine u Hrvatskoj uoči I svjetskog rata, u: Historijski zbornik, godina XXI-XXII, 1968-1969.
Leo Pfefer, Istraga u Sarajevskom atentatu, Nova Evropa, 1938.
Vojislav Bogićević, Sarajevski atentat – stenogram Glavne rasprave protiv Gavrila Principa i drugova, Državni arhiv Sarajevo, 1954.
Ratko Parežanin, Gavrilo Princip u Beogradu, Catena Mundi, 2013.
Dobrosav Jevđević, Sarajevski zaverenici, Familet, 2002.
Miloš Ković, Gavrilo Princip – dokumenti i sećanja, Prometej, 2014.
Niko Bartulović, Od revolucionarne omladine do ORJUNE: istorijat jugoslovenskog omladinskog pokreta, Direktorijum Orujne, 1925.
]]>Die Nation in ihrem ganzem Zustand. Teil I und II, von Gilles Dauvé
von uns übersetzt, gefunden auf ddt21, hier Teil I und hier Teil II.
Die Nation in ihrem ganzen Zustand. Teil 1: Die Geburt der Nation
Der Ausbruch einer „französischen Nation“ nach 1789, die Entstehung von „Nationalitäten“ mit „nationalistischen“ Ansprüchen im 19. Jahrhundert, virulente und kriegerische „Nationalismen“, „nationale Befreiungsbewegungen“ in der Dritten Welt, der Zerfall und die Gründung von Staaten, die sich als „national“ bezeichnen, Ende des 20. Jahrhunderts, das Aufkommen supranationaler Strukturen, die mit den Staaten konkurrieren…
Dieser Essay geht von der Hypothese aus, dass Gesellschaften und ihre Entwicklung durch die Art und Weise bestimmt werden, wie Menschen ihre materiellen Existenzbedingungen schaffen, dass die Art und Weise, wie sie ihr Zusammenleben organisieren, davon abhängt und dass „die Nation“ eine Form davon ist. Weshalb entsteht sie, so wie wir sie kennen, in der Moderne? Was hat sie mit dem Kapitalismus zu tun? Und schließlich: Hat sich der Kapitalismus so sehr verändert, dass diese Form überholt ist? Oder führt seine zeitgenössische Entwicklung im Gegenteil zu einer Rückkehr des Nationalismus?
Nation & Kapital
Viele würden sich darauf einigen, die Form, die ein Volk annimmt, wenn es sich politisch in einem Gebiet organisiert, als Nation zu bezeichnen … aber was ist ein Volk? Anstatt nach einer Definition der Nation zu suchen, müssen wir vom Staat ausgehen und, um den Staat zu verstehen, müssen wir vom Kapitalismus ausgehen. Die Nation definiert sich nicht aus sich selbst heraus, sondern aus der Möglichkeit – oder eben nicht – einer selbstzentrierten kapitalistischen Entwicklung auf einem militärisch, aber auch steuerlich beherrschten Territorium, mit einer ökonomisch souveränen bourgeoisen Klasse, ohne immer direkt die politische Macht auszuüben: Bis 1918 erfolgte der preußische und dann der deutsche kapitalistische Aufschwung mit einem Führungspersonal, das aus vorkapitalistischen Schichten stammte.
Die Nation setzt diese moderne Schöpfung voraus, das Individuum, ein Wesen, das von den Bindungen der Geburt befreit und prinzipiell „frei“ ist, Bourgeois oder Proletarier zu werden, und sie entspricht der Notwendigkeit, diese Individuen in einer neuen Gemeinschaft zu verbinden, wenn die vorherigen auseinandergebrochen sind. Hierin liegt ein großer Unterschied zu den alten Welten. Sklaven, die außerhalb der Gesellschaft stehen, können (und müssen) nicht Teil einer athenischen „Nation“ sein. Ebenso wenig wie die Leibeigenen im mittelalterlichen Frankreich. Moderne Proletarier hingegen leben in der gleichen Gesellschaft wie die Bourgeoisie. Und gerade die Nation vereint über die Individuen hinaus auch Klassen.
Im 18. Jahrhundert erhielt der Begriff die Bedeutung, die wir heute kennen und die sich nach 1789 durchsetzen sollte. Im Jahr 1776 verfasste Adam Smith die Theorie „Wohlstand der Nationen“. Die von der industriellen Revolution und dem Aufkommen der Ware umgewandelten Gesellschaften schaffen die politische Einheit, die Produktionseffizienz und die kollektive Vorstellungswelt, die sie benötigen. Die kapitalistische Gesellschaft vereint ihre Komponenten, vor allem ihre beiden grundlegenden Klassen, Bourgeoisie und Proletariat, wie keine frühere Gesellschaft, weil ihre Komponenten so „frei“ sind wie nie zuvor, d.h. nur durch die ökonomische Notwendigkeit miteinander verbunden sind: Das Geld des einen kauft die Arbeit des anderen. Der Kapitalismus findet seine dynamische Einheit in sich selbst, und nicht, jedenfalls viel weniger und immer weniger, in Blutsbanden, Herkunft, Geschlecht, Rasse und Privilegien oder Verpflichtungen durch Geburt. Insbesondere Berufe werden nicht mehr durch Tradition vererbt und sind manchmal sogar bestimmten ethnischen Gruppen vorbehalten.
Der Kapitalismus tendiert dazu, diejenigen, die unter seiner Logik leben, zu homogenisieren und die Menschen als austauschbar zu behandeln, denn er stellt die Gleichwertigkeit von allem als Prinzip auf: Sein, Produkt, Aktivität … alles muss messbar, vergleichbar und austauschbar sein. Mit 100 Dollar in der Tasche kauft jeder alles, was zum Verkauf steht, für 100 Dollar. Es gibt kein prinzipielles Hindernis dafür, dass ein Proletarier zum Chef wird, und in den „fortgeschrittenen“ kapitalistischen Ländern gibt es einen – widersprüchlichen und nie abgeschlossenen – Trend zur Abschwächung der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und Hautfarbe und zur Auflösung von Zwängen, die früher als Naturtatsachen erlebt wurden. Diese Befreiung zerlegt, was zusammengefügt werden muss, und die Nation ist – bis einschließlich heute – die Art und Weise, wie der Kapitalismus sein „Menschenmaterial“ neu zusammensetzt.
Unter der (oft von den Tatsachen widerlegten) Regel der formalen Gleichheit ist ein Proletarier wie ein anderer einsetzbar: Der Bourgeois stellt den produktivsten, rentabelsten ein. Auch in der Politik ist die Stimme eines Staatsbürgers so viel wert wie die eines anderen: Der Stimmzettel eines Bourgeois wird als „eine Stimme“ gezählt, der eines Proletariers ebenfalls. So wie der Markt vermeintlich Gleiche in der Ökonomie zusammenbringt, so bringt die Nation politisch Gleiche zusammen, nicht de facto, sondern de jure. Dies war unter Ludwig XIV. in Frankreich nicht der Fall: Es wurde nach 1789 und im 19. Jahrhundert der Fall, und in Burma (A.d.Ü., Myanmar) ist es heute noch nicht absehbar, dass dies der Fall sein wird.
Diese Kohäsion und Adhäsion hat sich nicht aus dem Nichts heraus gebildet, sondern auf der Grundlage historischer Hinterlassenschaften, die auf tausendfache Weise sortiert und neu kombiniert wurden. Die kapitalistische Produktionsweise bestimmt global die Entwicklungen in einer Welt, die sie nicht geschaffen hat, aber beherrscht. So ist es beispielsweise unmöglich, die zeitgenössische Entwicklung in Libyen – und das Scheitern, dort einen Nationalstaat aufzubauen – zu verstehen, wenn man das Fortbestehen der Stämme als gesellschaftliche Kraft ignoriert, doch üben diese ihren Einfluss nur in Abhängigkeit von den kapitalistischen Verhältnissen in diesem Land und im Rest der Welt aus.
Nation & Arbeit
Als Sieyès in Qu’est-ce que le Tiers-État? (Was ist der Dritte Stand?) (ein enormer Bestseller am Vorabend der Französischen Revolution) politische Rechte für diejenigen forderte, die den Wohlstand produzieren, bekräftigte er die Anforderungen an eine Nation: „Die Nation existiert vor allem, sie ist der Ursprung von allem.“ Es ist wichtig, ihr durch geeignete Institutionen die politische Vertretung zu geben, die ihrer sozialen Realität entspricht. Da die Nation homogen ist (oder als homogen gilt: Von der damals in Frankreich lebenden Bevölkerung sprechen viele kein Französisch), muss auch der politische Körper homogen sein, seine Macht durch eine einzige Vollversammlung ausüben und seinen nationalen Willen durch Verfassungsorgane zum Ausdruck bringen. Während Ludwig XV. 1766 noch behaupten konnte: „Die Rechte und Interessen der Nation […] sind notwendigerweise in meinen Händen vereint“, behauptet Sieyès 1789: „Die Nation ist ein assoziierter Körper, der unter einem gemeinsamen Gesetz lebt und von der gleichen Legislative vertreten wird.“ Dies erreichten die Abgeordneten des Dritten Standes am 27. Juni 1789, indem sie den König zwangen, der Verschmelzung der drei Körperschaften in einer einzigen Vollversammlung zuzustimmen. Wenn das „Der Ursprung jeder Souveränität ruht letztlich in der Nation.“ (Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Artikel 3), dann kann es keine getrennten Ordnungen geben: Aus der sozialen Vielfalt muss die Einheit der Macht hervorgehen.
Aber es geht um Arbeit, und zwar sowohl um Ökonomie als auch um Politik. Im August 1789 erklärte Sieyès, wie seiner Zeit voraus: „Jede Gesellschaft kann nur das freie Werk einer Vereinbarung zwischen allen Teilhabern sein.“ Daraus folgt, dass „jeder Staatsbürger frei ist, seine Arme, seine Industrie und sein Kapital so einzusetzen, wie er es für sich selbst für richtig und nützlich hält. Keine Art von Arbeit ist ihm verboten“. Diese Verteidigung des Eigentums („Jeder Mensch ist Herr über sein Eigentum und seine Einkünfte“) gilt auch für denjenigen, dessen einziges „Eigentum“ seine Arbeitsfähigkeit ist. Jeder ist Eigentümer, der eine von „seinen Armen“, der andere von „Kapital“, das die Arbeit des ersten kaufen wird.
Die Proletarier an die Arbeit zu bringen und das „Industriesystem“ zu organisieren, erfordert Gesetze, die für alle gelten, statt Sonderrechte für bestimmte Gruppen, wie es Burgunder und Westgoten im selben fränkischen Königreich oder Juden und Muslime im Osmanischen Reich waren.
Der Staat stellt eine Konzentration politischer Kraft, eine Verwaltung und ein Monopol der legitimen Gewalt dar. Die Nation hingegen repräsentiert sich selbst und wird repräsentiert, was sie nicht zu einer bloßen Illusion, sondern zu einer konkreten Realität macht, die sich in einem Parlament manifestiert, einer Institution, die sich gleichzeitig von der Exekutive, den Berufen, den religiösen Organisationen, den Ritualen, den Festen und den populären Gemeinschaften unterscheidet… Das Leben der Nation läuft über politische Parteien, Organisationen, die weit entfernt von den Zwischenkörpern sind, die im Ancien Régime tatsächlich zahlreich und mächtig waren, aber keine eigenständige politische Sphäre bildeten.
Als Folge der Entwicklung des Kapitalismus trägt die nationale Ebene zur Konsolidierung dieser Produktionsweise bei.
England und Frankreich
Der englische Bürgerkrieg schlägt 1649 einem König den Kopf ab, endet aber mit einem dauerhaften Kompromiss. Ab dem 17. Jahrhundert beginnen die Engländer, unter einem parlamentarischen System zu leben, das den mittleren Bauern (yeomen) und in den Städten den Eigenheimbesitzern das Wahlrecht einräumt. Das Unterhaus blieb lange Zeit die politische Vertretung der reichsten Besitzer, doch im Laufe der Jahrhunderte verloren die Großgrundbesitzer ihr Machtmonopol an die Bourgeoisie (Händler, Finanziers und Industrielle), deren Einfluss auf die Exekutive immer größer wurde.
Nach der Aufstandsperiode der Ludditen (1811-1817) gelang es dem englischen Kapitalismus, die proletarischen Aufstände einzudämmen. Das Massaker von Manchester 1819 (mehrere Dutzend Tote, Hunderte von Verletzten), das als Peterloo in das kollektive Gedächtnis eingegangen ist, sollte die letzte blutige Niederschlagung in diesem Ausmaß sein. Als der Chartismus, eine breite populäre Bewegung, die sowohl soziale Reformen als auch das allgemeine Wahlrecht forderte, 1839 einen einmonatigen Generalstreik vorbereitete, wurde dieser nach wenigen Tagen abgebrochen. Der von der Regierung gefürchtete Londoner Aufstand im Jahr 1848 löste sich in einer riesigen Kundgebung auf. Kurz gesagt: In dem Maße, wie der englische Kapitalismus sich in der Welt behauptet und durchsetzt, befriedet er seine Arbeiterklasse und verschafft ihr sogar, natürlich nur unter Druck, eine politische Vertretung durch eine Reihe von Gesetzen, die das Wahlrecht erweitern, bis hin zum Frauenwahlrecht im Jahr 1918.
Der Klassenkampf auf der anderen Seite des Ärmelkanals hat sich zwar nie beruhigt, ist aber auch nie in einem Aufstand ausgebrochen. Die sehr allmähliche und oft in Frage gestellte „Eingliederung“ der Arbeiterbewegung in die kapitalistische Gesellschaft fand 1924 ihren politischen Ausdruck in der ersten kurzen Machtübernahme der Labour Party (neun Monate). Die 1929 gebildete zweite Labour-Regierung unter MacDonald beschloss zwei Jahre später, sich mit den Konservativen in einer National Union zu verbünden. Von seiner Partei desavouiert und ausgeschlossen, gründete MacDonald eine neue Partei, National Labour. In den 1930er Jahren fiel Labour, aber trotz der Krise von 1929, Arbeitslosigkeit, Elend und Arbeiterkämpfen hielt der britische Kapitalismus nicht nur den sozialen Frieden, sondern auch das politische Gleichgewicht aufrecht.
Ganz anders ist die Entwicklung in Frankreich.
Vor 1789 gab es in Frankreich im Gegensatz zu England nicht nur ein einziges Parlament, sondern mehrere in verschiedenen Provinzen. Ursprünglich einfache Gerichtshöfe, haben die Parlamente auch eine politische Rolle: Sie registrieren die königlichen Akte, woraus sich im 17. und 18. Jahrhundert ein größeres Mitspracherecht bei den Entscheidungen des Souveräns ergibt, das ihnen aber auch erlaubt, diese zu bremsen, seltener zu blockieren. Parlamentarier sind in erster Linie Gesetzeshüter, und die aufstrebenden Handels- und Industrieklassen haben in den Parlamenten ein weitaus geringeres Gewicht als in den britischen Unterhäusern.
Zur Zeit der Französischen Revolution vereinte die von Sieyès theoretisierte „Nation“ die „Patrioten“, die gegen den König und die absolute Monarchie waren, denn das „Vaterland“ war das Vaterland des Volkes im Kampf gegen das, was es unterdrückte. Gegen die ungerechten Privilegien der Ständegesellschaft steht „Nation“ dann für soziale Gerechtigkeit, dank der Darstellung einer Gemeinschaft, die aus allen Klassen gebildet wird, die das Volk ausmachen. Aber nicht die gesamte Bevölkerung ist das Volk: Die Aristokraten sind davon ausgeschlossen, ebenso wie – für einige radikalere Patrioten – die Aufkäufer (A.d.Ü., jemand, der große Mengen an Ware mit spekulativen Zielen hortet) und Kriegsprofiteure.
Diese nationale Einheit braucht ihr Territorium mit Grenzen und Zöllen, um einen Raum abzugrenzen, in dem eine einheitliche Besteuerung eingeführt werden kann, im Gegensatz zum Ancien Régime, das je nach Region und „Land“ in unterschiedliche Steuersysteme unterteilt war.
Innerhalb dieses Raumes wird ein „Volk“, das sich aus allen „Arbeitenden“ zusammensetzt (im weit gefassten saint-simonistischen Sinne, der Arbeitgeber, Arbeiter, Handwerker, Künstler, Wissenschaftler usw. umfasst), nur dann zu einer politischen Realität, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind, insbesondere wenn die Proletarier das Spiel mitspielen und den entstehenden demokratischen Rahmen respektieren.
„Désormais, le bulletin de vote doit remplacer le fusil – Fortan muss der Stimmzettel das Gewehr ersetzen „, heißt es 1848 unter einer Lithografie von Bosredon, L’Urne et le fusil, die die Eroberung des allgemeinen (Männer-)Wahlrechts in Frankreich illustriert: Ein Arbeiter legt sein Gewehr an die Wand, bevor er einen Stimmzettel in die Urne wirft. Einige Monate später greift der Arbeiter jedoch wieder zu seiner Waffe, und zwar mit größerer Intensität und Gewalt, erneut im Jahr 1871.
Im 20. Jahrhundert war die britische „Nationale Einheit“ von 1931 ein bourgeoiser politischer Erfolg, verglichen mit der französischen Zwietracht der 1930er Jahre, als zwischen 1932 und 1940 sechzehn Regierungen aufeinander folgten. Dann kam es zum Bruch des Vichy-Regimes mit der Republik und zu einer echten nationalen Spaltung, da ein Teil der Franzosen in den Widerstand gegen die deutschen Besatzer ging und einige „Nationalisten“ sich paradoxerweise für eine Anpassung an den Feind (Vichy) oder sogar für eine Allianz (für die extremsten Kollaborateure) entschieden. Die Vereinigung der Klassen musste bis 1945 warten, mit der Regierungsbeteiligung der Parteien der Arbeit (SFIO und PCF), aber die späten 1960er Jahre zeigten die Grenzen der sozial-nationalen Befriedung auf.
Die Kommunisten theoretisieren die Nation.
Bei Marx und Engels war es die Entwicklung des Kapitals – und der Arbeiterbewegung -, die ihre Haltung zur „nationalen Frage“ lenkte.
Einerseits führen für sie Lohnarbeit und Proletarisierung zu einer sozialen Polarisierung, indem die Mehrheit der Bevölkerung in den Industrieländern allmählich, aber beschleunigt in die Klasse der Arbeit integriert wird.
Andererseits scheint die kapitalistische Entwicklung die Welt geografisch zu vereinheitlichen, wodurch ethnische oder religiöse Gegensätze neutralisiert werden, und die internen Spaltungen in den einzelnen Ländern zu verringern, wenn nicht gar zu beseitigen. Der Kapitalismus würde auf eine Verwischung der Grenzen zusteuern, die die Revolution wirksam werden lässt: „Die nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse.“ (Karl Marx – Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, II. Proletarier und Kommunisten)
Für Marx und Engels vereinfacht das Fortschreiten des Kapitalismus, so verheerend und unterdrückend er auch sein mag, also das Problem. Sie halten den Marsch zu den politischen Formen, die der kapitalistischen Entwicklung am besten entsprechen, die am meisten vereinheitlichen und universalisierbar sind, für positiv für die proletarische Revolution, und sie sind überzeugt, dass sie bald über den Archaismus siegen werden.
In den Ländern, die im Kapitalismus bereits fortgeschritten sind, kämpfen die Proletarier auf einem bestimmten Raum, vereint durch ihre Lebensumstände, während sie gleichzeitig einer geografischen Einheit (Viertel, Stadt, Region, Land) angehören, jeweils mit ihrer spezifischen Sprache und Kultur, aber die nationale Einheit stellt kein großes Hindernis für die proletarische Bewegung dar :
„Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. […] Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie.“ (Ebenda)
Was die rückständigen Länder betrifft, so werden und sind sie bereits gezwungen, dem von Großmächten wie England vorgezeichneten Weg zu folgen. Das geht so weit, dass Engels 1847 die Eroberung von halb Mexiko durch die USA als positiv bewertet, da die Ausbreitung eines modernen Kapitalismus die Aussichten auf eine soziale Revolution auch für die Mexikaner begünstigt.
Dies verhindert jedoch nicht die herausragende Rolle einiger nationaler Völker, die ihre Stellung im geopolitischen System dazu veranlassen würde, das globale kapitalistische Gleichgewicht in Frage zu stellen. Laut Marx beruhte die bourgeoise Weltordnung zu seiner Zeit auf dem Bündnis zwischen zwei Mächten, die ansonsten alles gegeneinander hatten: das demokratische England und das autokratische Russland. Ersteres wurde von der irischen Unabhängigkeitsbewegung erschüttert, letzteres von den nationalen Aufständen in Polen. Ohne die Existenz von Klassen in diesen beiden Ländern zu leugnen, sehen Engels und Marx in den irischen und polnischen Völkern einen revolutionären Hebel. Weil sie die Herren der Welt destabilisieren, seien einige Völker für den proletarischen Kampf „notwendig“. Andere, wie die Südslawen, deren nationale Bestrebungen Russland in die Hände spielen würden, werden als „konterrevolutionär“ bezeichnet.
„Der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien vom Erdboden fegen, sondern auch ganze reaktionäre Völker. Und auch das ist ein Fortschritt“. (Engels, 1849)
Wenn für Marx und Engels die notwendige und positive Aktion bestimmter Völker nicht Gefahr läuft, das Proletariat, das für sie der wesentliche historische revolutionäre Agent bleibt, von seinem Weg abzubringen, so liegt das daran, dass sie von einer unwiderstehlichen Proletarisierung der Welt durch die kapitalistische Entwicklung überzeugt sind, für die die Nation das beste Vehikel ist, eine Entwicklung, die auf jeden Fall die nationalen Schranken überwindet und auslöschen wird. Daher die Suche nach den politischen Rahmenbedingungen, die für den Aufschwung von Industrie und Handel am besten geeignet sind, vorzugsweise große geografische Einheiten: eher die Vereinigten Staaten als Mexiko.
Die Bourgeoisie theoretisiert die Nation
Es ist unmöglich, eine Studie über die Nation zu lesen, ohne Ernest Renans Formel aus dem Jahr 1882 zu finden: „Die Existenz einer Nation ist […] ein Plebiszit aller Tage.“
In Bezug auf Frankreich sind historische Fakten wie Gallien, der Hundertjährige Krieg oder 1789, so Renan, nur durch den Willen gültig, ihr Erbe neu zu erschaffen und zu erneuern: Die französische Nation bestand ebenso sehr aus Mythen wie aus Realitäten.
Auch wenn Renan die Nation als das darstellt, was man heute ein „soziales Konstrukt“ nennen würde, das geboren werden und sterben kann, ist seine Wahrnehmung dennoch idealistisch: Auf der Grundlage eines gemeinsamen Ursprungs beschließen Menschen, sich zusammenzuschließen. Das „Plebiszit aller Tage“ legt nahe, dass die Nation das Ergebnis einer Adhäsion ist, einer Reihe von bewussten Erinnerungsakten, bei denen aus Solidarität autonome Subjekte Erinnerungen und Amnesien teilen, eine freiwillige Aktivität mit einer eigenen Dynamik, die sich nicht aus sozio-politischen Kräften ergibt … noch weniger aus Klassen.
Renan ist ein französischer Historiker. Indem er der freiwilligen Verschmelzung aufeinanderfolgender Beiträge Vorrang einräumt, befasst er sich mit der deutschen Frage, genauer gesagt mit Elsass-Lothringen, dessen Annexion durch Deutschland im Jahr 1871 er implizit in Frage stellt. Was spielt es denn für eine Rolle, dass die Elsässer deutschsprachig sind: Da sie sich für die französische Nation entschieden haben, ist das Elsass Frankreich. Der Renan von 1882 bereitete 1914 vor.
Belasten wir Renan nicht als Ausdruck seiner Zeit.
In unserer Zeit sind Historiker (oft die am meisten kommentierten) zwar generell sehr kritisch gegenüber der Nation, beteiligen sich aber am selben Idealismus wie Renan: Sie stützen die Nation auf einen impliziten Vertrag, mit dem Unterschied, dass sie ihre imaginäre Dimension betonen. Insbesondere Ernest Gellner und Benedict Anderson definieren sie als die Konstruktion einer gemeinsamen Vergangenheit, eines kollektiven Bewusstseins und einer kulturellen Homogenisierung. Aber wovon ist diese „imaginäre Gemeinschaft“ das Produkt (und was würde sie in eine Krise bringen)?
Ideologie, Kultur und „vereinheitlichende“ Bildung funktionieren, um mit Renans Worten zu sprechen, dank einer alltäglichen Vereinheitlichung in einem materiell umschriebenen Raum. Die harmonisierte Zirkulation von Waren, Kapital und Arbeit erfordert Grenzen: kein Binnenmarkt ohne Abgrenzung gegenüber einem Außen. Der Zollverein (Zoll- und Handelsverein zwischen deutschen Staaten, 1834) hat mehr zur Einheit des Landes beigetragen als die nationalistische Romantik, der Folklorismus und die Humboldt-Universität in Berlin im 19. Jahrhundert, wie brillant sie auch immer gewesen sein mag.
Wenn die Arbeiterbewegung national ist
Trotz der Komplexität der Einzelfälle stellte sich die „nationale Frage“ für Marx und Engels recht einfach dar: Die weltweite kapitalistische Expansion, die „ihre eigenen Totengräber“ hervorbrachte, verringerte nach und nach unwiderstehlich die ethnischen (und religiösen) Unterschiede. Marx schrieb 1845:
„Die Nationalität des Arbeiters ist nicht französisch, nicht englisch, nicht deutsch, sie ist die Arbeit, das freie Sklaventum, die Selbstverschacherung. Seine Regierung ist nicht französisch, nicht englisch, nicht deutsch, sie ist das Kapital. Seine heimatliche Luft ist nicht die französische, nicht die deutsche, nicht die englische Luft, sie ist die Fabrikluft. Der ihm gehörige Boden ist nicht der französische, nicht der englische, nicht der deutsche Boden, er ist einige Fuß unter der Erde. -“ (Karl Marx, Über F. Lists Buch „Das nationale System der politischen Ökonomie“, 1845)
Die Situation des Proletariers ist nicht symmetrisch mit der des Bourgeois, für den es verlockend genug ist, sich außerhalb des Bodens zu wähnen: Als Importeur billiger Arbeit, Investor und Exporteur am Ende der Welt fällt ihm der Universalismus ebenso leicht wie zu anderen Zeiten die patriotische Verherrlichung.
Für den Proletarier bedeutet Widerstand gegen den Arbeitgeber, Zugeständnisse zu erzwingen, auch, diese durch Garantien, einen Status, eine Regelung zu festigen, also die Gesetzgebung des Landes, in dem er arbeitet, zu nutzen (selbst wenn er dort nicht geboren ist). Ohne einen Schub proletarischer Kämpfe gelingt die Internationalisierung des Kapitals den Bourgeois besser als den Arbeitern, die zwangsläufig in die Verteidigung eines nationalen Rahmens verstrickt sind, der ihnen Schutz bietet oder von dem sie sich Schutz erhoffen.
In Übereinstimmung mit Marx tendierten und tendieren viele Kämpfe, die in mehreren Ländern entstanden sind, zu einer gemeinsamen Aktion über die Grenzen hinweg. Dennoch ist Internationalismus für den Proletarier keine Selbstverständlichkeit, und Solidarität muss immer aufgebaut werden und ist nie selbstverständlich. Die proletarische Kampfgemeinschaft ist nicht von Natur aus oder aus Prinzip internationalistisch. Es ist der Zwang, sich in der Konkurrenz, zu der die Arbeit gezwungen wird, möglichst schlecht zurechtzufinden, der Nationalismus und Identitätsreflexe aufrechterhält. Es ist eine „natürliche“ Form des Widerstands von Lohnabhängigen, sich hinter Barrieren zu schützen und – mangels besserer Möglichkeiten – oftmals diese Barrieren zu verteidigen, auch die, die der Nationalstaat bietet.
Ende des 19. Jahrhunderts konnte man immer weniger glauben, dass der Kapitalismus den Boden für den Triumph einer universellen proletarischen Bewegung bereitete.
Einerseits absorbierte er selbst in den am stärksten industrialisierten Ländern nicht die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in einer proletarischen Klasse, die für ihre Emanzipation kämpfte. Andererseits war der Nationalismus unbestreitbar eine aufstrebende historische Kraft: sowohl in den bestehenden Staaten (Frankreich, Deutschland usw.) als auch unter den beherrschten Völkern, die nach Unabhängigkeit (Polen) oder sogar nach weitgehender Autonomie (die sogenannten Südslawen auf dem Balkan) strebten.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Jahrzehnte vor 1914 die Belle Epoque des offenen Militarismus wie auch des militanten Antimilitarismus und der pazifistischen Mobilisierungen waren. Versprechungen, im Falle einer Mobilmachung in ganz Europa einen Generalstreik auszurufen, der Slogan „Krieg dem Krieg“ (der äußerst zweideutig war und alles und jedes rechtfertigen konnte) … bis sich schließlich fast jede sozialistische Partei und Gewerkschaft/Syndikat für die Sache „ihres“ Landes einsetzte. Engels sah die Möglichkeit eines verheerenden europäischen Krieges klar vor Augen, gab sich aber der Illusion hin, dass die Arbeiterbewegung in der Lage sei, ihm entgegenzutreten.
Wenn die nationale Einheit über die Klassensolidarität siegte, dann deshalb, weil die Arbeiterbewegung 1914 in jedem Land zu einem nationalen Ganzen gehörte, mehr als 1848 oder 1871, und umso mehr, als sie dort Rechte und Positionen erobert hatte. Die Forderung nach dem, was die kapitalistische Gesellschaft am wenigsten schlimm zulässt (Reformen), bereitet schlecht darauf vor, das abzulehnen, was sie am schlimmsten erzwingt (Krieg). Die Union Sacrée für den Krieg – also die Verteidigung des eigenen Landes – ist das Ergebnis des Zusammenschlusses der Klassen in der Gesellschaft in Friedenszeiten.
Für die Zweite Internationale wird „Internationalismus“ immer die Vereinigung der Nationen bedeutet haben: Theoretische Polemiken, Kongressresolutionen, Riesendemos … es gab dort keine Wahrnehmung der Nation als historischer Rahmen, der mit dem Kapitalismus konstitutiv verbunden ist. Dazu hätte es einer Kritik des Staates und des Kapitals bedurft.
Auf seine Weise veranschaulichte Österreich-Ungarn dieses Versagen. Bereits 1899 hatte die österreichisch-ungarische Sozialdemokratie auf ihrem Kongress in Brünn (heute Brno) der nationalen Tatsache Priorität eingeräumt. Die Partei wandte dieses Prinzip auf sich selbst an und teilte sich nach den Besonderheiten der einzelnen „Völker“ des Reiches auf. Nach einigen Jahren wurde die Autonomie der tschechischen Sozialisten in eine Unabhängigkeit umgewandelt, und sie bildeten eine eigene Partei und eigene Gewerkschaften/Syndikate, was zur Folge hatte, dass sich die deutschen und tschechischen Arbeiter voneinander trennten und in den Gebieten (z. B. Wien), in denen sich die beiden Bevölkerungsgruppen mischten, sogar gespalten wurden. Diese Trennung wurde übrigens nur wirksam, weil die Aktionen der einen und der anderen Proletarier vor Ort innerhalb der Grenzen von Sprache und Kultur, manchmal auch der Religion, blieben: Die Arbeiterbewegung zwang einer „internationalistischen“ Kampfgemeinschaft nicht von oben herab eine Teilung auf … die sich nur sehr schwer herausbilden konnte.
Warum zerbrach Österreich-Ungarn nach 1918, anstatt sich zu einer Föderation wie Brasilien oder die Vereinigten Staaten zu entwickeln? Dem österreichischen Kaiserreich fehlte eine ökonomische und soziale Vereinigung, eine reibungslose Zirkulation von Kapital und Arbeit, ein relativer Ausgleich zwischen den Regionen, eine Kraft, die sie näher an das politische Entscheidungszentrum heranbrachte, ohne sie zu ersticken oder zu ignorieren. Ein Markt allein reicht nicht aus: Die Addition von Verbrauchern macht noch keine Kohäsion. Produktivitäts- – und damit Entwicklungsunterschiede – zwischen den verschiedenen Teilen des Reiches ermutigten zentrifugale Kräfte, sich von einem Zentrum abzukoppeln, das selbst nicht in der Lage war, sie zu beherrschen. Österreich-Ungarn konnte sich nicht in einen Bundesstaat verwandeln, da es zu wenig einheitlich und vereinigend war, unter anderem wegen der Dominanz der deutsch-ungarischen (in Wirklichkeit eher „deutschen“ als ungarischen) Führungsschicht, die die Fäden der Macht in der Hand hielt, sich aber als unfähig erwies, die disparaten Gebiete zu beleben und zu strukturieren.
Wien wurde 1918 zum amputierten Kopf eines zerstückelten Körpers, und Österreich wurde erst 20 Jahre später durch die Gewalt der Nationalsozialisten an den deutschen Staat angeschlossen und 1945 durch den Krieg wieder von ihm getrennt.
Nationaler Kommunismus
Eine der Ursachen für den weltweiten proletarischen Aufschwung nach 14-18 war eine Reaktion gegen Nationalismus und imperialistischen Krieg, eine Ablehnung, die sich im Bruch mit der alten Internationale und der Gründung einer neuen im Jahr 1919 manifestierte.
Ein Jahr später, im Juli 1920, als die Kommunistische Internationale ihren zweiten Kongress abhielt, befanden sich die Bolschewiki mehr als achtzehn Monate nach ihrer Machtergreifung im Krieg mit einem seit 1795 verschwundenen und 1918 wieder auferstandenen polnischen Staat. Dank seiner Wiedergeburt hörten die polnischen Proletarier auf, als Proletarier und Polen unterdrückt zu werden, und wurden nur noch als Proletarier in ihrem eigenen Land unterdrückt.
Ohne auf die Debatte zwischen Lenin und Rosa Luxemburg über die „nationale Frage“ einzugehen (eine Debatte, die sich genauso oder sogar noch mehr auf das Wesen des Kapitalismus selbst bezog), sei auf Luxemburgs Klarheit über die Gefahr hingewiesen, dass Proletarier Kämpfe für nationale Unabhängigkeit unterstützen und Kommunisten ein „Recht der Nationen auf Selbstbestimmung“ fordern würden. Wie sie 1918 feststellte:
„[…] „Nationalstaat“ und „Nationalismus“ an sich leere Hülsen sind, in die jede historische Epoche und die Klassenverhältnisse in jedem Lande ihren besonderen materiellen Inhalt gießen. […] Aber durch alle diese Spezialinteressen geht richtunggebend als Achse ein allgemeines, von der besonderen geschichtlichen Situation geschaffenes Interesse: die Spitze gegen die drohende Weltrevolution des Proletariats.“ (A.d.Ü., Rosa Luxemburg: Fragment über Krieg, nationale Frage und Revolution)
Insbesondere die Tschechoslowakei und Jugoslawien werden sich als fragile Gebilde erweisen. Die oft zitierte ethnische Pluralität (von 15 Millionen tschechoslowakischen Staatsbürgern gab es 3,2 Millionen Deutschsprachige, 2 Millionen Slowaken, 750.000 Ungarn…) war kein entscheidender Faktor für den Zerfall, der vor allem auf die Unfähigkeit des Landes zurückzuführen war, seine Vielfalt kohärent zu machen: Das industrielle Herz Böhmens zog in seinem Aufschwung nicht den slowakischen Osten mit, den nur zwei Eisenbahnlinien mit den anderen Provinzen verbanden. Wie Rosa Luxemburg angekündigt hatte, dienten diese neuen staatlichen Konstruktionen dazu, die bolschewistische Ansteckung und die deutsche Macht zu blockieren: Frankreich hatte auf die Schaffung einer „Kleinen Entente“ gedrängt, die aus der Tschechoslowakei, Jugoslawien, Polen und Rumänien bestand, einer Einflusszone, in der sich der französische Kapitalismus eine Kundschaft erhoffte.
1920, inmitten eines verworrenen Bürgerkriegs zwischen Roten und Weißen, stritten sich Warschau und Moskau um die Gebiete des heutigen Belarus, der Ukraine, Russlands, Polens und Litauens. Im April 1920 griff Polen an, doch nach anfänglichen großen Erfolgen wie der Einnahme von Kiew mit Hilfe ukrainischer Nationalisten wendete sich das Blatt und die Rote Armee kam bis auf 100 km an Warschau heran. Dank der militärischen und logistischen Unterstützung Frankreichs und Großbritanniens wehrt die polnische Armee diese Offensive ab und dringte erneut in russisches Gebiet ein, wodurch die bolschewistische Regierung gezwungen wird, Frieden zu unterzeichnen. Polen gewann ein Stück Litauen und einen großen Teil der Ukraine (die erst nach dem Zweiten Weltkrieg an diese Länder zurückfallen sollten).
Die Delegierten des zweiten KI-Kongresses, die zur gleichen Zeit in Moskau zusammenkamen, verfolgten den Krieg gegen Polen auf einer großen Karte an der Wand, die sie sich zwischen den Sitzungen immer wieder anschauten, da sie „jeden Kilometer Vorsprung der Roten Armee [als] einen Schritt in Richtung Revolution in Deutschland“ (Pierre Broué) betrachteten. Der gesamte internationale Kommunismus in Gestalt seiner Vertreter sah in der gescheiterten Invasion polnischen Bodens einen proletarischen Rückschlag, nachdem er den Vormarsch der Roten Armee als die Ausbreitung der Revolution von ihrer russischen Bastion aus begrüßt hatte.
Doch welche Revolution fand damals in Russland statt?
Der Sommer 1920 ist einige Monate nach der Militarisierung der Arbeit, einige Monate auch vor dem Beginn der Zerschlagung der Machnowschen Armee, weniger als ein Jahr vor Kronstadt (wo der bolschewistische Staat wie ein Staat reagiert), während Arbeiterstreiks regelmäßig gewaltsam zerschlagen werden. Diese Macht, in der sich unbestreitbar die Massen der kämpfenden Proletarier auf der ganzen Welt wiedererkennen, ist nur noch dann proletarisch und kommunistisch, wenn sie für sich in Anspruch nimmt, eine Weltrevolution durchzuführen.
Was den tatsächlichen Beitrag dazu anbelangt, so schloss sich derselbe Zweite KI-Kongress gegen die kommunistische Linke der Notwendigkeit von Wahl- und Parlamentsaktivitäten an – eine Position, die von den Bolschewiki bissig verteidigt wurde (siehe Lenins Kinderkrankheit…, die einige Monate zuvor geschrieben und unter den Kongressteilnehmern weit verbreitet worden war).
Nachdem die Rote Armee die Schlacht um Warschau gewonnen und ganz Polen besetzt hatte, sollte eine „sozialistische Sowjetrepublik“ errichtet werden, doch bereits im Juli 1920 hatte die Kommunistische Arbeiterpartei Polens (damals 7.000 Mitglieder bei einer polnischen Bevölkerung von etwa 25 Millionen) eine „provisorische revolutionäre Regierung“ ausgerufen. Doch die Millionen von Flugblättern, die aus Flugzeugen abgeworfen wurden und die Verstaatlichung der Fabriken und die Macht der Räte versprachen, blieben bei der polnischen Bevölkerung, einschließlich der Proletarier, fast ohne Resonanz. Hätte es eine solche revolutionäre Regierung gegeben, wäre sie von der Arbeiterklasse nur sehr schwach unterstützt worden und hätte ihre Stärke vor allem aus der Anwesenheit russischer Truppen gezogen. In anderen Breitengraden würde man von einem „Marionettenstaat“ sprechen.
Der bolschewistische Staat führte sowohl Krieg gegen konterrevolutionäre Kräfte als auch zur Verteidigung des russischen Staatsgebiets und knüpfte dabei an die zaristische Kolonialherrschaft über die umliegenden Gebiete an. Es war ein nationaler Krieg, den eine de facto vor allem russische Macht führte.
„Die Zivilisation wird durch die Spitze des Schwertes verbreitet“, sagten die Eroberer gerne. Zweifellos glaubten die Delegierten des zweiten Kongresses, dass die Armee eines Landes den Kommunismus in ein anderes Land exportieren kann.
* * *
Diese geschichtlichen Punkte waren notwendig, um zu erfassen, was die Nation ist, um die Frage zu stellen: Welche Zukunft hat die Nation im 21. Jahrhundert?
G.D., Februar 2019
Lektüre:
Sieyès, Travaux de l’Assemblée, 12 août 1789.
Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, 1882:
Shlomo Sand, De la nation et du peuple juif chez Renan, Les Liens qui libérer, 2009. Eine Rezension dieses Autors findet sich in: „ Shlomo Sand, intellectuel critique“, 2017.
Benedict Anderson, L’Imaginaire national (1983), La Découverte, 2006.
Ernest Gellner, Nations & nationalismes (1983), Payot, 1989.
Edouard Dolléans, Le Chartisme 1831-1848. Aurore du mouvement ouvrier, Les Nuits Rouges, 2003.
Miklós Molnár, Marx, Engels et la politique internationale, Gallimard, 1975.
Engels, „La Lutte des Magyards“, La Nouvelle Gazette Rhénane, 13 janvier 1489.
Die Marxschen Theoretisierungen mögen in unserer Zeit, in der nur noch der unumstößliche Liberale an den zivilisatorischen Tugenden des Kapitalismus festhält, erstaunen. Jahrhundert vorherrschenden progressiven Sichtweise teilten, hielten Marx und Engels die kapitalistische Phase für unerlässlich, um ein revolutionäres Proletariat entstehen zu lassen. In seinen späteren Jahren gab Marx diese Auffassung zwar nicht auf, nuancierte sie aber stark, insbesondere aufgrund eines möglichen alternativen Weges, den die russische Landkommune bot (mir). Vgl. Maximilian Rubel, Karl Marx et le socialisme populiste russe, 1947.
Doch diese Perspektive blieb unbeachtet. Mit wenigen Ausnahmen glaubte die gesamte sozialistische und später kommunistische Bewegung an die Notwendigkeit, die Welt zu industrialisieren, um eine Arbeiterklasse zu schaffen, die dann ihre Revolution durchführen würde, und die Populisten galten als rückwärtsgewandte Idealisten oder sogar als Reaktionäre. In Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland bekräftigte Lenin 1899 die historisch verurteilte Mir durch einen unvermeidlichen – und positiven – Vormarsch des Kapitalismus, und lange Zeit war dies die Lehre, die man sich merken sollte.
Georges Haupt, Michael Lowy, Claudie Weill, Les marxistes et la question nationale, 1848-1914, Maspero, 1974. Nombreux textes, dont ceux de Marx, Engels, Luxemburg, Lénine, Pannekoek, les „austro-marxistes“, etc.
Engels, Brief an Kautsky über die nationale Frage und Polen, 7. Februar 1882 :
Rosa Luxemburg, Fragment über den Krieg, die nationale Frage und die Revolution (1918).
Rosa Luxemburg, La Question nationale & l’autonomie, Le Temps des Cerises, 2001.
Sur l’Europe après 14-18 : Margaret McMillan, Paris 1919, Random House, 2001.
Pierre Broué, Histoire de l’Internationale Communiste (1919-1943), Fayard, 1997, chap. VIII.
Die Nation in ihrem ganzen Zustand. Teil 2: Tod der Nation?
„Nation“ ist ein allgemeiner Begriff für eine Form der politischen und sozialen Strukturierung, die seit mehreren Jahrhunderten mit dem Kapitalismus verbunden ist. Die Nation bildet sich um eine bestimmte Bevölkerung herum auf einem Territorium, das von einem bestimmten Staat kontrolliert wird (oder auf dem Weg dahin ist) und auf dem der Kapitalausgleich spielt.
Ausgleich bedeutet, dass Ungleichheiten in der Situation teilweise ausgeglichen werden. Dadurch werden die Profitraten nicht vereinheitlicht und die Lohnraten (bei gleicher Qualifikation) nicht nivelliert, aber die Unterschiede auf den Kapital- und Arbeitsmärkten werden tendenziell verringert. Als Teil des Gesamtkapitals beansprucht jedes Einzelkapital einen Teil des Mehrwerts. Monopolgewinne und Renten, unvermeidliche Folgen von Wettbewerb und errungenen Positionen, werden nicht beseitigt, aber das nationale Ganze begrenzt ihre für das Gesamtsystem kontraproduktiven Auswüchse, während der Staat auch für Investitionen aufkommt, die für privates Kapital oft wenig rentabel sind (öffentliche Dienstleistungen, Verkehr, Energie…).
Dieser Mechanismus setzt einen umschriebenen Raum mit anerkannten Grenzen voraus, der unter der Autorität einer politischen Macht steht.
Es ist verständlich, dass der in diesem Sinne als national zu bezeichnende Staat der seltenste Fall ist, der nur von den herrschenden Kapitalismen realisiert werden kann. Und selbst dort kann es zu Krisen kommen, wie in Deutschland und Italien, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts unvollendete Nationen waren: Die Weimarer Republik musste sich mit dem bayerischen Separatismus auseinandersetzen, und der italienische Süden und vor allem Sizilien blieben in ihrer Entwicklung lange hinter dem Norden zurück. Anderswo, in den beherrschten Ländern, ist der Anschein eines Nationalstaats lebensfähig, solange der globale Kapitalismus ihnen eine zweite, aber effektive Rolle ermöglicht. Wenn sie sich davon loslösen, verdeckt nichts mehr die Künstlichkeit des nationalen Gebäudes, das dann zerreißt.
Zeit und Raum
Der Nationalismus bezieht seine Stärke daraus, dass die Nation die politische Form der Kapitalakkumulation und des Wettbewerbs zwischen nationalen Kapitalen war. Ist das heute anders?
Binnenmarkt und hohe Produktivität sind für den kapitalistischen Aufschwung eines Landes unerlässlich, aber diese Bedingungen sind nur dann wirksam, wenn sie von einer ausreichend großen Bevölkerung auf einem ausreichend großen Territorium umgesetzt werden, das von einer autonomen politischen Macht beherrscht wird. Trotz ihrer Dynamik fehlte den italienischen Stadtstaaten des späten Mittelalters diese Grundlage. Das später von holländischen Kaufleuten errichtete Imperium litt darunter, dass es sich auf eine kleine und verwundbare Metropole stützte. England hingegen profitierte davon, dass es seit 1066 nie mehr überfallen worden war. (Umgekehrt war die kurdische Nationalbewegung trotz jahrzehntelanger Kämpfe und bewaffneter Auseinandersetzungen bislang nicht stark genug, um sich gegen die Staaten durchzusetzen, die die kurdischen Siedlungsgebiete kontrollieren).
Bodenlos würde das Kapital an Erstickung sterben. Obwohl der Bourgeois einen unaufhörlichen Kampf führt, um die Zeit auf ein Minimum zu reduzieren, besteht der Kapitalismus nicht nur aus Zeit, sondern auch aus einem Raum, in dem sich Proletarier und Bourgeois auf einem stabilen und befriedeten Arbeitsmarkt begegnen können müssen. Die Nation war und ist bis heute die Form dieses Zusammenhalts, und alle historisch dominierenden Kapitalismen – der englische, französische, deutsche, amerikanische, heute der chinesische – haben eine nationale Grundlage.
Die Zusammenführung der Klassen in einem Volk (das sich von den Nachbarvölkern unterscheidet oder ihnen sogar gegenübersteht), das eine politische Einheit bildet, ist ein Phänomen, das eine an Neukonfigurationen und Konflikten reiche Geschichte durchlaufen hat. Es vergingen Jahrhunderte, bis Schottland aufhörte, England zu bedrohen, und die französischen Provinzen aufhörten, sich gegenseitig zu bekämpfen. Die Einwohner der Vereinigten Staaten haben sich durch eine Reihe von Kriegen zusammengefunden: Unabhängigkeitskrieg gegen England, Eroberungskrieg gegen Mexiko, Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd. Aber die USA hätten dies nicht ohne ihre Fähigkeit geschafft, Wert – und Arbeit – aus der ganzen Welt abzupumpen und Kapital nach Hause zu holen, was für ihre Fähigkeit, mehrere Bevölkerungsgruppen zu integrieren, von entscheidender Bedeutung ist.
Imperium oder Nationalstaaten
Das 19. Jahrhundert war das große doktrinäre Jahrhundert in Bezug auf die Nation. Im Westen war die Nation aus den beiden Weltkriegen, insbesondere nach 39-45, in Verruf geraten. Sie wurde mit dem „kriegsverursachenden“ Nationalismus in Verbindung gebracht … obwohl die Entkolonialisierung ihr zur gleichen Zeit aufgrund der „nationalen Befreiungsbewegungen“ in der Dritten Welt wieder ein positives Image verliehen hat.
Ab dem Ende des 20. Jahrhunderts geht die Tendenz eher dahin, die Nation für tot zu erklären – eine These, die bereits seit langem besteht:
In seiner berühmten Konferenz von 1882 (die in unserem ersten Teil untersucht wurde) zog Renan die für ihn vorhersehbare Hypothese in Betracht: „Die Nationen sind nicht etwas Ewiges. Sie haben begonnen und werden enden. Die europäische Konföderation wird sie wahrscheinlich ersetzen.“
Ein Jahrhundert später setzte der Triumph des Neoliberalismus die These vom „Ende der Nation“ durch, die weit verbreitet ist, sogar bei dem globalen Bestsellerautor Yuval Harari, der die Bedeutung von Staaten zugunsten eines entstehenden „globalen Imperiums“, das von keinem Staat und keiner ethnischen Gruppe geführt wird und von einer „multiethnischen Elite“ angeführt wird, rapide abnimmt (Sapiens, 2011, Kapitel 11).
In vom Marxismus inspirierten Worten formuliert, lässt sich diese Position wie folgt zusammenfassen: Der Nationalstaat hatte die Aufgabe, den Kapitalwettbewerb und das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit innerhalb eines Landes zu regeln, aber die heutige Ökonomie kennt keine Grenzen mehr, also ist der Nationalstaat für ein „globalisiertes“ System ungeeignet und hat aufgehört, die für den Kapitalismus wesentliche politische Form zu sein.
Diese Sichtweise speist sich aus realen Fakten, in einer Mischung aus wahr und falsch.
Die These vom Ende des Nationalstaats hat ihre Varianten, aber die meisten tendieren dazu, den Staat durch ein geopolitisches Gebilde ohne Rand und Zentrum zu ersetzen, in dem die Formlosigkeit an die Stelle des Inhalts tritt und das sich in dem Wort „Imperium“ (das im Jahr 2000 von Michael Hardt und Toni Negri in ihrem gleichnamigen Buch populär gemacht wurde) sehr gut verdichtet, einem Begriff, der elastisch und unscharf genug ist, um sich für die unterschiedlichsten Interpretationen und Diskussionen anzubieten. Das Wort „Imperium“ bezieht sich zudem auf sehr unterschiedliche historische Realitäten. Eine Überlegenheit der USA gegenüber England bestand gerade darin, kein Imperium zu sein, und diejenigen, die im letzten Jahrhundert versucht haben, Imperien aufzubauen (Nazis, Stalinisten, in geringerem Umfang Japaner), sind gescheitert. Trotz einiger Kolonien (z. B. Tibet) ist das heutige China kein Imperium, sondern ein Nationalstaat, der wie sein US-amerikanischer Konkurrent sehr groß ist.
Auch wenn sie gelegentlich Europa den USA vorziehen, zogen Hardt und Negri nicht in den Kampf gegen den US-Imperialismus. Ihr „Imperium“ ist nicht das amerikanische, das einst von den Drittweltlern angeprangert wurde (vgl. L’Empire américain, 1968 von Claude Julien veröffentlicht, der von 1973 bis 1990 Direktor von Le Monde Diplomatique war). Hardt und Negri nehmen nicht die amerikanische Hegemonie über einen großen Teil der Welt ins Visier. Sie bezeichnen einen weltweiten, sogenannten „globalisierten“ Kapitalismus als „Empire“, in dem Staaten und Grenzen im Vergleich zu einer anonymen und uferlosen Kraft, die alle Klassen absorbiert, vernachlässigbar geworden sind: Die französische, amerikanische, deutsche, chinesische usw. Bourgeoisie ist zu einer kosmopolitischen Finanzoligarchie verschmolzen, gegen die sich eine andere, ebenfalls grenzenlose Kraft, so etwas wie eine Menge, die berühmten „99 Prozent“, stellt.
Das heißt, die Frage des Staates würde umgangen. Es gäbe nur noch einen einzigen globalen Kapitalismus (aber handelt es sich dabei noch um Kapital, da diese Theorie die produktive Arbeit eines Proletariers durch einen Bourgeois als jetzt zweitrangig betrachtet?), ohne andere Grenzen als die der Polizei (auch die Arbeit würde nur noch als Mittel der sozialen Kontrolle bestehen). Dies ist die Wiederaufnahme des bourgeoisen Versprechens einer Vereinheitlichung der Welt, nur dass dieser Prozess den Weg zur Emanzipation ebnen würde: Der Kapitalismus würde seine eigene Überwindung hervorbringen. Revolutionärer Wandel ohne Revolution.
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts feierte der bourgeoise Optimismus – der auch von vielen Sozialisten geteilt wurde – die friedensstiftende Wirkung der internationalen Ökonomie. Diese Position war aufgrund der Kriege von 14-18 und 39-45 unhaltbar, wurde aber durch den Fall der Mauer 1989 und die Auflösung der UdSSR wiederbelebt. Doch das Ende des bürokratischen Kapitalismus und die zunehmende Internationalisierung des Kapitalismus haben weder Frieden geschaffen noch ein Imperium im historischen Sinne des Wortes hervorgebracht. Die USA haben nichts mit Rom, Österreich-Ungarn oder dem viktorianischen Großbritannien gemeinsam, weder in ihrer politischen Struktur noch in der Art und Weise, wie sie die Welt beherrschen. Die UdSSR hingegen hatte die zaristischen Kolonialbesitzungen übernommen (und nach 1945 einen Teil Osteuropas vasallisiert). Die bolschewistischen Machthaber widerstanden den Unabhängigkeitsbestrebungen in der Ukraine und im Kaukasus, verloren Finnland, die baltischen Staaten und einen Teil Polens und errichteten ein föderalistisch-autoritäres System, das zahlreiche „Republiken“ (oft mit bestimmten ethnischen Gruppen) umfasste. Dieses Gebäude ist verschwunden und durch etwas ersetzt worden, das nicht wie ein Imperium aussieht, und die Russische Föderation unter Putin erweist sich als nationaler als es die stalinistische oder Breschnewsche UdSSR war.
Staaten & multinationale Konzerne
Verändert die heutige „globalisierte“ Ökonomie das Wesen des Kapitalismus, indem sie ihn in eine andere Phase überführt, die sich qualitativ von der ökonomischen Internationalisierung vor 1914 (die manchmal als „erste Globalisierung“ bezeichnet wird) unterscheidet?
Die These, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts vorherrscht und sogar auf radikales Denken übergreift, besagt, dass die wahre Macht über die Welt von den Staaten auf eine Reihe großer transnationaler Firmen übergegangen ist, die in monopolistischer Konkurrenz zueinander stehen: 150 multinationale Konzerne würden die globale Ökonomie beherrschen.
Diese Position ergänzt die (bei Negri, Hardt und vielen anderen zentrale) Theorie, dass die Arbeit ihren zentralen Platz verloren hat (da der Wert angeblich nunmehr ohne Arbeit produziert wird) und nur noch als Instrument der sozialen Kontrolle bestehen bleibt. Dasselbe gilt für den Staat: Der Kapitalismus, der aus seinen alten Rahmen ausbricht, entwickelt sich nun als autonome Bewegung des Werts, der Staat hat seine Kontrollfunktion über die Ökonomie verloren, und ihm bleibt nur noch die Rolle der Repression und des sozialen Dämpfers.
Richtig ist, dass die Staaten einen Großteil der Funktionen zur Regulierung der Ökonomie, die sie seit der Krise der 1930er Jahre wahrgenommen hatten, aufgegeben haben. Wichtige Entscheidungen werden zunehmend von supranationalen Organen wie der WTO oder, anders gesagt, der Europäischen Kommission getroffen. Transnationale Firmen (TNF) entziehen sich weitgehend der staatlichen Autorität: Ihre Niederlassung in mehreren Ländern ermöglicht es ihnen, dort einzustellen, wo ein Lohnabhängiger weniger kostet und das Arbeitsrecht für den Chef am günstigsten ist, ihre Steuern dort zu zahlen, wo die Steuern niedrig sind, die Produktion von China nach Äthiopien oder von Frankreich nach Rumänien zu verlagern und zwischenstaatliche Rivalitäten auszunutzen, um auf niedrigere oder höhere Zölle zu drängen – Praktiken, die die Souveränität der Staaten über die Ökonomie und die Behandlung von Arbeit stark untergraben. Die TNF überschreiten alle Grenzen und tun so, als würden sie die Beschränkungen des Raumes ignorieren, da sie Kapital und Arbeit nach Belieben verschieben.
Aber was kontrollieren sie eigentlich?
In alten Schulbüchern las man „physische“ Karten (Relief, Flüsse usw.) und „politische“ Karten (Länder, d. h. Staaten, die durch verschiedene Farben unterschieden werden konnten). Das multinationale Universum hingegen möchte keine Länder mehr kennen, sondern nur noch Ströme. Es reduziert die Politik auf die Ökonomie und schafft so seine eigene Geografie, in der Bevölkerung und Räume ohne Materialität unendlich modulierbar erscheinen. Die TNF kontrollieren also kein Territorium, nicht weniger und nicht mehr als die früheren Unternehmen, die sich auf den nationalen Boden beschränkten. Da die Welt nicht deterritorialisiert ist, erstreckt sich die immense Macht der multinationalen Unternehmen (tatsächlich ohne historischen Vorläufer) bis zu den Grenzen ihrer Aktivitäten, bleibt dort stehen und überlässt es den Regierungen, einen Raum (und seine Bevölkerung) zu verwalten, der noch in Staaten aufgeteilt ist. Die WTO regiert eine „globalisierte“ Welt ebenso wenig wie der CNPF (früher die zentrale Organisation der französischen Arbeitgeber, heute MEDEF) das Frankreich von 1960 zur Zeit des „nationalen“ Kapitalismus regierte.
Die Szenarien einer von multinationalen Konzernen beherrschten Welt sind nur in Extremfällen von „Bananenrepubliken“ überprüfbar, in denen große Konzerne de facto Macht ausüben, in der Regel dort, wo eine extraktive Monoindustrie (Bergbau, Öl, Gas) und keine verarbeitende Industrie vorherrscht. Gabun, das die Hälfte seiner Ressourcen aus Erdöl bezieht, lebt in der Abhängigkeit von Shell und Total. Aber Total wäre nicht das, was es ist, ohne den französischen Staat, der allein über Legitimität verfügt, über eine sozio-politische Basis, die seine Stärke in Frankreich und anderswo ausmacht, und seine Soldaten ständig auf gabunischem Territorium stationiert.
Natürlich sind die Bourgeois mehr auf ihre Profite als auf den Wohlstand eines Herkunftslandes bedacht, und die übergreifenden Interessen der transnationalen Firmen lösen sie von dem, was für ein bestimmtes Land vorteilhaft wäre. Ist Renault (rechtlich gesehen eine Gesellschaft nach niederländischem Recht) französisch, japanisch oder keines von beiden?
Dennoch arbeiten die meisten transnationalen Firmen angelehnt an einen Nationalstaat, von dem sie abhängig sind, ohne von ihm geleitet zu werden. Jeder hat seinen eigenen Bereich. Mit geteilten Funktionen: Die TNF tragen dazu bei, die Souveränität der Staaten zu verringern, die multinationale Unternehmen als Machtfaktoren gegenüber anderen Ländern einsetzen. Obwohl 30 % der Anteilseigner von Total aus den USA kommen (d. h. etwas mehr als aus Frankreich), ist Total, wie der Vorstandsvorsitzende 2018 erklärte, „der einzige nicht angelsächsische Großkonzern“ in der Öl- und Gasbranche. Im „ökonomischen Krieg „ stehen sich nicht General Motors und Volkswagen, Airbus und Boeing oder Lenovo und Apple gegenüber, sondern Länder und Staaten, auf die sich diese Unternehmen von globaler Dimension stützen. Nur sind die „Einflusssphären“, ihre Abgrenzung und ihre Entwicklung nicht mehr mit denen der Kolonialzeit vergleichbar.
Wenn Identität zu einer historischen Realität wird
Was als „Identität“ bezeichnet wird, baut auf dem Teilen einer gelebten Erfahrung auf, die eine gemeinsame „Herstellung der materiellen Lebensbedingungen“ voraussetzt. Ein kollektives Bild wird dann durch Gewohnheiten und Riten verfestigt und in Institutionen geformt, insbesondere in Schulen und Universitäten, sofern diese existieren: Um den nationalen Bestrebungen im späteren Polen und Litauen entgegenzuwirken, setzten die Gouverneure des Zaren im 19. Jahrhundert die russische Sprache durch und schlossen die Universitäten in diesen Ländern. Anderswo, wie in Estland und Finnland, wurden Ursprungsmythologien verfasst, die auf lokaler Folklore und Legenden basierten. Später konnte in Osteuropa und Lateinamerika sogar die moderne Kunst (insbesondere der Kubismus) zu einer (erfolgreichen oder nicht erfolgreichen) nationalen kulturellen Selbstbestätigung beitragen: Der Stil war international, die Themen autochthon oder sogar indigenistisch, durch die Rückbesinnung auf neu erfundene populäre Traditionen.
Viele, die sich für eine Identität einsetzen, wollen diese in einer Nation verkörpern: Nur wenigen gelingt dies, nicht wegen des Charakters dieser Identitäten, sondern wegen der fehlenden soziopolitischen Voraussetzungen. Die „Queer Nation“ ist ein Schlachtruf, ein Instrument der Mobilisierung. Der im 20. Jahrhundert im Black Belt der mehrheitlich schwarzen Landkreise des amerikanischen Südens geforderte schwarze Staat war immer nur ein Slogan, und die Nation of Islam nur der Name einer politischen Organisation. Die Schaffung eines Staates, und erst recht eines Nationalstaates, erfordert mehr als die Selbstdefinition einer Identität.
Der Historiker Ernest Gellner zählte 2.000 potenzielle Nationen: Warum bringen so wenige von ihnen tatsächliche Nationalismen hervor? Oder gar Nationalstaaten?
Eine nationale Identität beruht auf einer populären Bewegung im Sinne eines Volkes, das verschiedene Klassen vereint. Aber dieses Volk-National setzte in dem einen oder anderen Grad, zu dem einen oder anderen Zeitpunkt, einen Ethnozentrismus voraus, eine vorrangige „Basis“ im Fundament der Nation, die sie gegen den äußeren Feind absicherte: Ein Zusammenwirken ethnisch-kultureller Realitäten war für den Aufbau der Nation notwendig, aber nicht ausreichend. Anschließend wurde dieses ursprüngliche Fundament nach und nach, nicht ohne Schwierigkeiten, mit externen Beiträgen aggregiert, die im Laufe der Zeit dazu tendierten, sich zu integrieren. Außer im Falle eines Landes wie Israel, das nicht der Staat aller seiner Staatsbürger ist, sondern eine Heimat für Juden aus der ganzen Welt, und daher nicht dazu berufen ist, Juden und Araber, die auf seinem Territorium leben, gleich zu behandeln.
Die kapitalistische Gesellschaft (re-)produziert ihre Unterschiede und Ungleichheiten aus dem, was bereits vor ihr existiert und was sie im Falle von Krisen und Instabilitäten aufgreift und neu gestaltet. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte ein Teil Frankreichs ein „jüdisches Problem“, doch der politische Judenhass der Dritten Republik hatte wenig mit dem religiösen Antisemitismus des Mittelalters zu tun. Früher wurde der Jude wegen seiner Religion ausgegrenzt, nun wird ihm das Gegenteil vorgeworfen: getrennt von einer politischen und sozialen Gemeinschaft zu leben. Im ehemaligen Jugoslawien war die nach 1945 geschaffene muslimische (sic) Nationalität eine einfache administrative Klassifizierung: Die Aufteilung in sechs „sozialistische Republiken“ beruhte auf geografischen und nicht auf religiösen oder kulturellen Grundlagen. Als das Land jedoch auseinanderbrach, wurde der bosnische „Muslim“ Teil einer spezifischen geopolitischen Einheit. Obwohl nicht alle unter diesem Namen zusammengefassten Personen slawischer Abstammung diese Religion praktizieren, können sie durch diese Klassifizierung von den (orthodoxen) „Serben“ und den (katholischen) „Kroaten“ unterschieden werden, zwei Gruppen, die selbst weit davon entfernt sind, ihrer jeweiligen Definition zu entsprechen. Ende des 20. Jahrhunderts empfanden einige Norditaliener ihre Landsleute aus dem Süden als eine Last, von der sie sich befreien wollten. Noch näher an der Gegenwart sind die Ukrainer im Osten des Landes, die bis dahin einfach nur russischsprachig waren und sich nun als „Russen“ fühlen. Unendlich viel stärker und tödlicher ist das Phänomen in afrikanischen Ländern, die kaum vereint sind und keine wirkliche nationale Identität haben.
Zerfall
Vor 1991 hatten nur wenige damit gerechnet, dass mitten in Europa ein Krieg das einstige Jugoslawien zehn Jahre lang zerreißen würde. Nicht weit davon entfernt blieben nationale Spannungen, die sich zu Nationalismus, Separatismus und sogar zu einem kriegerischen Höhepunkt steigerten, an den Rändern oder Enden der europäischen Länder im Bereich des Möglichen (gehört die Ukraine zum slawischen oder zum europäischen „Gebiet“? „Die Geografie dient in erster Linie dazu, Krieg zu führen“, so Yves Lacoste in einem Essay, der 1976 unter diesem Titel veröffentlicht wurde).
In beherrschten und unendlich viel schwächeren Ländern führt die nationale Nichtexistenz zu einer Zersplitterung (Syrien, Irak) oder zu einem unermüdlich verwalteten Durcheinander in Form von staatlicher und bandenmäßiger Gewalt. Im Kongo, der wie die meisten seiner Nachbarn in eine bourgeoise Moderne eingetreten ist, die ihrer materiellen Grundlagen beraubt wurde, decken die Zeichen der staatlichen Autorität (Währung, Flagge, Hymne, Briefmarken…) keinerlei Realität ab. Politische Mächte, die ständig zerfallen und sich neu formieren, verwalten Gebiete, in denen eine Vielzahl von Clans (familiäre, ethnische, religiöse oder eine Mischung aus allen drei) mit ausländischen Großmächten Handel treiben. Es gibt weder eine „kongolesische“ Nation noch ein „kongolesisches“ Volk, sondern nur die Zugehörigkeit zu dieser oder jener bestimmten Gruppe (früher sagte man „Stamm“, heute „Ethnie“).
Ohne uns hier auf geopolitisches Terrain zu begeben, fragen wir einfach, wie tragfähig eine Weltordnung ist, die zwar herrscht, aber nur noch ihre eigene Unordnung regiert. Gehen die herrschenden kapitalistischen Länder gestärkt oder erschüttert daraus hervor? Die Krisen im Kapitalismus sind keine Krisen des Kapitalismus, aber die Brüche im politischen und ökonomischen System begünstigen dennoch seine Infragestellung.
Die globale Organisation des Kapitalismus ist selten die eigentliche Ursache der afrikanischen oder nahöstlichen Konvulsionen: Aber sie bestimmt ihre Entwicklung und, wenn es sie gibt, ihre Lösung. In diesen Regionen dient der Nationalismus nicht der Entwicklung eines eigenständigen Kapitalismus, sondern politischen Mobilisierungen – ein Instrument, das im Übrigen von sehr relativer Wirksamkeit ist, da es von anderen regionalen, ethnischen und/oder religiösen Kräften konkurrenziert wird.
Das kapitalistische Paradoxon besteht darin, aus getrennten Individuen eine Gemeinschaft zu machen, Homogenes mit Heterogenem zu verbinden.
Dazu muss man allerdings die Mittel haben.
Ein Binnenmarkt oder staatlich garantiertes Privateigentum reichen dafür nicht aus. Diese Elemente waren auch in früheren Gesellschaften ohne Nationalstaat vorhanden. Die historische Verbindung zwischen Kapitalismus und Nation besteht in der Notwendigkeit, die Mitglieder der beiden Klassen in einem wertschöpfenden und wettbewerbsfähigen Verhältnis zwischen Kapital und lohnabhängiger Arbeit zu vereinen. Dies ist trotz ihres sagenhaften Reichtums nicht der Fall in Abu Dhabi oder Dubai (die jetzt vor allem auf Tourismus setzen) oder Katar (Gasproduzent und sonst wenig), deren Milliardeneinkommen von einem Weltmarkt abhängen, den sie nicht beherrschen. Keine Unabhängigkeit ohne einheimische Industrie, und wer an eine Ökonomie des Immateriellen glaubt, kann sich die Statistiken über die Stahlproduktion ansehen.
(Des)Europäische Union
Es gibt keine politische (oder militärische) Einheit Europas: Das Zusammenzählen von Nationen macht noch keine föderale Struktur daraus. Es gibt in erster Linie einen riesigen Markt (den drittgrößten der Welt mit über 500 Millionen Verbrauchern), der auf die Interessen des (europäischen und außereuropäischen) Kapitals zugeschnitten ist, das in die globale Produktion und den Handel integriert ist.
Was die Bourgeoisie in Europa trennt, ist nicht die unvermeidliche Vielfalt, wenn 28 Länder zusammenkommen, und auch nicht die Konkurrenz zwischen „großem“ und „kleinem“ Kapital oder zwischen „Monopolkapital“ und „nichtmonopolistischem Kapitalismus“. Der Unterschied – und der Gegensatz – besteht zwischen Kapital, das in der Lage ist zu exportieren (oder sich eine Nische auf dem verbleibenden geschützten nationalen Markt zu sichern), und Kapital, das schlecht gerüstet ist, um der Konkurrenz aus dem Ausland (aus anderen europäischen Ländern oder von außerhalb Europas) standzuhalten.
Um lebensfähig zu sein, muss eine Nation als Instrument für den Wettbewerb zwischen kapitalistischen Entwicklungszonen dienen, wobei beispielsweise englische Arbeit und englisches Kapital gegen US-amerikanische Arbeit und US-amerikanisches Kapital antreten. Diese Opposition ist in der Regel friedlich, schließt aber einen militärischen Ausgang nie ganz aus.
Die katalanischen und schottischen Forderungen sind keineswegs ein Beweis für die Überholtheit des Nationalstaats, sondern zeigen, dass der Kapitalismus sich die politischen und territorialen Rahmen geben muss, die seiner aktuellen Situation am besten entsprechen, und diese gegebenenfalls ändern muss. Der Kapitalismus ist kein reiner, von der Materie losgelöster Wertstrom: Er erfordert Grenzen, aber diese können sich ändern.
Belgien, das 1830 als Staat gegründet wurde, hat immer zwei ökonomisch und sozial ungleiche Bevölkerungsgruppen miteinander verbunden. Die Wallonie, die im 19. Jahrhundert die wohlhabendste Region war, erlebte einen Niedergang ihrer Industrien und Bergwerke und das Kräfteverhältnis kehrte sich zu Gunsten Flanderns um. Darüber hinaus ist Belgien eines der europäischen Länder, in denen das Gewicht ausländischer Firmen am größten ist und die Bourgeoisie am wenigsten „national“ ist. Belgien symbolisiert eine Europäische Union, die kaum mehr als eine Ökonomie ist, in der Brüssel einer Nicht-Hauptstadt gleicht und weder das Herz eines vereinten Landes noch das Gehirn ist, das einen kohärenten transnationalen politischen Block steuert. Das baufällige belgische Haus knirscht und hält sich nur, weil es von allen herrschenden Kapitalismen unterstützt wird, die ein Interesse an seinem Fortbestand haben.
In Spanien waren zwei der dynamischsten Regionen, jede mit einer anderen Sprache als dem Kastilischen, das Baskenland und Katalonien (dessen BIP 2014 höher war als das von Finnland), lange Zeit Zentren der Unabhängigkeitsbewegung. Die aktuelle kapitalistische Krise belebt die zentrifugalen Tendenzen in einem Katalonien, das bereits eine weitgehende Autonomie genießt. Wenn es sich eines Tages von Spanien löst, wird es einen neuen Nationalstaat gründen.
In Schottland leben 100.000 Menschen von der Ölförderung, Edinburgh ist die sechstgrößte Stadt in Europa und die Royal Bank of Scotland die fünftgrößte Bank der Welt. Der Traum von einer vorteilhaften Sezession wird übrigens von einem Teil der lokalen Proletarier geteilt. Da Wahlen einen Sinn haben, haben sich die Stimmen der schottischen Arbeiter, die früher mehrheitlich für Labour abgegeben wurden, in großem Umfang auf die Scottish National Party (eine gemäßigte sozialdemokratische Partei, die sich für eine schottische Unabhängigkeit einsetzt) übertragen. Im Unterhaus hatte die erstere 1997 56 Sitze, die letztere 6: 2017 zählte die schottische Labour Party 7 Abgeordnete, die SNP 35.
Was auch immer aus einem unabhängigen Flandern oder „Padanien“ (beides noch Chimären) wird, wie in Katalonien und Schottland, der Regio-Nationalismus ist ein Versuch, sich auf eine vermeintlich festere und kohärentere Basis zu besinnen, indem man sich vom toten Ballast ökonomisch schwacher Gebiete abschneidet. So wie die EU sich die Illusion einer Einheit gibt, obwohl sie nur ein Markt ist, glauben reiche Regionen, sie könnten lebensfähige politische Einheiten schaffen, indem sie sich auf eine gemeinsame Vergangenheit, kulturelle Traditionen und sogar eine spezifische Sprache berufen.
Dass sich die Identität zurückzieht und aus einer Provinz eine Nation machen will, zeigt die Abnutzung einer „integrativen“ Fähigkeit, die durch den internationalen Druck geschwächt wird, aber auch die Hoffnung, ihr durch den Rückzug auf eine Bastion zu entkommen, die im globalen Wettbewerb angeblich produktiver ist.
Die „Nationalität des Arbeiters“?
In der Europäischen Union sucht ein Teil der Kleinunternehmen und des lokalen Handels, deren Aktivitäten sich innerhalb eines nationalen Raums abspielen, einen Schutzwall in einem Neo-nationalismus. Auch Beamte und Angestellte der collectivités territoriales1, Krankenhäusern, der Post usw. können sich vorstellen, dass ein „Souveränismus“ verhindern würde, dass der „Abbau öffentlicher Dienstleistungen“ weitergeht.
Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass die „nationale“ Neigung nur Angehörige der sogenannten Mittelschicht betreffen und den Proletarier immer verschonen würde. Marx‘ (in unserem ersten Teil zitierte) zutreffende Behauptung, dass „die Nationalität des Arbeiters nicht französisch, englisch oder deutsch ist, sondern die Arbeit“, gilt nur unter der Bedingung, dass man auch zugibt, dass die Arbeit selbst eine nationale Realität haben kann. Der „Arbeiternationalismus“ ist die Form, die der Reformismus annimmt, wenn er sich im Rahmen eines Landes verschanzt, um eine hypothetische Bedrohung von außen abzuwehren. Mangels Kampf und Klassenbezug entdecken Arbeiter, ob mit oder ohne Job, (wieder) eine Zugehörigkeit, die sich aus anderen Kriterien zusammensetzt, Markierungen, die aus einer neu erfundenen Vergangenheit heraufbeschworen werden. Es spielt also keine Rolle, ob es sich bei den „ethnischen“ Angaben um Realität oder Mythos handelt, wenn ihre Mobilisierungsfähigkeit sie zu einer historischen Kraft macht. Das Gemeinsame wird zum Gemeinschaftlichen. Der Hafenarbeiter von Antwerpen war Arbeiter und Belgier: Jetzt ist er Flämisch.
Aber genauso wenig wie der Reformismus ist die Bindung des Proletariers an ein Land (oder eine Region) ein unabwendbares Schicksal: Die identitäre Einschließung ist selten endgültig. Aus ihr kann man sich jedoch nur durch eine neue Kampfgemeinschaft befreien.
Offene und geschlossene Nation
Offenheit und/oder Schutz, Pazifismus und/oder Militarismus – diese Optionen haben oft zu innerbourgeoisen Konflikten innerhalb eines Landes geführt. Einige Historiker unterschieden zwischen den Arbeitgebern in Manchester, die Konsumgüter exportierten und deshalb den freien Handel und eine Friedenspolitik befürworteten, und den Arbeitgebern in Birmingham, die militaristisch waren, weil sie sich auf eine rüstungsproduzierende Schwerindustrie spezialisiert hatten. In der Weimarer Republik war es üblich, zwischen Krupp, einem Stahlriesen und Waffenhersteller, und Rathenau, dem Chef von AEG, der elektrische Geräte für den Endverbraucher herstellte, zu unterscheiden. Tatsächlich war die gesamte Industrie (einschließlich AEG) an der Militärproduktion beteiligt, die Interessen kreuzten sich, und angesichts der Unordnung schloss sich die gesamte deutsche Bourgeoisie schließlich Hitler und seiner kriegerischen Flucht nach vorn an (Rathenau war 1922 ermordet worden). Die Bourgeoisie ist nicht in zwei klar voneinander getrennte „Klassenfraktionen“ gespalten, die im Laufe der Geschichte jeweils ihre Interessen und damit ihre spezifische politische „Linie“ vertreten haben.
Auf der politischen Bühne, der Bühne der Parteien und Regierungen, hat das Auf und Ab der beiden Optionen – Liberalismus und Protektionismus – hingegen regelmäßig Rivalitäten genährt.
Anfang des 21. Jahrhunderts präsentiert sich auf beiden Seiten des Atlantiks ein Lager als Vorkämpfer für Modernität und Freiheit, die von nationalistischen Xenophoben bedroht werden, während ein gegnerisches Lager sich als Verteidiger der kleinen Leute gegen eine „staatenlose Finanzoligarchie“ versteht. Führende europäische Politiker befürworten eine Einwanderung, die die Arbeitskosten senkt, während andere die Identitätsschübe ausnutzen und für eine Verengung auf den nationalen Rahmen plädieren.
Am Tag nach der Wahl schmelzen die absoluten Zahlen jedoch zu relativen. Trump gibt den entlassenen Stahlarbeitern und Bergleuten im Mittleren Westen und im Gebiet der Großen Seen nicht ihre Arbeitsplätze zurück, und der Austritt aus dem Euro steht nicht mehr auf dem Programm von Marine Le Pen. Der bourgeoise Pragmatismus braucht Grenzen, wo Zölle seinen Interessen dienen, während er gleichzeitig diese Grenzen für billigere Arbeitskräfte öffnen möchte, aber in der demokratischen Arena nimmt diese theatralische Kluft die Gestalt einer grundlegenden historischen Herausforderung an.
Es gibt keinen Widerspruch zwischen der „globalisierten“ Kapitalakkumulation und der Existenz souveräner Staaten auf „ihrem“ Territorium. Sowohl die USA als auch China setzen alles daran, den freien Weltmarkt für ihre wettbewerbsfähigsten Produkte durchzusetzen, während sie gleichzeitig ausländische Produkte, die mit ihren eigenen konkurrieren, von ihrem eigenen Binnenmarkt fernhalten. Kleine Länder, die als illiberal bezeichnet werden (Polen, Ungarn, jetzt kommt noch Italien hinzu), haben kein Monopol auf „nationalistische“ Regierungen: Auch die großen kapitalistischen Mächte (USA, Indien, China, Russland) produzieren solche Regierungen.
Im letzten Jahrhundert gab es Versuche, relativ geschlossene „Blöcke“ zu bilden: Nazi-Deutschland und das japanische Kaiserreich. Selbst das Land, das als Symbol des Freihandels galt, geriet in Versuchung: Nach der Weltwirtschaftskrise von 1930 plädierte der Labour-Politiker und spätere Faschist Oswald Mosley dafür, dass sich England in eine homogene Ökonomie eingliedern sollte, die billige Agrarprodukte und Rohstoffe aus dem Commonwealth importieren und ihre Fertigwaren an das Commonwealth verkaufen sollte, geschützt durch Zollschranken.
Trotz seiner riesigen Kundgebungen hatte Mosley nie Einfluss auf eine herrschende Klasse, die eine andere Politik brauchte. Der modernste englische und amerikanische Kapitalismus besiegte zuerst den halbautarken Block der Nazis und dann den bürokratischen Kapitalismus Stalins.
Heute ist die „Rückkehr zum Protektionismus“ eher ein journalistisches Thema als ökonomische Politik: Freihandel und „Souveränität“ werden ebenso kombiniert wie sie sich widersprechen, aber nirgends ist die Zukunft geschrieben. Dasselbe gilt für die „Rückkehr des Nationalismus“. Nur eines ist sicher: Wenn wir uns nicht vorstellen, dass der Kapitalismus sein Wesen geändert hat, wird der „ökonomische „ Krieg früher oder später zum Krieg überhaupt, unter vielfältigen und jedes Mal unerwarteten Umständen und in vielfältigen Formen.
G.D., Februar 2019
Hinweis
Nation, Klasse, Klassenkampf, Staat, Volk, Identität … alles Fragen, denen „die Gelbwesten“ im Moment eine brennende Aktualität verleihen.
Bis wir vielleicht etwas über diese Bewegung veröffentlichen, zitieren wir nur diesen Auszug aus einem Appell von „Gelbwesten“ aus dem Pariser Osten (Januar 2019): „Die Bewegung der Gelbwesten endet an den Türen der Unternehmen, d. h. dort, wo die totalitäre Herrschaft der Arbeitgeber beginnt. Dieses Phänomen ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Halten wir drei fest: 1) Die Atomisierung der Produktion, die dazu führt, dass viele Lohnabhängige in (sehr) kleinen Unternehmen arbeiten, wo die Nähe zum Arbeitgeber die Möglichkeit eines Streiks sehr erschwert. 2) Die Unsicherheit eines Großteils der Lohnabhängigen, die ihre Fähigkeit, in den Betrieben Konflikte auszutragen, erheblich beeinträchtigt. 3) Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit, die viele Proletarier aus der Produktion herausdrängen. Ein großer Teil der Gelbwesten ist von mindestens einer dieser drei Determinationen direkt betroffen. Die andere Komponente der Lohnabhängigen, die in großen Unternehmen schuftet und über eine größere Arbeitsplatzsicherheit (unbefristeter Arbeitsvertrag und Status) verfügt, scheint unter einer Glocke zu sein, an der die mächtige Kraft der Bewegung zerbricht wie die Welle am Felsen.“
Korrespondenz: [email protected]
Lektüre
Shlomo Sand, De la nation et du peuple juif chez Renan, Les Liens qui libèrent, 2009.
Jean-François Daguzan, La fin de l’État-Nation? De Barcelone à Bagdad, CNRS Editions, 2015. Eine Gegenthese zu unserer, aber eine gute Zusammenfassung des Problems. Andere Version: https://www.diploweb.com/La-fin-de-l-État-Nation-Surprise.html
Suzanne Berger, Notre première mondialisation (Unsere erste Globalisierung), Seuil, 2003.
Zur Stahlindustrie und -produktion: Le Prolétaire, Oktober-November 2018, „Le capitalisme mondial de crise en crise“ (Der globale Kapitalismus von Krise zu Krise).
„Jedes Jahr verbraucht die Welt so viel Stahl wie im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg“. Pierre Veltz, La Société hyper-industrielle. Le Nouveau capitalisme productif, Seuil, 2017.
Ernest Gellner, Nations & Nationalismes (1983), Payot, 1989.
Wladimir Andreff, Les Multinationales Globales, La Découverte-Repères, 2003.
El Mouhoub Mouhoud, Mondialisation & délocalisation des entreprises, La Découverte-Repères, 2013.
Alain Deneault, „Total, un gouvernement bis“, Le Monde Diplomatique, August 2018.
Adam Tooze, Le Déluge, 1916-1931. Un nouvel ordre mondial, Les Belles Lettres, 2015.
Hérodote, # 58-59, 1990, „A l’Est & au Sud“. Analysen zu Österreich, den baltischen Staaten, der Ukraine, dem europäischen Osten und der späteren Slowakei, die vor dem Ende der UdSSR und dem Zerfall Jugoslawiens verfasst wurden.
G. Dauvé, 10 + 1 questions sur la guerre du Kosovo.
Marx, Critique de l’Économie nationale, 1845, Anmerkungen zu Friedrich List und seinem Système national de l’économie politique: ein Text, in dem Marx im Übrigen die Arbeit als Arbeit kritisiert und erklärt, dass es nicht darum geht, sie zu befreien, sondern sie abzuschaffen.
Über den zeitgenössischen Zerfall eines Teils des Nahen Ostens und wie die Großmächte, die dort keine Ordnung herstellen können, sich bemühen, die Unordnung unter Kontrolle zu halten, lese auf ddt21.noblogs.org :
G. D., Brouillards de guerre (Juni 2016 ).
Tristan Léoni, „Kalifat und Barbarei. Erster Teil: Vom Staat“ (Dezember 2015), „Kalifat und Barbarei. Zweiter Teil: Von der Utopie“ (Dezember 2015), „Kalifat und Barbarei: Warten auf Raqqa“ (Juli 2016). (A.d.Ü., auf deutscher Sprache hier alle Texte)
Das Ende Jugoslawiens ist ein Beispiel dafür, wie Klassenkämpfe und „ethnische“ oder nationale Fragmentierungen ineinandergreifen können: Anonymous, De la grève à la guerre, 1984-1992.
Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme & racisme en France (XIXe-XXe siècles), Fayard, 2007.
1A.d.Ü., Eine collectivité territoriale (französisch; vollständig: collectivités territoriales de la République, vor der Verfassungsänderung vom 28. März 2003 auch collectivités locales) ist in Frankreich eine juristische Person des öffentlichen Rechts.
]]>
Aus der letzten Ausgabe von Antipolitik, der Nummer Drei, die Übersetzung ist von uns. Mehr Texte gegen den Nationalismus.
Dieser Text ist das erste Kapitel einer Veröffentlichung mit dem Titel „Einer ist der Feind… die Nation, der Antiimperialismus und die antagonistische Bewegung“ der Gruppe gegen Nationalismus aus dem Jahr 2007. Diese Gruppe war Teil der Hausbesetzung und Vollversammlung Fabrika Yfanet, die immer noch in der Stadt Thessaloniki aktiv ist. Anlässlich des Pogroms vom 4. September 2004, nach der Niederlage der griechischen Fußballnationalmannschaft gegen Albanien, erkannte das Kollektiv die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Nationalismus-Patriotismus auseinanderzusetzen. Eine kleinere Gruppe beschloss auf der Vollversammlung, sich stärker mit dem Thema zu befassen und die bestehende Analyse zu vertiefen.
Wir glauben, dass dieser Text auch heute, 14 Jahre später, noch viel zu bieten hat, wenn es um die Frage geht, was eine Nation ausmacht und aus welchen Elementen sich der Nationalismus speist. Das ist wichtig, weil wir dem Nationalismus weiterhin in Schulen, auf Plätzen, bei Protesten und sogar in sozialen Bewegungen begegnen. Wir glauben, dass ein Projekt wie dieses ein erster Schritt zu seiner Dekonstruktion sein kann.
(Antipolitika # 3) Das nationale Phänomen
In dem bekannten Witz Stalin in Wien1 stellt ein russischer Künstler ein gleichnamiges Gemälde aus, das die angebliche Frau Stalins allein im Kreml zeigt. Nach der berechtigten Frage des Offiziers: „Und wo ist Stalin [auf dem Gemälde]?“ wird die unmittelbare Antwort mit einer Prise schlechten Humors serviert: „In Wien“. Beide Protagonisten dieses Witzes wissen genau, verheimlichen es aber eifrig, dass der „prächtige Georgier“ im Winter 1913 in Wien war. Dort war er als Lenins Gesandter „dabei, einen großen Artikel zu schreiben“2, den berüchtigten „Marxismus und die nationale Frage“, in dem uns der zukünftige Generalsekretär eine Definition der „Nation“ vorlegt, die auf fünf objektiven Kriterien beruht: Sprache, Territorium, ökonomisches Leben, Psyche und Kultur. Wenn man alle diese Kriterien erfüllt, kann man als „Nation“ angesehen werden.
Abgesehen von dem morbiden Verweis auf Stalin hat das Bemühen um eine objektive Definition der Nation viele Varianten hervorgebracht, bei denen eine Nation entweder über die Sprache oder über die Religion, in anderen Fällen über die gemeinsame Herkunft, die Tradition, die Geschichte, die gemeinsamen Lebenserfahrungen, die politischen Rechte, die patriotische Loyalität usw. definiert wird.
Im Großen und Ganzen gehören alle diese Definitionen zu einem Bereich, in dem auf der einen Seite das „Nation-Blut“, die deutsche romantische Auffassung, die die „ kulturellen Kriterien „ (Sprache, Religion, Territorium, Rasse) betont, und auf der anderen Seite der „Nation-Vertrag“, die französische oder selektive Auffassung, die die „politischen Kriterien“ (Rechte, Gesetze, politisches Bewusstsein, Erinnerung) betont, zu finden sind. Beide Ansätze führen schnell in eine methodologische Sackgasse. Ein Bestreben, das über die aktuellen Nationalismen hinausgeht und versucht, universelle und stabile Kernelemente einer Nation zu finden, ist zum Scheitern verurteilt.
Selbst die stärksten Anhaltspunkte des nationalistischen Arsenals können logisch untersucht werden. Die Sprache, die als das am wenigsten zweideutige Symbol der nationalen Identität gilt, erweist sich als unzureichend, wenn man Menschen betrachtet, die dieselbe Sprache sprechen, ohne sich einer gemeinsamen nationalen Identität bewusst zu sein (z. B. Amerikaner, Australier, Neuseeländer), aber auch die Nationalstaaten, die ihre Einheit ohne eine einzige Landessprache bekräftigen (z. B. die Schweiz). Auch die Religion kann der gleichen Kritik unterworfen werden. Die religiöse Vielfalt, die in den USA besteht, hat nie die Gefahr mit sich gebracht, das Land in viele getrennte Nationen aufzuspalten, während andererseits Länder wie Italien und die Philippinen, die einen gemeinsamen katholischen Glauben teilen, sich nicht als Teil einer gemeinsamen „katholischen Nation“ fühlen. Der gemeinsame rassische Ursprung und seine biologische Grundlage entbehren jeder ernsthaften historischen oder wissenschaftlichen Grundlage. Die Vermischung der Menschen untereinander ist ein ständiger Bezugspunkt in Raum und Zeit. Auch die Hingabe an eine Verfassung und die Anerkennung von Bürgerrechten für Inhaber einer nationalen Staatsbürgerschaft verschaffen den vermeintlich Einheimischen nicht die erforderliche gesellschaftliche Legitimation, auch nicht für Einwanderer der zweiten oder dritten Generation. Der Fall der modernen französischen Republik und ihre Unfähigkeit, Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien aufzunehmen, selbst wenn sie als französische Staatsbürger anerkannt werden, ist bezeichnend. Im Grunde gibt es weder eine heuristische Methode noch ein objektives Kriterium, um zu bestimmen, wo und wann wir eine Nation haben. Mit dem Konzept der Nation verhält es sich wie mit dem Mythos des Proteus. Jedes Mal, wenn wir denken, wir hätten es verstanden, entpuppt es sich als etwas Schwer fassbares.
Die Lösung könnte in der subjektiven Wahrnehmung der Nation zu finden sein. Renan sagt, dass die „Nation das ist, was eine Gruppe von Individuen definiert“, was bedeutet, dass eine „Nation unser Wille ist, eine Nation zu werden“. Die Priorität für das, was eine Nation ausmacht, sollte nicht auf den bewussten politischen Willen oder die rationale Planung abzielen, sondern vielmehr auf die Vorstellungskraft. Eine Nation ist das, was eine Gruppe von Menschen als solche empfindet und sich vorstellt. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die rassische Kontinuität oder die kulturelle Einheit als Mythen erweisen, die durch rationales Denken kritisiert werden. Sobald einige Menschen diese Mythen für gültig halten, neigen sie dazu, konkrete Ergebnisse in Bezug auf die Kohärenz und ihre sozialen Praktiken zu erzielen. In gleicher Weise sind der Gesellschaftsvertrag und das Sozialreferendum von Renan in der politischen Wahrnehmung der Nation sowohl Phantasiegebilde als auch gleichzeitig in der Realität wirksam für diejenigen, die sich auf sie als verbindliches Band berufen. Kurzum, wir kommen auf den Punkt von Benedict Anderson: Nationen sind imaginierte Gemeinschaften3, und damit wird ergänzt, was Etienne Balibar erklärt hat; unter bestimmten Umständen sind nur imaginierte Gemeinschaften real.
Die subjektive Wahrnehmung bietet eine Perspektive, beendet aber nicht das Gespräch über die Nation. Die oben als Teil der objektiven Wahrnehmung hervorgehobenen Elemente (Blut, Rasse, Territorium, politische Rechte) sind unerlässlich, um die historischen Marksteine oder die historische Dynamik zu überprüfen, die zur Entstehung unterschiedlicher, einem Raum und einer Zeit zugeordneter Vorstellungen von der Nation geführt haben. Die individuelle Untersuchung spezifischer historischer Nationen und Nationalismen geht über die Ziele dieses Textes hinaus. Wir werden versuchen, uns auf einer abstrakteren Ebene zu bewegen; dies ist unser methodischer Bezugspunkt. Um jedoch den Begriff der Nation gründlich zu beleuchten, werden wir uns mit zwei weiteren Begriffen befassen: nationalistische Ideologie und nationale Identität.
i. nationalistische Ideologie
Um sich dem Nationalismus als Ideologie zu nähern, bedarf es einer Vorstellung von der Ideologie selbst. Mit einer gewissen relativen Zweideutigkeit können wir sagen, dass Ideologie „mehr oder weniger eine systematische Reihe von Ideen und Vorstellungen ist, die Macht- und Souveränitätsverhältnisse rechtfertigen und rationalisieren, aber auch Individuen auf so drastische Weise integrieren „4. Um Althusser zu zitieren: „Ideologie funktioniert so, dass sie Subjekte rekrutiert“. Eine methodologische Anmerkung: Der hier gewählte Ansatz zur Ideologie ist weit entfernt von der doktrinären Sichtweise einiger Marxisten, die Ideen mit der objektiven Realität der Produktionsverhältnisse in Verbindung bringen und dabei den Begriff „falsches Bewusstsein“ oder „die subjektive Manipulation der objektiven Wahrheit“ verwenden. Ideologien können Ungereimtheiten und Antinomien beinhalten oder instabile und widersprüchliche Prinzipien aufstellen, aber sie sind Teil der Realität, weil ihre Folgen völlig real sind. Der Beziehung zwischen Subjekt und Wirklichkeit und der einseitigen Bestimmung des Subjekts durch das Subjekt oder umgekehrt werden wir „die entscheidende Ambivalenz unserer menschlichen Präsenz in unserer eigenen Geschichte entgegensetzen, als Teilsubjekte, Teilobjekte, als freiwillige Agenten unserer eigenen unfreiwilligen Bestimmungen“5. „Es ist wahr, dass die Menschen die Geschichte nicht nach ihrem Willen machen und dass ihre bewussten Ziele nicht immer mit den tatsächlichen Ergebnissen übereinstimmen: aber sie führen auch keine im Voraus festgelegte Ordnung aus; sie sind nicht gezwungen, eine Grundstruktur zu durchleben, die sie nicht kennen“6. Daher ist die soziale Realität weder außerhalb des menschlichen Zugriffs noch unabhängig vom Handeln und Denken der sozialen Subjekte. Die sozialen Subjekte können also nicht außerhalb der sie umgebenden sozialen Realität verstanden werden. Sie sind gleichzeitig deren Geschöpfe und Schöpfer7.
Aber warum sollten wir den Nationalismus als Ideologie betrachten und nicht als ein Konzept, das zur gleichen Kategorie gehört wie die Verwandtschaft im anthropologischen Sinne des Wortes oder die Religion als anthropologisches Ideensystem, wie Benedict Anderson vorschlägt? Wie bei jeder anderen Ideologie der Moderne wird auch im Nationalismus die Berufung auf einen außersozialen Experten wie Gott durch die Notwendigkeit von Ideen ersetzt, die auf Beweisen und Argumenten empirischer, weltlicher und nicht metaphysischer Art beruhen. Dies verweist auf die ihr innewohnende Rationalität, die eher die Richtigkeit ihrer Behauptungen als den Inhalt des Gesagten legitimieren soll. „Die Logik ist die Schablone, mit der die Ideologie ihre Behauptungen formt, die ‚Syntax‘, die sie anwendet, um ihre Interpretationen zu formulieren“8. Es handelt sich um eine instrumentalistische Rationalität, die sich eher auf die Struktur als auf den Inhalt von Ideen bezieht.
Darüber hinaus unterscheidet sich der Nationalismus in einem weiteren Punkt von der Religion. Die Lehren der letzteren sind, zumindest was die traditionellen Gesellschaften betrifft, per definitionem stabil und unveränderlich (Wahrheit durch Offenbarung), und jeder Versuch, die Doktrin zu ändern, wird als Kult betrachtet. Im Gegenteil, es ist unmöglich, sich eine identische nationalistische Ideologie in einem bestimmten Raum und einer bestimmten Zeit vorzustellen. Der Inhalt des Nationalismus unterliegt den Gegebenheiten einer jeden Gesellschaft in Form verschiedener kultureller und politischer Ideen. Aber auch innerhalb einer Gesellschaft hat der Nationalismus das Potenzial, sich im Laufe der Geschichte mit einem einzigartigen Grad an Effektivität zu verändern, was die Machtinteressen betrifft, und zwar in einer Weise, die mit den durch das historische Wirken der Massen verursachten Transformationen verbunden ist. Vielleicht ist dies ein Anhaltspunkt, der seine große Widerstandsfähigkeit erklärt.
Abgesehen von den individuellen historischen Unterschieden behält die nationalistische Ideologie als Erscheinungsform des Phänomens jedoch in all ihren Varianten einige Grundvoraussetzungen bei:
(A) Es gibt eine Nation mit offensichtlichen und passenden Merkmalen.
(B) Die Nation muss ihre politische Souveränität haben oder behaupten.
(C) Die Interessen und Werte der Nation haben Vorrang vor allen anderen Interessen und Werten9.
ii. Nationalismus und Identität
Die doppelte Funktion der Ideologie ergibt sich aus der vorangegangenen Definition: Sie ist erklärend und ethisch. Die Ideologie enthält Vorstellungen und Doktrinen, die die Welt beschreiben und interpretieren und sie gleichzeitig bewerten. Sie beschreibt das „Sein“ der Welt und das „Wie sie sein sollte“. Jede Bezugnahme auf das „Sein“ wird von einer Bezugnahme darauf begleitet, „wie sie sein sollte“. Diese unauflösliche Koexistenz der beiden Funktionen ergibt das Element der Praxis. Die Widersprüchlichkeit oder sogar die Übereinstimmung zwischen den beiden Bildern erzwingt spezifische Verhaltensweisen und politisches Handeln, um entweder die Kluft zu überbrücken oder das Gleichgewicht zwischen beiden aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten: Da die Ideologie beschreibt, wie die Welt „sein sollte“, schreibt sie auch vor, was „wir tun sollten“, um dieses Ziel zu erreichen, von der Interpretation über die Aufforderung bis hin zum angemessenen Verhalten. Auf diese Weise beabsichtigt der Nationalismus die Bildung kollektiver und individueller Identitäten, die seine Einheiten definieren und verbinden.
Bevor wir fortfahren, könnten wir das künstliche Dilemma der Nebeneinanderstellung einer kollektiven Identität und einer Vielzahl von individuellen Identitäten beseitigen. Jede Identität ist individuell, aber jede ist historisch gewachsen und wurde in einem Feld von sozialen Werten, Verhaltensregeln und kollektiven Symbolen konstruiert. Die Identitäten der Menschen stimmen nie mit denen der anderen überein, sondern werden immer aus der Ferne gewonnen10. Außerdem wird die nationalistische Botschaft nicht von jedem Menschen einheitlich aufgenommen. Sie ist offen für eine Reihe von Möglichkeiten, von der totalen Übernahme bis zur teilweisen Akzeptanz, und unterliegt der Modifikation oder sogar der Osmose mit anderen Ideologien.
Die Frage ist also, warum akzeptieren die Menschen nationalistische Ideologien? Oder besser gesagt, was bedeutet die Konstituierung einer Identität, genauer gesagt einer nationalen Identität, für ein Subjekt? Identität scheint für eine Person notwendig zu sein, um in die symbolische soziale Ordnung einzutreten und eine Position innerhalb dieser Ordnung einzunehmen. Von diesem Standpunkt aus bildet eine Person ein elementares, kohärentes Selbstverständnis, wird zum Subjekt und nimmt die Welt als eine Welt der Bedeutung wahr. Jede Identität wird durch ein zentrales Konzept konstruiert, das andere Identitäten ordnet und ihnen Bedeutung verleiht. Durch die ideologische Form der Nation „integriert das Subjekt diese Einverleibung in einen elementareren Prozess (den wir als ‚primär‘ bezeichnen können) der Fixierung der Wirkungen von Liebe und Hass und der Repräsentation des Selbst“11. Die nationale Ideologie enthält idealistische Signifikanten (den Namen der Nation, den des Vaterlandes), durch die das Gefühl des Heiligen, der Liebe, der Achtung, des Opfers oder der Angst vermittelt werden kann. Dies ist der Punkt, an dem der Nationalismus beginnt, der Religion zu ähneln. Er ist eine säkularisierte Form der Bedeutung von Macht, Zeit, Gesellschaft und Tod. Oder, wie Benedict Anderson sagen würde, es ist eine Art, den Zufall in Schicksal zu verwandeln.
Zusammenfassend würden wir sagen, dass Ideologien vor allem deshalb akzeptiert werden, weil sie dazu neigen, subjektive Identitäten zu bilden, indem sie dem Individuum einen imaginären und symbolischen Kontext bieten, durch den es versucht, seinen gespaltenen Charakter und die Präsenz der Zufälligkeit und der beunruhigend seltsamen Darstellung von Differenz und Heterogenität in den sozialen Beziehungen zu verbergen, ohne dies jemals vollständig zu erreichen12. Dieses schwer fassbare Gefühl der Vollständigkeit ist jedoch immer mit Herrschaftsverhältnissen im ökonomischen, politischen und privaten Kontext verbunden.
Die durch die nationalistische Ideologie konstituierte Identität weist jedoch in all ihren Formen einige wichtige gemeinsame Merkmale auf. Es handelt sich um eine übergeordnete Identität, die alle anderen sozialen und individuellen Identifikationen orchestriert, integriert, organisiert, neu formuliert und hierarchisiert oder sogar aufhebt. Das bedeutet zum Beispiel, dass man, bevor man rechts oder kommunistisch, Arbeiterinnen und Arbeiter oder Chefs, Mann oder Frau, Vater oder Sohn, gesund oder „psychisch krank“ ist, Grieche, Türke, Amerikaner oder Israeli usw. ist.
Indem er sich als übergeordnetes soziales Band definiert, kommt der Nationalismus der Beendigung aller Diskussionen über die soziale Konstruktion sehr nahe, indem er ihre Gegensätze und Widersprüche bedeutungslos macht13. Der Nationalismus formt ein Bild der Totalität, innerhalb dessen er eingeschränkt ist, wenn er nicht bewusst darauf abzielt, das Nicht-Identische auszulöschen, so dass die symbolische Differenz zwischen „uns“ und „den Fremden“ hervorgehoben und als primär und nicht reduzierend erlebt wird. Erinnert man sich an die von Fichte in der Rede an die deutsche Nation vorgeschlagene Terminologie, so muss das Individuum ständig äußere Grenzen als Projektion und Verteidigung einer inneren kollektiven Persönlichkeit phantasieren14. Gemäß dem von Slavoj Žižek vorgeschlagenen rhetorischen Schema der Umkehrung: „Ideologie ist keine traumhafte Illusion, die wir aufbauen, um der unerträglichen Realität zu entkommen; in ihrer grundlegenden Dimension ist sie eine Fantasiekonstruktion, die als Stütze für unsere ‚Realität‘ selbst dient. Die Funktion der Ideologie besteht nicht darin, uns einen Fluchtpunkt vor unserer Realität zu bieten, sondern die soziale Realität selbst als eine Flucht vor einem traumatischen, realen Kern anzubieten: Der soziale Antagonismus als innerer Bestandteil jeder Gesellschaft“15. Mit anderen Worten: Der Nationalismus ist ein Versuch der Universalisierung, der die Spuren seiner Unmöglichkeit nicht verbergen kann.
Wenn wir den Begriff „sozialer Antagonismus“ verwenden, wollen wir ihn nicht auf den auf verschiedene Weise implizierten Klassenkampf beschränken. Die Machtverhältnisse liegen in der politischen Sphäre, in den Klassenwidersprüchen, in der Ausbeutung der Natur, im Rassismus, im Sexismus und in allen Aspekten des Alltagslebens, in denen autoritäre Praktiken reproduziert werden. Wir wollen jedoch keinem dieser Elemente eine zentrale Bedeutung zuschreiben.
An diesem Punkt könnten wir das Konzept der „Nation“, ausgehend vom Nationalismus, neu überdenken. Die „Nation“ selbst ist ein leerer Signifikant, sie hat keine begriffliche Bedeutung außerhalb der Praktiken, die die Subjekte moderner Gesellschaften zur Definition und Institutionalisierung ihres Staates anwenden. Dass die „Nation“ selbst bedeutungslos ist, zeigt sich auch darin, dass „sie zwar als das erscheint, was unserem Leben Fülle und Lebendigkeit verleiht, wir sie aber nur bestimmen können, indem wir auf verschiedene Versionen derselben leeren Tautologie zurückgreifen. Alles, was wir letztlich darüber sagen können, ist, dass die Sache „sich selbst“, „die wirkliche Sache“, „das, worum es wirklich geht“, usw. ist. Wenn wir gefragt werden, wie wir die Präsenz dieses Dings erkennen können, ist die einzige konsistente Antwort, dass das Ding in dieser schwer fassbaren Entität namens ‚unsere Lebensweise‘ präsent ist“16. Der Nationalismus ist um diese Abwesenheit von Bedeutung herum strukturiert, die sich gleichzeitig selbst Bedeutung verleiht. Das Baumaterial sind die kulturellen (Sprache, Religion, Tradition) und politischen (Wille, Gesetze, Verfassung) Merkmale. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in jeder nationalen Identität politische und kulturelle Elemente nebeneinander bestehen, wobei erstere in der Regel überwiegen.
Wir möchten uns auf zwei dieser Elemente konzentrieren: Sprache und Rasse. Erstens ist die Schaffung einer Sprachgemeinschaft erforderlich. Dabei geht es nicht um die Einheit oder Reinheit der Landessprache, sondern um ihre Fähigkeit, als Sprache des öffentlichen und privaten Lebens, der täglichen Beziehungen und der offiziellen Institutionen zu funktionieren. Die „sprachliche“ Gemeinschaft allein reicht jedoch nicht aus. Es muss auch eine „rassische“ Gemeinschaft geschaffen werden (im weitesten Sinne ein auf die nationale Bevölkerung ausgedehnter Begriff der Verwandtschaft). Diese rassische Gemeinschaft wird auf der Grundlage der Ideologie der Mischehen gefestigt. Der Mechanismus, der dabei eine entscheidende Rolle spielt (ebenso wie die Schule zur Bildung der Sprachgemeinschaft beiträgt), ist die moderne Familie (aufgrund der Auflösung traditioneller Formen wie „Generation“ oder „Sippe“). Die moderne Familie „erzeugt“ das Privatleben und stellt gleichzeitig die Grundzelle des Staates dar, die durch ihre Einbindung in die Mechanismen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens geschützt und kontrolliert wird17.
Diese Behauptung zeigt einen weiteren Aspekt der Prägnanz der nationalen Identität. Die Person wird während ihres gesamten Lebens durch eine Vielzahl von Alltagspraktiken (von den Finanzämtern, bei denen man bedient wird, bis zu den Gerichten, an die man sich wendet) als homo nationalis inszeniert, und nicht nur durch Doktrinen. Im Grunde genommen verbindet die Organisation des Alltagslebens die Subjekte mit der nationalen Einheit, der sie angehören, über die katalytischste Wechselbeziehung der Abhängigkeit.
iii die Konstruktion der Nation
Die Nation geht dem Nationalismus nicht voraus, weder logisch noch historisch. Auch wenn die Nation vom Nationalismus als allgegenwärtig in Raum und Zeit dargestellt wird, ist sie eine historische Konstruktion, die durch die nationale Ideologie konstituiert und legalisiert wird. Wie Gellner feststellt, „lassen sich Nationen über das Zeitalter des Nationalismus definieren und nicht umgekehrt, wie gemeinhin angenommen wird“.
In dieser historischen Epoche des Übergangs von der traditionellen Gemeinschaft zur modernen Gesellschaft institutionalisieren die Menschen die Nation als eine imaginäre Gemeinschaft. Anderson zufolge ist die Nation einerseits eine imaginäre Gemeinschaft, weil sie als tief verwurzelte horizontale Gemeinschaft wahrgenommen wird, und andererseits, weil die Mitglieder selbst der kleinsten Nation niemals alle anderen Mitglieder der nationalen Gemeinschaft als Familie kennen werden, auch wenn sie sich vorstellen und glauben, ihr anzugehören und an ihr teilzuhaben. Die Nation existiert als eine „mentale“ Einheit von Menschen, die auf der Ebene des Objekts einer imaginären Wahrnehmung „existiert“.
Das besondere Zugehörigkeitsgefühl, das die Nation kennzeichnet, entsteht durch die Verschränkung einer vertikalen und horizontalen Identifikation. Die Individuen einer Gemeinschaft werden vertikal durch die Nation und ihre Symbole identifiziert, und gerade deshalb werden sie auch inter-subjektiv identifiziert, indem sie sich gegenseitig auf der Grundlage des horizontalen gemeinsamen konzeptionellen Nenners der „Nation“18 erkennen. Auf diese Weise entsteht, wie Benedict Anderson hervorgehoben hat, die von den nationalen Subjekten phantasierte horizontale Gemeinschaft. In diesem Zusammenhang ist der Unterschied zwischen Solidarität und Feindseligkeit hervorzuheben, der in traditionellen Gesellschaften besteht. Dort ist der zentrale Bezugspunkt nicht das abstrakte Konzept der Nation, sondern der Clan, das Dorf, die Feudal-, Zunft- oder Religionsgemeinschaft, also konkrete und greifbare Einheiten, die durch das unmittelbare menschliche Erfahrungsfeld definiert sind. Außerdem ist die Abwehr äußerer Bedrohungen fast immer das Ergebnis einer Reaktion auf äußere Gefahren, die nachlässt, sobald die Bedrohungen vorüber sind19. Mit dem bisher Gesagten wollen wir uns nicht gegen imaginäre Gemeinschaften wenden und traditionelle Gemeinschaften als das einzig Wahre vorschlagen. Im Gegenteil: Unter den historischen Bedingungen der Moderne ist jede Gemeinschaft, die durch Institutionen reproduziert wird, imaginär. Diese Behauptung ist gleichbedeutend mit der eingangs aufgestellten Vermutung, dass in der modernen Geschichte nur imaginäre Gemeinschaften tatsächlich real sind. Wichtig ist, dass die anthropologischen Beschreibungen traditioneller Gemeinschaften, auch wenn sie nicht der historischen Realität entsprechen, für die menschliche Vorstellungskraft als nostalgische Erinnerung an eine einst geteilte Vertrautheit fungieren. Diese Nostalgie interpretiert die Abwesenheit jedoch als Verlust. Sie provoziert Trauer um etwas, das wir glauben, verloren zu haben, obwohl es in Wirklichkeit nie uns gehörte. Der Nationalismus macht sich dieses subjektive psychologische Bedürfnis zunutze und bietet die Möglichkeit, diese mythische „verlorene Intimität“, die durch die Tradition hervorgerufen wird, zu rekonstruieren.
Was bisher gesagt wurde, zeigt das konstruktivistische Konzept der Nation. Mit anderen Worten: Nationen werden historisch konstituiert und aufgelöst und sind keine unveränderlichen Naturbegriffe. Dies allein reicht nicht aus, um eine Sichtweise der Geschichte als offenes Verfahren und nicht als Determinismus zu rechtfertigen. Die Auffassung, dass Nationen historische Konstruktionen sind, wird auch von einer essentialistischen Konzeption der Nation übernommen, die die Tatsache hervorhebt, dass, selbst wenn Nationen einmal konstruiert wurden, die nationale Identität dennoch historisch einheitlich und durch die Zeit unveränderlich ist. In diesem Denkmodell existiert die Nation heute, weil sie schon immer im Keim vorhanden war, und dieser prä-ewige nationale Kern durchläuft Jahrtausende ethnogenetischer Entwicklung und mehrere Evolutionsstufen, um zur heutigen Form des Nation-Staates zu reifen. Dementsprechend gibt es auch eine funktionalistische Auffassung von Nation, bei der die Nation ausschließlich durch staatliche Strukturen hervorgebracht wird und als Instrument zur effektiven Ausübung staatlicher Macht fungiert, unabhängig von Nationalismus und dem sozialen Prozess ihrer Entstehung. Diese absolute Reduzierung der Nation auf den Staat beinhaltet auch eine statische und mechanische Wahrnehmung der Geschichte. Wir sind im Gegenteil der Meinung, dass die historische Konstitution der nationalen Identität weder gegeben noch unveränderlich ist, sondern sich je nach der Grundlage der dynamischen sozialen Beziehungen periodisch verändert und nicht auf eine inner-historische Einheitsform reduziert wird20.
iv. Die Geburt und Reproduktion der Nation
Damit die Ideologie des Nationalismus und die globale Realität der Nation entstehen können, ist eine ganze Reihe kultureller, philosophischer, politischer, ökonomischer, institutioneller und technischer Bedingungen erforderlich. Wir werden nicht behaupten, dass es eine deterministische, lineare Entwicklung gibt, die von bereits existierenden Institutionen zum Nationalstaat führt, sondern vielmehr eine Abfolge von konjunkturellen Beziehungen, die viele ungleichmäßig überalterte Institutionen und Mechanismen in neue politische Strukturen integrieren werden. So führte beispielsweise die schrittweise Herausbildung der absoluten Monarchien des 17. und 18. Jahrhunderts zu einem vollständigen Geldmonopol, zur Zentralisierung der Steuern und der Verwaltung, zur Vereinheitlichung des Rechtswesens, zur immer weiter fortschreitenden Bürokratisierung des Steuersystems und zur entsprechenden inneren Befriedung durch eine einheitliche Polizeiarbeit und die Konzentration der Streitkräfte. Die bisherige Vorstellung von territorialer Integrität wird damit ganz entscheidend über den Haufen geworfen. Reformation und Gegenreformation beschleunigten den Übergang von der Konkurrenz zwischen Staat und Kirche (d.h. zwischen theokratischem und weltlichem Staat) zu deren Komplementarität. Die Wiedereinführung des römischen Rechts (anstelle des Gewohnheitsrechts), der Merkantilismus und die Konsolidierung des Feudalwesens21 hatten größtenteils eine völlig andere Tragweite, aber sie brachten nach und nach die Elemente des Nationalstaats hervor, oder besser gesagt, sie wurden unfreiwillig verstaatlicht und begannen, die Gesellschaft zu verstaatlichen. Alle diese Prozesse spielten, sofern sie sich wiederholten und in neue politische Strukturen integriert wurden, eine wesentliche Rolle bei der Entstehung nationaler Formationen22. Mit dem Aufkommen des Nation-Staats wurden viele dieser Prozesse abgeschlossen. Die Schaffung eines nationalen Heeres, die Vereinheitlichung und Rationalisierung des positiven Rechts, die Schulpflicht und die disziplinarische Steuerung der Bevölkerung unterschieden den Nationalstaat drastisch von allen vorherigen Staatstypen.
Der entscheidende Punkt ist das bemerkenswerte Maß an Legitimität, das die Nationalstaaten in den Augen ihrer Bevölkerung erlangt haben. Infolge des Gewaltmonopols, das sich der moderne Staat gesichert hat, erreichte er eine ethnische Homogenisierung und Disziplinierung seiner Staatsbürger. Seine erfolgreiche Reproduktion liegt jedoch in seiner Fähigkeit, auf die Bedürfnisse seiner Staatsbürger in einer noch nie dagewesenen Weise einzugehen. Dieser Schritt in der evolutionären Kette wird am besten durch die Institution des Wohlfahrtsstaates repräsentiert, ein Produkt der Institutionalisierung sozialer Kämpfe, die Ende des 19. Jahrhunderts begannen und im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer Hauptregelung geworden ist. Sie ermöglicht es, den Status des „Staatsbürgers“ durch den des „Mitglieds einer ethnischen Gemeinschaft“ zu ersetzen – ein Staat, der sich in die Reproduktion der Ökonomie einmischt, insbesondere in die Individuen, die Familienstrukturen und die öffentlichen Gesundheitssysteme, ein Staat, der generell im gesamten Bereich des Privatlebens präsent ist. Infolgedessen wurde die Existenz aller Individuen, unabhängig von ihrer sozialen Schicht, vollständig dem Status des Nationalstaatsbürgers23 unterworfen.
Was Foucault aus einer ganz anderen Perspektive zeigt, ist der Übergang vom „Territorialstaat“ zum „Bevölkerungsstaat“ und der damit verbundene Bedeutungszuwachs des biologischen Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung als Voraussetzung der souveränen Macht24. Er eröffnet die Möglichkeit einer Biomacht, die in zwei Richtungen geht: Einerseits zielt sie auf die Körpermaschine und die Steigerung ihrer Kapazitäten, die Extraktion ihrer Kräfte, ihre Einbindung in ein effektives und ökonomisch strukturiertes Kontrollsystem; die anatomisch-politische Politik des menschlichen Körpers. Auf der anderen Seite werden die biologischen Prozesse von der Autorität in den Mittelpunkt gestellt: Geburten, Sterben und Überleben fallen in eine ganze Reihe von Regelungen und Anpassungen, eine Biopolitik der Bevölkerung. All dies schafft eine Autorität, deren oberste Funktion von nun an nicht mehr nur darin besteht, das Leben zu zerstören, sondern es durchgängig zu umgeben25. Es ist das biologische Leben, das schrittweise in den Mittelpunkt der politischen Szene rückt. Der Staatsbürger des Nationalstaats erkennt eine Art von Leben an, um das sich der „eigene“ Staat kümmert, der das Fremde, das Andere und das Gesundheitsrisiko für den nationalen Körper aus seinen Strukturen ausschließt.
Aus klassischer politischer Sicht wird dieser Ausschluss eher politisch als biologisch mit dem Begriff „das Volk“ beschrieben. Üblicherweise wird der Begriff in einer Bedeutung verwendet, die „zwischen zwei gegensätzlichen Polen oszilliert: Auf der einen Seite das ganze ‚Volk‘ als integraler politischer Körper, auf der anderen Seite die Teilmenge ‚Volk‘ (popolo) als fragmentarische Vielzahl von benachteiligten und ausgeschlossenen Körpern“26. Hier, interessieren wir uns für die erstgenannte Gruppe, eine Gemeinschaft, die ihre politischen Kämpfe in den Horizont ihres eigenen Staates einschreibt27. Als solches ist das Volk mit dem Gesellschaftsvertrag und der Volkssouveränität verbunden. Das „Volk“ als Konzept taucht mit der Französischen Revolution auf und „existiert“ nur durch seine Repräsentation. Es muss nicht als soziologische, sondern als „politische Idealisierung“ verstanden werden. Das Volk“ existiert in erster Linie durch den Akt, der es als Souverän etabliert, d.h. durch den Vertrag, der es konstituiert. Diese Agentur ist die politische Funktion der Repräsentation/Befugnis/Beauftragung. Die Repräsentation wird zur neuen politischen Religion der Moderne, zum offiziellen Ritual der Produktion des „einen und unteilbaren“ Volkes, seiner Überschneidung mit der Nation28.
Andererseits spielen Faktoren wie der Buchdruck, die Zeitungen und Zeitschriften (Druckkapitalismus, wie Benedict Anderson erwähnt) sowie die Standardisierung der gedruckten Landessprachen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung der nationalen Idee. Die Degradierung der heiligen Sprache Latein29, die Verbreitung bestimmter Umgangssprachen als Instrumente des Verwaltungsapparats, neue Drucktechnologien, aber auch die Verbreitung der Druckerpresse unter den Bedingungen des aufkommenden Kapitalismus haben die Welt verändert und die Art und Weise, wie Informationen, Gefühle und Ideen zwischen den Menschen ausgetauscht werden, ein für alle Mal verändert. Zu den Quellen des Nationalismus gehört nicht nur die Sprache, sondern auch die gedruckte Sprache, die die Sprache der heiligen Texte entthront und sich den lokalen Dialekten aufdrängt, indem sie als offizielle Sprache des Staates anerkannt wird.
Das mentale Konzept der Nation wäre ohne die entsprechenden Brüche in der Organisation und Wahrnehmung von Zeit und Raum nicht denkbar. „Im post-traditionellen Universum des Diskurses ist die Zeit im Gegensatz zum Raum institutionalisiert. Der Bruch, die Entfremdung der Zeit vom Raum trennte ihre subjektive Auffassung vom bis dahin lokalen und konkreten Charakter und führte zu einer universellen, messbaren, aber auch abstrakten Auffassung der Zeitlichkeit“30. An die Stelle der von Walter Benjamin beschriebenen messianischen Zeit, der gleichzeitigen Präsenz von Vergangenheit und Zukunft in einer augenblicklichen Gegenwart, tritt nun die „homogene, leere Zeit“, ein weiterer von Benjamin entlehnter Begriff. „Der Fluss der Zeit wird nicht mehr als unendlich wiederkehrend aufgefasst, sondern nimmt in Abhängigkeit von der Entwicklung der säkularen Wissenschaft die Form einer evolutionären Reihe an, d. h. eines ununterbrochenen Flusses von Entwicklungen, die von einem Zeitpunkt zum nächsten führen, einer endlosen Abfolge von Ursachen und Wirkungen, die durch Uhr und Kalender gemessen werden“.31 Die chronologische Abfolge wird logisch. Das Zeitbewusstsein kommt in allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens zum Ausdruck, von der ökonomischen Produktion über die politische Aktion bis hin zum kulturellen Ausdruck. Der abstrakte Zeitbegriff ist, ohne einseitig auf ihn reduziert zu sein, mit der Verallgemeinerung der Ökonomie der Waren und der Dominanz des allgemeinen Äquivalents, des Geldes, verbunden. Die messbare Zeit wird zum verallgemeinerten Kriterium des Tauschwerts, zur geteilten, zu vergleichenden und dann homogenisierten Zeit, die getauscht werden kann.
Der Nationalismus kommt nicht, um über Diskontinuitäten, Brüche und Unvereinbarkeiten zu sprechen. Er kommt, um die leere, homogene Zeit der Nation zu gebären. Die Nation wird nicht als eine von vielen Formen sozialer Solidarität dargestellt, die im Laufe der Geschichte auftauchen, sondern als ein soziales Band, das immer in der Zeit präsent ist. Ein Gemeinschaftsideal mit festen Wurzeln in der Vergangenheit, das durch seine historische Kontinuität die Grundlage für die künftige Regelung der menschlichen Angelegenheiten bildet. Es kommt aus der Vergangenheit als natürliche Kulturgemeinschaft, um in der Gegenwart als politische Einheit verwirklicht und in der Zukunft als ideale Nation (wie sie jeder Nationalismus versteht) vollendet zu werden.
Was die Wahrnehmung des Raums betrifft, so steht im Mittelpunkt des Wandels die Vorstellung vom geopolitischen Territorium. Politische Autorität war schon immer mit dem Territorium verbunden. Was sich ändert, ist die Art dieser Verbindung. Im feudalen Europa wurden die Lehen durch ihr Zentrum definiert, die Grenzen waren durchlässig und vage, und die Autoritäten wurden unsichtbar geschwächt, da sie sich gegenseitig durchdrangen32. In der Moderne erhalten die Grenzen einen exklusiven, nicht verhandelbaren, nicht fluktuierenden, unveränderlichen Charakter, der nur durch Krieg verändert werden kann. Diese Abgrenzung ist eine Bewegung mit einer doppelten Funktion. Sie trennt und trennt gleichzeitig die Menschen, um sie unter dem politischen Dach der Nation zu vereinen, aber sie fragmentiert auch die Gemeinschaften, um sie zu vernetzen, sie umschließt das Territorium, um die verschiedenen Kulturen zu homogenisieren, und sie individualisiert, um die Vielfalt und die Unterschiede zu zerstören33. Die Nationalisierung des Territoriums und die Territorialisierung der Nation sind gleichzeitige Prozesse. „Grenzen und nationales Territorium existieren nicht vor der Vereinheitlichung dessen, was sie strukturieren: Es gibt kein ursprüngliches Inneres, das später vereinheitlicht werden muss. […] Der Staat markiert die Grenzen dieses seriellen Raums im Prozess der Vereinheitlichung und Homogenisierung dessen, was diese Grenzen umschließen.34“ Der Körper des Königs, der die totalitäre Autorität symbolisiert, wird durch das nationale Territorium ersetzt, in dem die Autorität einheitlich reproduziert wird und in jedem Zentimeter des Landes ungeteilt ist. Nationale politische Hegemonie existiert nicht ohne Bezug auf ein ideales oder existierendes Territorium, was sie von Natur aus in eine ständige Konfrontation mit anderen Nation-Staaten bringt, sei es offensichtlich oder verdeckt. Die Rivalität zwischen ihnen ist trotz der rhetorischen Schemata des friedlichen Nationalismus eine Selbstverständlichkeit.
An dieser Stelle muss etwas hervorgehoben werden, dem normalerweise nicht die gebührende Aufmerksamkeit zuteil wird. Der Schauplatz, auf dem sich der Nation-Staat präsentiert und schließlich universelle Anerkennung findet, ist das Schlachtfeld, auf dem er seine Effizienz im Vergleich zu anderen Formen staatlicher Organisationen, wie z.B. den traditionellen Imperien, beim Gewinnen von Kriegen unter Beweis stellt. Im Laufe der Zeit verschafften das zunehmende Ausmaß von Kriegen und insbesondere die zunehmende Abhängigkeit von technologischen Fortschritten, Industrialisierung und Spezialisierung in Verbindung mit der sich entwickelnden kommerziellen, rechtlichen und diplomatischen Interaktion zwischen Staaten dem modernen, zentralisierten Nation-Staat einen klaren Vorteil gegenüber anderen Staatsformen35. Die Fähigkeit, Krieg zu führen, hing von der Effizienz und der Fähigkeit eines Staates ab, Ressourcen, Männer, Waffen, Nahrungsmittel und Steuern zur Unterstützung seiner Kriegsanstrengungen zu beschaffen. Die Entwicklung einiger der wichtigsten Mechanismen des modernen Staates erschien als ein Einschnitt zwischen dem Krieg und den Bemühungen, ihn zu finanzieren. Einerseits führte dies zur Monopolisierung der Zwangsmittel und zur systematischen Organisation der Disziplinarmaßnahmen durch den Staat. Andererseits wurde den Menschen, je mehr sie sich in Krieg und Kampf engagierten, ihre Stellung als Mitglieder einer politischen Gemeinschaft bewusst. Die allgemeine Wehrpflicht beginnt, der hohen Nachfrage nach der Teilnahme an politischen Prozessen zu entsprechen. Dadurch wurde eine Reihe von repräsentativen Institutionen gefördert, die für den modernen Staat charakteristisch sind. In diesem Zusammenhang spielt die Nation eine doppelte Rolle: Sie wird von den Regierungen zur Legitimierung der staatlichen Aktionen eingesetzt, aber auch im Kampf um die Teilnahme an politischen Verfahren. In beiden Fällen sorgt die oberflächliche nationale Identität für die Koordination von Politik, Wehrpflicht und Legalität.
Der Krieg steht am Anfang des Nation-Staats, aber die nationale Identität ist das erfolgreichste Mittel zur Legitimierung jedes Kriegseinsatzes. Diese bewährte Beziehung hat ihre Bedeutung während des gesamten 20. Jahrhunderts und auch heute noch beibehalten, da Söldnerarmeen einen Großteil der Drecksarbeit der nationalen Armeen zu übernehmen scheinen. Letztlich wird das Vaterland durch das Vaterland gerettet, dank der einzigartig effizienten Fähigkeit der Nationen, gegnerische Seiten zu schaffen, die über die notwendigen Mittel verfügen, um jederzeit gegeneinander Krieg zu führen. Die nationale Gemeinschaft ist reif genug, um durch das Tragen von Waffen die Einheit zum Ausdruck zu bringen, die sie in Zeiten des Friedens als grundlegenden Bestandteil der sozialen und ökonomischen Prozesse erlebt. Der nationale Konflikt ist nicht nur ein zynischer Slogan, der die Massen täuscht, sondern vielmehr die Folge einer bereits stabilisierten, strukturierten und nationalisierten Organisation der finanziellen Interessen und der Mechanismen der bewaffneten Gewalt. Die Realität einer in Nationen geteilten Welt und das Vorhandensein von Minderheiten in benachbarten Staaten führt jedoch zu Konflikten, die sich nicht durch eine reibungslose Kapitalakkumulation kontrollieren lassen, und damit zu einem hohen Maß an Autonomie gegenüber direkten finanziellen Interessen. Mit anderen Worten: Die Nationen bestimmen aufgrund ihrer eigenen Logik der Anziehung und Abstoßung einen Kontext internationaler politischer Antagonismen, der nicht auf seine finanzielle Dimension reduziert werden kann36.
Diese beiden Konzepte, die Nation und der Kapitalismus, weisen von Anfang an eine intensive Verbindung auf, die nie zur Identifikation wird. Bereits im 16. Jahrhundert war die Herausbildung der kapitalistischen Ökonomie auf einer zunehmend internationalen Ebene zunächst in Form von expandierenden Marktbeziehungen und später die Herausbildung des Industriekapitalismus ein primärer und entscheidender Faktor für das Ausmaß und die Grenzen der staatlichen Macht. Die zwingende Forderung der aufstrebenden Bourgeoisie war die Schaffung einer staatlichen Struktur, die durch ihre stabilisierende Fähigkeit einen koordinierenden Rahmen für die neue kapitalistische Ökonomie gewährleisten sollte, indem sie das Recht durchsetzte, Verträge und Transaktionen sicherte und konkurrierende Ansprüche auf Eigentumsrechte förderte. Die Form, die die Nation annimmt, ist jedoch nicht direkt mit den kapitalistischen Produktionsverhältnissen gleichzusetzen. „In der Geschichte des Kapitalismus sind andere Staatsformen als der Nationalstaat entstanden und haben eine Zeit lang mit ihm konkurriert, bevor sie schließlich unterdrückt oder instrumentalisiert wurden“37.
Zum Beispiel das Kaiserreich, die Stadt, die Hanse. Mit anderen Worten: Die Form des Nation-Staats ist kein bourgeoiser Plan, sondern das Ergebnis einer Reihe von politischen Bündnissen und Klassenkämpfen, die sich in verschiedenen geopolitischen Formationen von Klassen- und Staatsmacht herauskristallisierten. Kräfte, die darauf abzielten, die politische Macht und die finanziellen Arrangements zu konzentrieren, indem sie jegliche Autorität, die der Aristokratie und dem Klerus noch verblieben war, zerbrachen und entwurzelten, sowie finanzielle Interessen, die versuchten, Hindernisse für die Ausdehnung der Marktbeziehungen zu beseitigen, wurden durch starke soziale Netzwerke, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt, projiziert, die sich verbündeten, aber auch untereinander in Konflikt gerieten, wann immer die Ökonomie innerhalb der nationalen Grenzen begrenzt war und von der willkürlichen Intervention des Staates bedroht wurde. Letztendlich könnte man sagen, dass der Nation-Staat mit seiner zentralisierten Struktur, seiner Klassenzusammensetzung und seinem abgegrenzten Territorium der historische Gleichgewichtspunkt für die doppelte Konkurrenz der bourgeoisen Klassen war. Zwischen einem äußeren Kampf, bei dem sich individuelle Agenten des Kapitals antagonistisch gegenüberstehen und versuchen, ihren „eigenen“ Staatsmechanismus zu stützen, während sie gleichzeitig alle nationalen Grenzen überschreiten, und einem inneren Kampf, der viel grundlegender und essentieller für jede Art von gesellschaftlicher Struktur ist, nämlich dem zwischen den Klassen. Im Spannungsfeld zwischen lokalem, kommunalem Widerstand und Internationalismus der Arbeiterklasse war der Nation-Staat historisch gesehen die erfolgreichste Antwort auf die Entwicklung eines Binnenmarktes und die Ausbeutung der Arbeit. Aufgrund der ungleichmäßigen historischen Entwicklung des Kapitalismus in Zeit und Raum entwickelten sich die kapitalistischen Verhältnisse in den verschiedenen geografischen Regionen jedoch auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten. So entstand anstelle einer einzigen internationalen Bourgeoisie eine Vielzahl unterschiedlicher Bourgeoisien, die sich auf bestimmte nationalisierte Territorien bezogen. Wie es dazu kam und mit welchen Mitteln in der Folge Allianzen und Konflikte entstanden, ist für jeden Nation-Staat im Einzelnen zu untersuchen.
Was hier geschrieben wird, ist der Versuch, die Prozesse und Veränderungen zu analysieren, die bestimmte Tendenzen und Entwicklungsprozesse aufzeigen, die zum Aufstieg, aber leider noch nicht zum Fall der Nation-Staaten geführt haben. Es wird jedoch immer die „Kontingenz“, die „Ungewissheit“ und die „Unvorhersehbarkeit“ geben, die sowohl die Vorherrschaft der Struktur des Nation-Staats gegenüber anderen Staatsformen als auch das Auftreten und das Überleben bestimmter Staaten zu bestimmten Zeiten bestimmten und anderen nicht. Die Geschichte unterwirft sich aufgrund menschlicher Eingriffe keinen Gesetzen, ist nicht vorherbestimmt und wird auch im Nachhinein nicht in ihrer Gesamtheit verstanden.
Andererseits sollte das zufällige Element, das jeder Ethnogenese innewohnt, nicht als historische Arbitrage betrachtet werden. Es gibt ein sogenanntes „Rohmaterial“ oder einen „proto-ethnischen“ Unterbau, aus dem jeder Nationalismus Elemente aus einer Vielzahl lokaler, verstreuter und widersprüchlicher Traditionen schöpft und so seinen eigenen Mythos, eine neue historische Schöpfung, zusammensetzt. Die Nation lässt sich jedoch nicht auf eine einzigartige und individuelle lokale Tradition, ein religiöses Erbe oder eine sprachliche Besonderheit zurückführen. Obwohl sie sich auf diese stützt und tatsächlich Materialien aus der Vergangenheit verwendet, transformiert, reformuliert und homogenisiert sie diese, vor allem, indem sie ihnen einen höheren Stellenwert einräumt, so dass sie nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Sie schreibt sich ihre eigene Tradition ein.
Wie Agamben bemerkt: „Die Reinheit existiert nie im Anfang“. Der formative, anfängliche Zustand ist die sprachliche und biopolitische Mischung, während die Katharsis und die Produktion von national unterschiedlichen Menschen das Ergebnis eines anstrengenden Prozesses und keineswegs ein natürlicher Prozess ist, der den Vorfahren zugeschrieben wird38. Der Schluss wird also zum Ende/Zweck und damit zum Anfang, sowohl in zeitlicher als auch in logischer Hinsicht39. In dieser vom Nationalismus präsentierten „Abfolge von Ereignissen“ sieht Benjamins Engel „eine einzige Katastrophe, die Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert40“. Wir sehen genau das Gleiche.
1Der Titel dieses Witzes könnte auch lauten: „Lenin in Warschau“ oder „Breschnew in Athen“ oder jeder andere Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion in einer beliebigen europäischen Hauptstadt.
2Aus einem Brief von Lenin an Michael Lowy, Marxists and the National question.
3Benedict Anderson, Imagined Communities.
4Nikos Demertzis, „Nationalism as ideology“ im Sammelband Nation-State-Nationalism. (Not translated into English)
5E.P. Thomson, The poverty of theory and other essays.
6J. Larrain, Der Begriff der Ideologie.
7P. Lekkas, The nationalistic ideology – five work assumptions in the historic sociology. (Not translated into English)
8Ebenda
9Nikos Demertzis, ebenda.
10Etienne Balibar, „Die historische Nation“ in Balibar E. & Wallerstein I., Rasse, Klasse, Nation: ambivalente Identitäten
11Ebenda
12Nikos Demertzis, ebenda.
13Ebenda
14Etienne Balibar, ebenda
15Slavoj Žižek, Das sublime Objekt der Ideologie.
16Slavoj Žižek, „Enjoy Your Nation as Yourself“, in Les Black und John Solomos, (Hrsg.), Theories of Race and Racism: A Reader.
17Etienne Balibar, Forschung über Nationalismus und Rassismus.
18Nikos Demertzis, ebd.
19Pantelis Lekkas, ebd.
20Dimitris Dimoulis – Chrostina Gianouli, Nations – Ranks – Politic – The dialectics of war. (Not translated into English)
21„Die Reaktion der Aristokraten im frühen 18. Jahrhundert zielt auf den Wissens-Macht-Mechanismus ab, der den Verwaltungsmechanismus mit dem staatlichen Autoritarismus verbindet, in dem Bestreben, ihre Rechte zurückzufordern. In diesem Zusammenhang stellen sie dem Rechtswissen einen neuen historischen Diskurs und ein Subjekt gegenüber, das für sich selbst spricht. Die Nation in ihrer unklaren, unbestimmten und zweideutigen Bedeutung wird Konflikte schüren, von denen einige in der Zeit der Französischen Revolution große Bedeutung erlangen werden“. (Michel Foucault, Die Gesellschaft muss verteidigt werden).
22Etienne Balibar, ebd.
23Ebenda.
24Giorgio Agamben, Homo Sacer.
25Michel Foucault, Die Geschichte der Sexualität: Der Wille zur Erkenntnis
26Giorgio Agamben, Homo Sacer.
27Etienne Balibar, o. p.
28Adreas Pantazopoulos, For the People and the Nation – The Moment Andreas Papandreou 1965 – 1989
29„Die heilige Sprache wird als ein Auswuchs der Wirklichkeit und nicht als eine willkürliche Darstellung derselben betrachtet, als ein Teil der Wahrheit und nicht nur als ein Mittel, sie auszudrücken.
Diejenigen, die sie besitzen und deren Zahl gering ist, werden als eine strategische Ebene der kosmologischen Hierarchie betrachtet. Das Schicksal der Vielfalt der menschlichen Sprachen und die territoriale Begrenzung jeder Religion erschüttern das ökumenische Imaginäre des Christentums und tragen zur Degradierung der heiligen Sprachen bei.“ [Anderson, a.a.O.]
30Nikos Demertzis, a. a. O.
31Pantelis Lekkas, The Game of Time (Not translated into English)
32Benedikt Anderson, ebenda.
33Nikos Poulantzas, Staat, Macht, Sozialismus.
34Nikos Poulantzas, ebenda.
35Stewart Hall – Bram Gieben, Formations of Modernity
36Dimitris Dimoulis- Christina Giannoulis, Idib. (Not translated into English)
37Etienne Balibar, Idib.
38Akis Gavrilidis, The Incurable Necrophilia of Radical Patriotism.
39Ebenda
40Walter Benjamin, „IX“, Thesen zur Philosophie der Geschichte.
]]>
Zwei Staaten für zwei Völker – Zwei Staaten zu viel
Das folgende Flugblatt wurde bei einer Demonstration in Tel Aviv am 15. Mai 2004 verteilt. Die kurzlebige Anarchistisch-Kommunistische Initiative wurde von einer kleinen Gruppe israelischer Anarchistinnen und Anarchisten aus drei verschiedenen Städten gegründet, von denen einige wegen ihrer Weigerung, in der Armee zu dienen, inhaftiert waren. Entnommen aus dem Buch Anarchists Against the Wall Direct Action and Solidarity with the Palestinian Popular Struggle (die Übersetzung ist von uns)
Wenn der Staat Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde ein „Friedens“-Abkommen schließen, wird dies nicht aus dem israelischen Wunsch nach „Sicherheit“ für seine Staatsbürger und dem palästinensischen Wunsch nach „Unabhängigkeit“ resultieren. Es wird vor allem Teil der Interessenskonstellation der internationalen Mächte sein, denn solche Konzepte sind ihrer Denkweise fremd. Die Genfer Abkommen, die von Politikern und Geschäftsleuten initiiert wurden, werden, wenn sie wie beabsichtigt unterzeichnet und angewendet werden (was zwei verschiedene Dinge sind), Ausdruck dieser Interessen sein, wie auch jedes andere politische Abkommen, das man sich vorstellen kann. Das Etikett, das am besten geeignet ist, die Behandlung der Einwohner und Staatsbürger, die nicht in die Kategorie der „vollberechtigten Juden“ fallen, durch den israelischen Staat zu beschreiben, ist Apartheid: eine chauvinistische Trennungsregel, die den Bauern Land entzieht, die Bewegungsfreiheit der Menschen auf dem Weg zur Arbeit einschränkt und sogar die Fähigkeit der palästinensischen Kapitalisten behindert, ihre Ökonomie zu entwickeln. Und das alles, während man versucht, die palästinensische Führung zur Mitarbeit zu bewegen.
Einige Leute, die sich als Friedensaktivisten verstehen, haben sich jenseits der offiziellen Antworten der Linken ernsthaft gefragt, was die Gründe für die gemeinsame Politik aller israelischen Regierungen – ob links oder rechts – gegenüber den Palästinensern sein können? Wir behaupten, dass es sich nicht einfach um die Eroberung eines Volkes durch ein anderes nach dem Vorbild alter Imperien handelt; auch nicht nur um den Ausdruck des Glaubens an ein ungeteiltes Land Israel aus der Bibel; auch nicht um den Druck einer starken Lobby von Siedlerführern, obwohl das sicherlich auch eine Rolle spielt.
Die Apartheidsherrschaft muss als etwas betrachtet werden, das mehreren mächtigen Interessen dient. Erstens dient sie der israelischen Ökonomie, d. h. den israelischen Kapitalisten, indem sie billige Arbeitskräfte liefert, die vor allem von kleinen und mittleren Arbeitgebern im verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe eingesetzt werden.
Die „israelischen Araber“, die in den Jahren 1948 bis 1966 unter Militärherrschaft standen, haben diese Rolle gespielt, und noch mehr die Bewohner der 1967 besetzten Gebiete. Erst in jüngster Zeit, sozusagen als Folge der Al-Aqsa-Intifada und des massiven „Imports“ von Zeitarbeitsmigranten, wurde der freie Zugang zu diesen Arbeitskräften unterbrochen. Große israelische Unternehmen profitierten von der Besetzung 1967 vor allem deshalb, weil sie ihnen einen großen Verbrauchermarkt ohne Konkurrenten eröffnete. Das militärische Establishment, das in Israel schon immer sehr mächtig war, und sein Spitzenpersonal haben nach ihrem Militärdienst immer sichere Karrieren in der Regierung und der Industrie gemacht und haben ein ureigenes Interesse daran, die Apartheid (und den Konflikt) zu verlängern, um ihre Position und ihre Rechte zu sichern. Es liegt im Interesse der Vereinigten Staaten, die sich auf die Dienste stützen, die ihnen der israelische Staat seit den 50er Jahren in der Region und in der ganzen Welt leistet, dass Israel ständig bedroht bleibt, damit es weiterhin ihre Unterstützung braucht.
Zur Erinnerung: Ernsthafte Gespräche über die Gründung eines palästinensischen Staates begannen erst vor fünfzehn Jahren, gegen Ende der ersten Intifada. Kaum ein heutiger Anführer der großen zionistischen Linken und der radikaleren Linken (der es gelungen zu sein scheint, ihre Geschichte in fast orwellscher Manier umzuschreiben) hat sich jemals ein solches Abkommen vorstellen können. Sogar zu Beginn der Osloer Periode sprachen sie noch von Autonomie. Die Palästinensische Befreiungsorganisation und die antizionistische Linke sprachen von der Errichtung eines säkularen Staates für alle seine Staatsbürger. Die Palästinensische Autonomiebehörde gab es in der Tat nicht, bis Israel dazu beitrug, die Palästinensische Befreiungsorganisation in dieser Rolle zu etablieren. Das Friedensabkommen, das zwei Staaten für zwei Nationen vorsieht, kam erst auf die Tagesordnung, als es nach der ersten Intifada und den Veränderungen in der globalen Ökonomie den Interessen von Teilen des israelischen und US-amerikanischen Kapitals zu entsprechen begann.
Was bedeutet ein solcher Frieden? Wenn wir die Beschreibung der Situation im erweiterten Israel als Apartheid fortsetzen und sie mit der in Südafrika vergleichen, können wir sehen, dass Frieden die Unterwerfung der Intifada unter eine kompradorische palästinensische Führung bedeutet, die Israel dienen wird. Ein solcher Frieden, der oft als „Normalisierung“ bezeichnet wird, steht im Zusammenhang mit den Prozessen, die überall auf der Welt unter dem Etikett der Globalisierung und der Initiativen für eine regionale Handelskooperation stattfinden, die in einer „Freihandelsregion aller Mittelmeerländer“ gipfeln soll. Überall auf der Welt haben derartige Abkommen zur Übernahme der lokalen Ökonomien durch multinationale Konzerne, zur Verletzung grundlegender Menschenrechte, zur Verschlechterung der Stellung und der Lebensbedingungen von Frauen und Kindern, zu sozialer Gewalt und zur Zerstörung der Umwelt geführt.
Wird ein solches Abkommen und der Frieden zumindest ein Ende der Gewalt mit sich bringen? Wir glauben nicht: Die ökonomische Not und die sozialen Unterschiede werden zunehmen, das Flüchtlingsproblem wird ungelöst bleiben, und die internationale ökonomische Unterstützung für die große Zahl von Arbeitslosen im Gazastreifen und in Teilen des Westjordanlandes wird legitimiert werden (wie es teilweise nach dem Oslo-Abkommen und auch in jüngster Zeit geschehen ist). In diesem Fall werden sich die Palästinenser auf „ihren“ Staat verlassen müssen – einen kleinen, abhängigen Ministaat, der dieser Aufgabe wohl kaum gewachsen sein wird.
Staaten handeln im Rahmen eines Interessensystems, und gewöhnliche Menschen wie wir stehen nicht ganz oben auf der Liste ihrer Interessen. Wenn wir irgendeinen Wandel zum Besseren herbeiführen, die Kluft verringern und das gegenseitige Töten stoppen wollen, dürfen wir uns nicht als gehorsame Marionetten von politischen Anführern verhalten, die von Europäern und Amerikanern finanziert werden und nichts weiter tun als den einen oder anderen „demokratischen“ Protest. Wir müssen stattdessen handeln, um die nationalen Trennungen zu beseitigen, und vor allem den militärischen Kräften widerstehen, die das gegenseitige und ständige Töten verursachen.
Wir müssen nicht für ein politisches Programm werben, sei es das der Genfer Abkommen oder eine Alternative. Vielmehr müssen wir die Forderung nach einer völlig anderen Lebensweise und Gleichheit für alle Bewohner der Region auf die Tagesordnung setzen. Selbst wenn wir auf unabhängige (lokale) Weise handeln, müssen wir bedenken, dass, solange es Staaten gibt und das kapitalistische System fortbesteht, jede Verbesserung, die wir zu erreichen vermögen, partiell und permanent bedroht sein wird. Daher müssen wir unseren Kampf als Teil des weltweiten Kampfes gegen den globalen Kapitalismus sehen, einen revolutionären Wandel auf der Grundlage der Abschaffung von Klassenunterdrückung und Ausbeutung fordern und den Aufbau einer neuen Gesellschaft anstreben – einer klassenlosen anarchistisch-kommunistischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der es keinen staatlichen Zwang mehr geben wird, in der organisierte Gewalt abgeschafft wird, in der es keinen Chauvinismus mehr gibt und in der alle anderen Übel des kapitalistischen Zeitalters beseitigt werden.
Anarchistisch-kommunistische Initiative
]]>