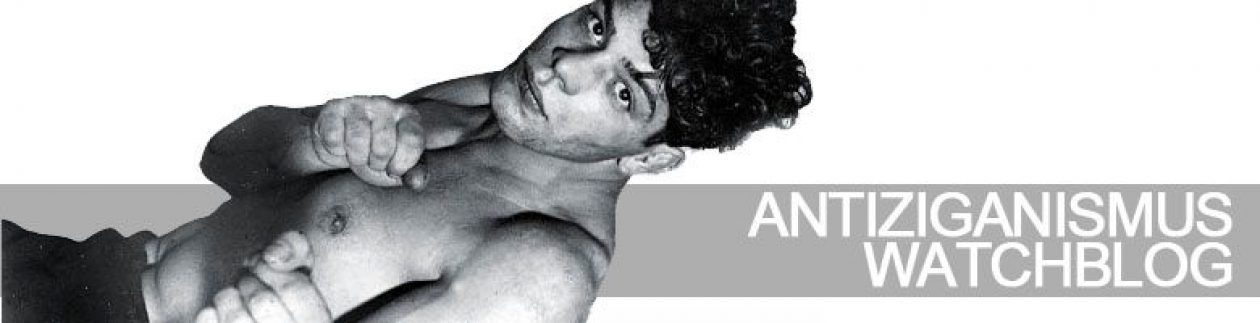Das Internierungslager vor allem für deutsche Sinti entstand im Jahr 1936 im Schatten der Olympiade in Berlin. Die Anweisung zur Einrichtung des Lagers stammt vom 10. Juli 1936. Am 16. Juli wurden dann 600 Wägen an einem Ort in Marzahn zwangskonzentriert.
Die Betroffenen waren, wenn sie zur Ermordung nicht deportiert wurden, jahrelang interniert, teilweise bis zu neun Jahre. Durchschnittlich lebten immer 1.000 Menschen in dem Lager.
Die hygienischen und die Ernährungs- Verhältnisse waren im Lager katastrophal. Von 1936 bis 1945 starben 52 Kinder und Jugendliche an diesen Zuständen.
Ab dem Jahr 1938 wurden Minderjährige vom Lager Marzahn in das 30 Kilometer entfernte KZ Sachsenhausen und später in das „Jugendschutzlager“ Moringen und Uckermark deportiert.
Ab März 1943 wurden die Internierten nach Auschwitz deportiert. Unter den Deportierten befanden sich auch die Komparsen für den Film „Tiefland“ von Leni Riefenstahl, die von der Regisseurin direkt aus dem Lager rekrutiert hatte.
Inzwischen gibt es am Lagerstandort mehrere Gedenk-Stelen, die die Geschichte des Lagers und einzelne Opfer-Schicksale vorstellen. Dieses Denkmal ist auch Ergebnis des Kampfes der Überlebenden und ihrer Familien um Anerkennung ihres Leids.
Hier erfährt die/der Besucher*in z.B. das ein Opfer erst im Jahr 1985 seine von den Nazis aberkannte Staatsbürgerschaft zurück erhielt.
Auf einer Stele wird auch berichtet wie bereits die Zwangsuntersuchungen und -befragungen durch Dr. Robert Ritter Mitte der 1930er Jahre mit Misshandlungen einher gingen. So wird aus den Erinnerungen einer Überlebenden berichtet wie eine achtzig Jahre alte Frau an den Folgen solcher Misshandlungen verstarb.
Ein weiterer porträtierter Verantwortlicher für die Schikane und Terrorisierung, für Deportation und Verfolgung war der Polizist Leo Karsten von der „Dienststelle für Zigeunerfragen“ bei der Berliner Kriminalpolizei. Karsten setzte nach Kriegsende seine Polizei-Karriere als Kriminalobermeister in Ludwigshafen.
Wer sich das Denkmal in Marzahn anschauen will, die/der muss bis zur S-Bahn-Station S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße fahren.