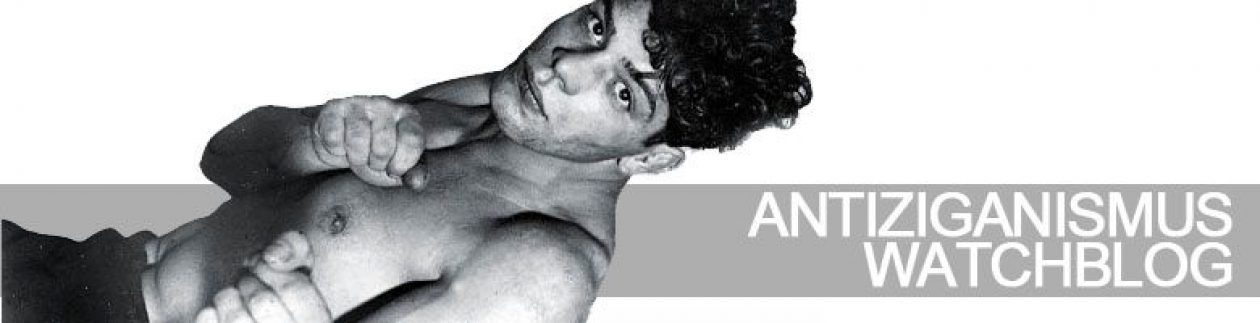Neonazis versuchten offenbar 2012, eine europäische Gruppe nach dem Vorbild des NSU zu bilden. Stand eine neue Mordserie bevor?
Sie waren zu neunt und hatten eine Idee: Sie würden sich mit anderen europäischen Neonazis verbünden. Sie würden töten, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Vor allem Roma sollten ihre Opfer sein. Um ihr Vorhaben zu besprechen, trafen sie sich auf dem Christkindlmarkt, zwischen Glühweinstand und Lebkuchenherzen, manchmal auch in einem Park. Sie redeten dann verklausuliert über ihre Aktion, die sie „Zweiter Frühling“ nannten. So steht es in geheimen Unterlagen zum „Zweiten Frühling“, die der SPIEGEL einsehen konnte. Sie legen einen brisanten Verdacht nahe. Wenn er zutrifft, haben die Neonazis schon ein Jahr nach der Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) im November 2011 darüber nachgedacht, eine Gruppe nach dessen Vorbild zu gründen. In einer Zeit, als sich die Republik intensiv mit der Aufarbeitung der NSU-Verbrechen befasste, überlegten sie, dessen Terror fortzusetzen. Der Name war verräterisch: „Frühling“ stand in großen Buchstaben auf den DVDs mit einem Bekennervideo des NSU. In dem Film hatten sich dessen Mitglieder zu einer rassistischen Mordserie bekannt. Und nun ein „Zweiter Frühling“? Die Behörden nahmen die Sache ernst: Jahrelang beobachteten Verfassungsschützer aus sechs Ländern sowie vom Bundesamt in Köln in einer gemeinsamen Operation namens „Mazoleti“ die Verdächtigen. Die Behörden waren so alarmiert, dass sie den Generalbundesanwalt einschalteten: Dieser ermittelte von März 2013 an gegen sieben namentlich bekannte und zwei unbekannte Männer wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die Gruppe bestand aus hochrangigen und seit vielen Jahren aktiven Neonazis. Auch zwei Funktionäre der National – demokratischen Partei Deutschlands (NPD) haben laut den Unterlagen dazugehört. Einer der Verdächtigen hatte sogar Kontakt zu den späteren Mitgliedern des NSU: Sein Name tauchte auf einer Telefonliste von Uwe Mundlos auf, die 1998 in der Bombenwerkstatt des späteren NSU-Täters gefunden wurde. Ein weiteres Mitglied hatte bereits Erfahrungen mit der Identifizierung „politischer Gegner“.
Der Mann war in den Neunzigerjahren an der Herstellung einer Publikation beteiligt, in der Namen, Fotos und Adressen von Antifaschisten veröffentlicht wurden. Das „enorme Gewaltpotenzial“ der Szene sei „nutzlos verschleudert“ worden, hieß es darin, statt „Aktionen entsprechend klug vorzubereiten und auf eine Gegnerzielgruppe hin zu kanalisieren“. Einige der Verdächtigen haben das Umfeld des späteren NSU-Trios schon seit Langem gekannt. Sie besuchten zum Beispiel Neonazi-Festivals, die Ralf Wohlleben mitorganisierte, der im Münchner NSU-Verfahren angeklagt ist. Diese fanden in Thüringen statt, der Heimat des Trios Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Laut Unterlagen haben sich die neun Neonazis systematisch konspirativ verhalten. Waren sie in einer großen Gruppe unterwegs, hätten sie sich unauffällig abgesondert, um sich zu besprechen. Einige Mitglieder seien nach Tschechien gereist, zum Schießtraining mit scharfen Waffen. Sie hätten verschlüsselt über E-Mail und Messengerdienste kommuniziert und sich stets „verklausuliert“ geäußert. Die interessantesten Dinge hätten sie „in persönlichen Gesprächen“ besprochen. Die Verfassungsschützer versuchten deshalb, möglichst nah an die Gruppe heranzukommen. Dafür reaktivierte das Landesamt in Nordrhein-Westfalen einen altgedienten V-Mann, der auch schon bei den Ermittlungen zum NSU eine Rolle gespielt hatte. Er lieferte aber offenbar nichts, was eine Anklage ermöglicht hätte. Allerdings war er wohl nicht der einzige Zuträger. Offenbar besorgte ein weiterer V-Mann Informationen aus dem inneren Kreis für die Behörden. Mitten in den Ermittlungen versiegte diese Quelle jedoch. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, die beteiligten Landesbehörden und die Bundesanwaltschaft wollen sich nicht zu der Operation äußern. Der SPIEGEL hat auch vier der Verdächtigen des „Zweiten Frühlings“ zu den Vorwürfen befragt. Drei haben geantwortet. Sie bestreiten vehement die Vorwürfe, einer spricht von einer „gezielten Kampagne einer europäischen Geheimdienst-Mafia“. Sie alle hätten noch nie etwas von einer Gruppe namens „Zweiter Frühling“ gehört. Sie seien zum Teil Familienväter und „an der Ermordung von Zigeunern“ nicht interessiert. In der Tat stellte der Generalbundesanwalt Anfang 2016 seine Ermittlungen nach drei Jahren ein. Hatten die Behörden mit ihrer länderübergreifenden Operation überhitzt reagiert? War es eine übertriebene Reaktion auf das Behördenversagen bei den Ermittlungen gegen den NSU? Beim Verfassungsschutz sieht man die Operation „Mazoleti“ jedenfalls als Erfolgsgeschichte. Man sei sehr früh auf diesen Fall gestoßen und habe Erkenntnisse gewinnen können. Genau das sei der Auftrag der Behörde, heißt es. Man werde die Verdächtigen und ihr Milieu weiter im Blick haben. Außerdem gibt es beim „Zweiten Frühling“ noch viele ungelöste Fragen: Zwei der mutmaßlichen Rechtsterroristen konnten die Behörden bis heute nicht identifizieren – sie sollen aus Tschechien kommen.
Quelle: Spiegel Online
Stand: 20.05.2017