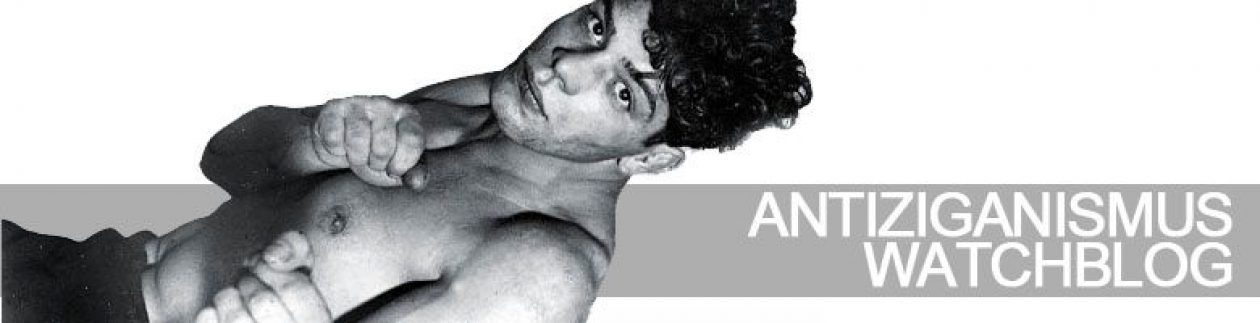Ähnlich wie der Antisemitismus besitzt auch der Antiziganismus eine christliche Traditionslinie. Dabei wurden Sinti und Roma von der Mehrheitsbevölkerung häufig in die Nähe des Teufels gerückt. Der kritische Historiker Wolfgang Wippermann [1] führt aus:
Verteufelt wurden neben den Juden und den hier unbedingt zu erwähnenden Hexen jedoch auch die Sinti und Roma. Anlaß und Beweis dafür war einmal die Hautfarbe der Sinti, die von den Chronisten als schwarz“ angegeben wurde. Schwarz galt nicht nur als häßlich und abscheulich, sie war auch die Farbe des Teufels. Den als abscheulich“ und schwarz“ bezeichneten Sinti wurde zusätzlich unterstellt, wie die Juden und Hexen geheime Kontakte mit dem Teufel zu unterhalten, von dem sie gewisse teuflische Fähigkeiten erworben hätten. Dazu wurde das Wahrsagen und Aus-der-Hand-Lesen sowie allerlei Schadenszauber gerechnet, durch den Sinti die Ernte der Bauern vernichten und ihre Scheunen und Häuser verbrennen könnten.
Gegen die „teuflischen Zigeuner“ halfen dem Aberglaube nach bestimmte (magische) Rituale wie der „Zigeunerbesen“. Wippermann [1]:
Er stammt aus dem mittelalterlichen Hexen- und Teufelsglauben, wonach Hexen vom Teufel die Fähigkeit hätten, auf Besen durch die Lüfte zu reiten, um sich dann auf dem Blocksberg mit dem Teufel zu paaren. Genau wie man Vampire mit Kruzifixen in Schach hält, wollten die guten norddeutschen Kaufleute die Sinti und Roma mit dem teuflischen Besen-Symbol abschrecken. Der Erfolg dieser Aktion war jedoch mäßig. Verschiedene Sinti und Roma hielten die Zigeunerbesen“ für Sonderangebote und fragten nach ihrem Preis.
Ironischerweise ist der Beruf der Besenmacher ein Beruf, der traditionell von Roma häufig ausgeübt wurde.
Alles Geschichte? Der mittelalterliche Brauch des „Zigeunerbesen“ lebt bis heute fort.

Zum Beispiel Rostock 1992
Es war im Sommer 1992 als sich Anwohnerinnen und Anwohner in Rostock-Lichtenhagen durch die Überbelegung eines Wohnheims durch zumeist osteuropäische Roma gestört fühlten. Daraufhin griffen sie es gemeinsam mit zugereisten Neonazis zwei Nächte hintereinander mit Steinen und Molotowcocktails an (Vgl. Ännecke Winckel: Antiziganismus. Rassismus gegen Roma und Sinti im vereinigten Deutschland, Münster 2002, Seite 90-92).
Der spezielle antiziganistische Gehalt der rassistischen Pogrome wird bis heute leider kaum erwähnt. So wird in der sehr sehenswerten TV-Dokumentation „The truth lies in Rostock“ aus dem Jahr 1993 erwähnt, dass unmittelbar vor Beginn der Gewalttaten ein anonymer Anruf bei der lokalen Zeitung: „Am Sonntag werden wir auf die Straße gehen. […] Die Roma werden aufgeklatscht.“
In der sehr TV-Doku wird auch das Auftauchen der „Zigeunerbesen“ in Rostock unmittelbar vor den Pogromen erwähnt („[…] doch Ladenbesitzer müssen Besen in ihre Fenster stellen, um Ausländer zu vertreiben.“).

Wippermann schreibt zu dem hartnäckigen Fortbestehen des antiziganistischen Brauchs [1]:
Die Zigeunerbesen“-Geschichte bestätigt die These des Philosophen Ernst Bloch, wonach Deutschland ein Land der Ungleichzeitigkeit“ sei. Neben modernen und aufgeklärten gäbe es hier auch ausgesprochen unmoderne und unaufgeklärte Denk- und Verhaltensweisen sowie abergläubische Praktiken. Antiziganistische Vorurteile wie die von den teuflischen Zigeunern“ gehören zweifellos hierher. Dennoch ist der Antiziganismus insgesamt keineswegs nur als Produkt und Erscheinungsform vergangener unmoderner und aufgeklärter Zeiten und Denkformen anzusehen. Aufklärung und Moderne haben ganz im Gegenteil zu seiner Radikalisierung beigetragen.
[1] Wolfgang Wippermann: Antiziganismus – Entstehung und Entwicklung der wichtigsten Vorurteile. „Zwischen Romantisierung und Rassismus“, aus: Landeszentrale für politische Bildung (Hg.): Sinti und Roma. 600 Jahre in Deutschland, 1998