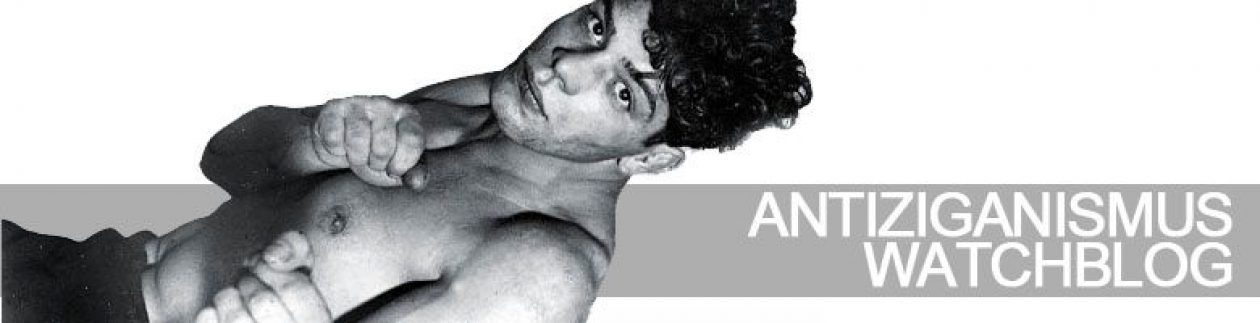Fünf Jahre ist die grausame Mordserie in Ungarn her – sechs Roma starben damals. Doch viele würden die rechten Gewalttaten am liebsten vergessen. Im Wahlkampf nutzen Politiker den Fremdenhass für ihre Zwecke.
Die Täter kamen kurz nach Mitternacht. Sie hatten sich durch ein Maisfeld angeschlichen, dann weiter durch den Garten. Nirgends brannte noch Licht, alle Bewohner schienen zu schlafen. Der Angriff dauerte kaum mehr als eine Minute. Die beiden Täter traten die Tür des Hauses ein, einer ging in den vorderen Raum und schoss mit seiner Schrotflinte auf die schlafende Frau. Der andere, im hinteren Raum, feuerte auf das Mädchen. Einige Nachbarn hörten die Schüsse. Sie dachten, jemand spiele mit Böllern. Im Morgengrauen fand eine Verwandte Mutter und Tochter in Blutlachen.
Kisléta, ein kleines ostungarisches Dorf, war am 3. August 2009 der Schauplatz des letzten Mordes einer Anschlagsserie. Rechtsterroristen töteten binnen eines Jahres sechs Roma, darunter einen vierjährigen Jungen. 55 Menschen wurden verletzt, teils lebensgefährlich. Drei Wochen später wurden vier fanatische Rechtsextreme in der ostungarischen Stadt Debrecen gefasst.
„Der Regierung ist das Thema peinlich“
In Kisléta hatten zwei von ihnen die verwitwete Mária Balogh, 45, erschossen. Ihre Tochter Tímea, damals 13, überlebte mit schwersten Verletzungen. Sie möchte nicht, dass die Öffentlichkeit Einzelheiten des grausamen Anschlags erfährt. Über ihre Mutter sagt sie: „Sie war so ein guter Mensch. Ich vermisse sie sehr.“
Öffentliches Gedenken findet heute, fünf Jahre nach dem letzten Mord, in Ungarn praktisch nicht statt. „Sowohl Mitgliedern der ehemaligen sozialistisch-liberalen Regierung, in deren Amtszeit die Morde verübt wurden, als auch der jetzigen Regierung unter Viktor Orbán ist das Thema peinlich“, sagt der ehemalige liberale Abgeordnete József Gulyás. Er leitete 2009 einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Roma-Morden. „Es geht um eine rassistische Mordserie, die in Mittelosteuropa beispiellos ist. Die meisten führenden Politiker Ungarns möchten die Angelegenheit schnell und geräuschlos abschließen.“
Dabei gäbe es viel aufzuarbeiten. Ähnlich wie im Fall der NSU-Morde spielten ungarische Behörden während der Mordserie eine unrühmliche Rolle: Geheimdienste hielten Erkenntnisse über die Täter zurück. Spuren ins rechtsextreme Milieu wurden zu spät verfolgt, Ermittlungserkenntnisse nicht rechtzeitig zentralisiert und abgeglichen.
Angehörige leben in immer größerer Not
Eine Entschuldigung dafür hörten die überlebenden Opfer von Vertretern der einstigen sozialistisch-liberalen Regierung bisher nicht. Immerhin: Zoltán Balog, Minister für Humanressourcen der Orbán-Regierung, hält jedes Jahr am 3. August einen Gedenkgottesdienst ab. Überlebende und Angehörige der Roma-Morde sind eingeladen. Für sie initiierte er auch eine humanitäre Opferhilfe: Sie bekamen von der Orbán-Regierung jeweils zwischen vier- und siebenttausend Euro ausgezahlt, um ihre Wohn- und Lebenssituation zu verbessern.
Das war auch nötig, denn die meisten von ihnen leben in tiefster Armut: In Häusern ohne fließendes Wasser, Gasanschluss oder Kanalisation. Manche verloren nach den Anschlägen ihre Arbeitsplätze, erkrankten physisch oder psychisch. Zwar konnten einige betroffene Familien ihre Häuser modernisieren lassen, andere wollen demnächst umziehen. Dennoch reicht die Hilfe kaum.
Nun könnten die Opfer der Roma-Morde den ungarischen Staat auf Entschädigungen verklagen – doch erst, wenn ein rechtskräftiges Urteil gegen die Täter vorliegt. Bis dahin vergeht wohl noch viel Zeit: Drei Täter wurden Anfang August vergangenen Jahres erstinstanzlich zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Doch das Folgeverfahren kann nicht beginnen, weil der Richter der ersten Instanz bisher kein schriftliches Urteil vorgelegt hat. Derzeit läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn.
Regierung verspricht rückhaltlose Aufklärung
Die Folgeermittlungen zur Mordserie laufen, mit Unterbrechungen, seit Jahren: So fahnden Ermittler nach einem Komplizen der Roma-Mörder, der half, Waffen für die Mordanschläge zu rauben. Auch hochrangige Beamte im Militärgeheimdienst KBH müssen sich Fragen gefallen lassen. Sie hatten einen der Mörder als Informanten angeworben und wussten möglicherweise von den Taten. Hinweise des Mannes sollen sie aber nicht weitergegeben haben.
Alle Ermittlungen sind geheim, doch Minister Zoltán Balog verspricht rückhaltlose Aufklärung und zieht dabei Parallelen zu den NSU-Morden: „So wie in Deutschland haben auch in Ungarn die Geheimdienste bei der Aufklärung dieser Morde versagt. War das Absicht, war das Fahrlässigkeit? Da müssen wir nachhaken.“
Doch daran hat die Mehrheit der politischen Elite in Ungarn kein Interesse. Das zeigt ein aktuelles Beispiel aus der Kampagne für die Kommunalwahlen im Herbst. In der ostungarischen Großstadt Miskolc, in der viele Roma leben, treten drei romafeindliche Kandidaten an: Der amtierende Bürgermeister und ein rechtsextremer Herausforderer wetteifern, wer Roma aus der Stadt möglichst effizient in umliegende Dörfer zwangsaussiedeln kann.
Dritter im Bunde ist der Kandidat der drei größten sozialistisch-linksliberalen Oppositionsparteien, Albert Pásztor. Als Polizeichef von Miskolc machte er 2009 mit der Bemerkung Schlagzeilen, Straftaten würden fast ausschließlich von Roma begangen. Heute „bedauert“ er seine damaligen Worte. Der Tageszeitung „Népszabadság“ erklärte er aber zuletzt: „Unter Zigeunerproblem verstehe ich, dass ein bedeutender Teil der Zigeuner sich nicht integrieren kann und kriminell ist.“
Quelle: Spiegel Online
Stand: 31.07.2014