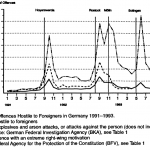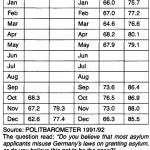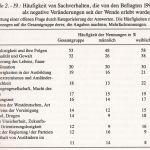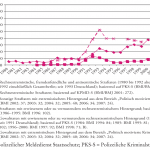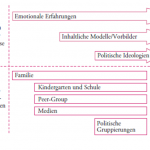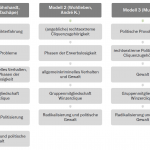5 Wir kommen wieder keine Frage – Lehren für die Zukunft
Das Bekennervideo des NSU beginnt mit einer Erklärung:
„Der Nationalsozialistische Untergrund ist ein Netzwerk von Kameraden mit dem Grundsatz – Taten statt Worte – Solange sich keine grundlegenden Änderungen in der Politik, Presse und Meinungsfreiheit vollziehen werden die Aktivitäten weitergeführt.“
und endet mit der Drohung:
„Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder keine Frage.“
Die Ersteller*innen dieses Videos erklären selbst, dass sie kein Trio sind, sondern Teil eines Netzwerkes. Die Annahmen, dass es sich bei Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt um das „NSU-Trio“ handelt, ist falsch. Unterstützer*innen, Befürworter*innen und Helfer*innen dieses Netzwerkes sind weiter Teil der Gesellschaft, sympathisieren mit Taten und Ideologien und können ungehindert weitere mögliche Taten planen und begehen. Das Problem des rechtsextremistischen Terrorismus ist also nicht behoben, nicht alle Beteiligten sind aufgespürt und die Ideologie besteht weiter. „Dieser gesellschaftliche Schoß, aus dem der Rechtsterrorismus kroch, ist noch fruchtbar.“ (Quent 2018, S.158)
Es ist der Umgang mit diesem Wissen, der Umgang mit den Lehren aus der Geschichte, der für die Zivilgesellschaft und die Politik Handlungsmaxime sein muss. Wie kann sich eine Gesellschaft schützen und wehren, um die Unversehrtheit aller Menschen zu garantieren?
Es braucht eine Gesellschaft der Menschenwürde, die solidarisch für diejenigen eintritt, die benachteiligt, bedroht und verfolgt werden. Eine Gesellschaft, die sich souverän und geschlossen einbringt, Themen besetzt und politische Alternativen, „eine Gegenstruktur“ (Deutscher Bundestag 2012, S.54) anbietet. Antifaschismus darf nicht als Kampfbegriff und Gleichsetzung mit Linksextremismus verstanden werden, sondern muss als Grundmaxime des Handelns der Gesellschaft dienen. Nur durch konsequenten, gelebten Antifaschismus kann rechtsextremistischen Tendenzen in der Gesellschaft konsequent und selbstbewusst begegnet werden. Die Sachverständige Röpke sagte im 2. Untersuchungsausschuss des Bundestages: „Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass sich die Neonazis dort zurückziehen, wo ein Milieu herrscht, in dem sie sich nicht wohlfühlen und in dem sie nicht dominieren können.“ (ebd., S.55) Die Leitlinie des „Wehret den Anfängen!“ darf nicht länger historische Floskel, aber ernstgemeinter Handlungsaufruf sein.
Aus dem Bewusstsein dafür, dass der Rechtsextremismus „ein gesellschaftliches Phänomen ist, ist es eine Daueraufgabe, mit der wir uns beschäftigen müssen, unabhängig davon, ob wir grandiose Wirkungen oder teilweise auch nur kleine Wirkungen erzielen. Selbst ein Projekt, das nur eindämmt und den Status quo beibehält, kann sinnvoll sein“ (ebd., S.54).
Es braucht eine Politik der Demokratieverteidigung, die sich aktiv für ihre freiheitlichen Grundwerte einsetzt. Es wurden und werden jährlich rund 20 Millionen Euro für die Bekämpfung des Rechtsextremismus aufgewendet. Dieses Geld gilt es sinnvoll und zielgerichtet einzusetzen. Präventionsmaßnahmen sind hierbei essenzieller Teil, genauso wie die Verfolgung durch die Strafbehörden. Eine weitere politische Maßnahme ist das Aussteigerprogramm „EXIT-Deutschland“, das einen sicheren Ausstieg aus der rechtsextremen Szene bietet. Es darf nicht wieder vorkommen, dass „die Gefahren des Rechtsextremismus […] in Deutschland jahrelang auf allen Ebenen verkannt und verharmlost wurde“ (Deutscher Bundestag 2013, S.873). Daraus leitet sich die Forderung der LINKEN ab, „Die Treppe muss von oben gekehrt werden.“ (ebd., S.1041). Es muss Verantwortung übernommen werden für Fehler und die Bereitschaft für Veränderungen muss entstehen, damit sich diese nicht wiederholen.
In der Zukunft muss als „Sicherheit die Sicherung der Freiheit“ (ebd., S.1040) aller Menschen verstanden und sich dessen verschrieben werden.
Es braucht eine Wissenschaft des kritischen Forschens. Sie muss „Gruppenprozesse und Reaktionen innerhalb der Bewegung auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse und staatliche Handlungen aufmerksam und gründlich“ (Quent 2019, S.326) analysieren und erforschen. Einen Teil hierfür bieten die „Mitte-Studien“ der Universität Leipzig oder auch die zwischen 2002 und 2010 veröffentlichen Bände der „Deutschen Zustände“. Durch die Analyse der Einstellungen in der Gesellschaft, kann es gelingen, Tendenzen in der Bevölkerung zu erkennen und auf diese zu reagieren. Des Weiteren muss der Wissenschaft „zur Aufhellung des Dunkelfeldes rechtsextremistischer und rassistischer Straftaten ein Forschungsauftrag vergeben“ (Deutscher Bundestag 2013, S.898) werden. Nur so können „aus den identifizierten Mechanismen Lehren […] für die Präventions- und Deradikalisierungsarbeit“ gezogen werden.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich ein identischer Fall wiederholen wird, jedoch sind ähnliche Fälle nicht neu, sondern bereits heute Alltag. Halle. Hanau. Kassel. Drei Orte und drei Taten, die uns heute an die Taten von gestern erinnern, um daraus für morgen zu lernen.
6 Fazit
Zur Urteilsverkündung am 21. Dezember 2020 im Halle-Prozess schrieb Jan Sternberg für das Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Artikel mit der Überschrift: „Einer ist schuldig – wir alle sind verantwortlich“ (Sternberg 2020).
Diese Zeilen sind aktueller denn je und lassen sich wie eine Blaupause auf die Thematik des NSU-Komplexes und die Verurteilung Beate Zschäpes legen.
Die These, dass die deutsche Gesellschaft faktisch mitgemordet habe, ist in ihrer Härte unbegründet, jedoch hat sich gezeigt, dass eine Bezeichnung der deutschen Nachwendegesellschaft als „klatschende Terrorhelfer“ überspitzt zutreffender ist. Es war der Hitlergruß der 90er Jahre, der den Rassismus bei Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt geweckt, gefördert hat.
Erst durch das gesellschaftliche Klima der 1990er Jahre konnte sich der spätere NSU bilden. Die rassistische Gesellschaft als Sozialisationsinstanz der damaligen Jugendlichen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe trägt eine Mitverantwortung an der Radikalisierung der späteren Täter*innen. Es lässt sich sagen, dass sie, die Gesellschaft, die Entwicklung von einer Jugendclique zu einer terroristischen Vereinigung erst ermöglicht hat. Jedoch darf nicht der Schluss erfolgen, dass die Täter*innen unschuldig oder schuldunfähig auf Grund ihrer Prägungen seien, die sie erst zu diesen Menschen gemacht haben. Der Umgang mit Erlebnissen oblag immer den einzelnen Individuen. Der Gang in den Untergrund, jeder einzelne Anschlag, Überfall und Mord an Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter war eine bewusste Entscheidung, die von Rassismus und rechtsextremistischer Ideologie geprägt war.
Es ist gelungen, durch die Analyse der gesellschaftlichen und individuellen sozialisatorischen Gesichtspunkte die Genese des NSU soziologisch zu untersuchen und zu zeigen, dass eine Gesellschaft rechtsextremistischen Terrorismus hervorbringen kann, wenn sie selbst auf dem Boden eines freiheitlich demokratischen Staates steht, dessen Werte jedoch nicht lebt und teilt.
Die Frage nach Schuld, Unschuld und Mitverantwortung ist eine juristische Aufgabe. Nur Gerichten steht es zu, jemanden schuldig oder frei zu sprechen. Es ist Ziel dieser Arbeit, den individuellen Reflexionsprozess zu befördern, das eigene vergangene und momentane Handeln kritisch zu betrachten, um selbst bestimmen zu können, ob das eigene Handeln richtig war und ist. Das Volk muss sich seiner Rolle bewusst sein, damit in ‚Volkes Namen‘ ein Urteil gefällt werden kann.
Die Urteilsverkündung in München darf keineswegs als Schlussstrich, sondern muss als Startlinie betrachtet werden. Als Ausgangspunkt für zivilgesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Aktivitäten, Engagements und Forschungen. Nur wenn kontinuierlich die Entwicklungen der Vergangenheit und Gegenwart kritisch betrachtet werden, kann für die Zukunft aus Fehlern gelernt werden. Der Rechtsextremismus war nie weg, ist immer da und wird immer eine Bedrohung für die vielfältige, demokratische und freiheitliche Gesellschaft darstellen.
Heute gilt wie eh und je: Kein Vergeben! Kein Vergessen!
7 Literatur
Bergmann, Jörg; Leggewie, Claus (2010): Die Täter sind unter uns. Beobachtungen aus der Mitte Deutschlands. In: Christoph Bieber, Benjamin Drechsel und Anne-Katrin Lang (Hg.): Kultur im Konflikt. Claus Leggewie revisited. Bielefeld: transcript Verlag, S. 301–328.
Bolz, Hendrik (2019): Sieg-Heil-Rufe wiegten mich in den Schlaf. Jugend im Osten. der Freitag. Die Wochenzeitung. Online verfügbar unter https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/sieg-heil-rufe-wiegten-mich-in-den-schlaf, zuletzt geprüft am 11.11.2020.
Botsch, Gideon (2019): Was ist Rechtsterrorismus? In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Aus Politik und Zeitgeschichte. Rechtsterrorismus, S. 9–14.
Bundeszentrale für politische Bildung (2013): Vor zwanzig Jahren: Einschränkung des Asylrechts 1993. Online verfügbar unter https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/160780/asylkompromiss-24-05-2013, zuletzt geprüft am 22.11.2020.
Deutscher Bundestag (1992): Plenarprotokoll 12/110.
Deutscher Bundestag (2012): Stenografisches Protokoll der 8. Sitzung des 2. Untersuchungsausschusses. Protokoll.
Deutscher Bundestag (2013): Drucksache 17/14600. Beschlussempfehlung und Bericht des 2. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes.
Förster, Peter; Müller, Harry; Friedrich, Walter; Schubarth, Wilfried (1993): Jugend Ost. Zwischen Hoffnung und Gewalt. Opladen: Leske + Budrich.
Heitmeyer, Wilhelm (1992): Jugend, Staat und Gewalt in der politischen Risikogesellschaft. In: Wilhelm Heitmeyer, Kurt Möller und Heinz Sünker (Hg.): Jugend – Staat – Gewalt. Politische Sozialisation von Jugendlichen, Jugendpolitik und politische Bildung. 2. Aufl. München: Juventa-Verl., S. 11–46.
Heitmeyer, Wilhelm (1992): Rechtsextremisitisch motivierte Gewalt und Eskalation. In: Wilhelm Heitmeyer, Kurt Möller und Heinz Sünker (Hg.): Jugend – Staat – Gewalt. Politische Sozialisation von Jugendlichen, Jugendpolitik und politische Bildung. 2. Aufl. München: Juventa-Verl., S. 205–2018.
Heitmeyer, Wilhelm (2020): Autoritäre Versuchungen. 4. Auflage. Berlin: Suhrkamp.
Heitmeyer, Wilhelm; Freiheit, Manuela; Sitzer, Peter (2020): Rechte Bedrohungsallianzen. 1. Originalausgabe. Berlin: Suhrkamp (Signaturen der Bedrohung).
Heitmeyer, Wilhelm; Möller, Kurt; Sünker, Heinz (Hg.) (1992): Jugend – Staat – Gewalt. Politische Sozialisation von Jugendlichen, Jugendpolitik und politische Bildung. 2. Aufl. München: Juventa-Verl.
Hurrelmann, Klaus; Quenzel, Gudrun (2013): Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung. 12., korrigierte Auflage. Weinheim: Beltz Juventa.
Kahveci, Çagri; Pinar Sarp, Özge (2017): Von Solingen zum NSU. Rassistische Gewalt im kollektiven Gedächtnis von Migrant*innen türkischer Herkunft. In: Juliane Karakayali, Çagri Kahveci, Carl Melchers und Doris Liebscher (Hg.): Den NSU-Komplex analysieren. Aktuelle Perspektiven aus der Wissenschaft. Bielefeld: transcript Verlag, S. 37–56.
Landtag Mecklenburg-Vorpommern (1993): Drucksache 1/3277. Beschlussempfehlung und Zwischenbericht des 2. Untersuchungsausschusses nach Artikel 34 der vorläufigen Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und dem vorläufigen Untersuchungsausschußgesetz.
Möller, Kurt; Schuhmacher, Nils (2007): Ein- und Ausstiegsprozesse rechtsextremer Skinheads. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Aus Politik und Zeitgeschichte. Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Bonn, S. 17–23.
Oberlandesgericht München, Urteil vom 11.07.2018, Aktenzeichen 6 St 3/12.
Ohlemacher, Thomas (1994): Public Opinion and Violence Against Foreigners in the Reunified Germany. In: Zeitschrift für Soziologie 23 (3), S. 222–236.
Pfahl-Traughber, Armin (2018): Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. In: Eckhard Jesse und Tom Mannewitz (Hg.): Extremismusforschung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 303–338.
Quent, Matthias (2018): Rassismus als Fluchtpunkt der Dissonanzgesellschaft. Überlegungen zu den Entstehungshintergründen des NSU. In: Mechthild Gomolla, Ellen Kollender und Marlene Menk (Hg.): Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland. Figurationen und Interventionen in Gesellschaft und staatlichen Institutionen. 1. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa, S. 143–160.
Quent, Matthias (2019): Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus. Wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Weinheim: Beltz Juventa.
Ramelsberger, Annette; Ramm, Wiebke; Schultz, Tanjev; Stadler, Rainer (2018): Der NSU-Prozess. Das Protokoll. München: Verlag Antje Kunstmann.
Ramelsberger, Annette; Ramm, Wiebke; Schultz, Tanjev; Stadler, Rainer (2018): Der NSU-Prozess. Das Protokoll. Materialien. München: Verlag Antje Kunstmann.
Rieker, Peter (2007): Fremdenfeindlichkeit und Bedingungen der Sozialisation. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Aus Politik und Zeitgeschichte. Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Bonn, S. 31–38.
Sitzer, Peter; Heitmeyer, Wilhelm (2007): Rechtsextremistische Gewalt von Jugendlichen. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Aus Politik und Zeitgeschichte. Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Bonn, S. 3–10.
Speit, Andreas (2013): Der Terror von rechts – 1991 bis 1996. In: Andrea Röpke und Andreas Speit (Hg.): Blut und Ehre. Geschichte und Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland. 1. Auflage. Berlin: Ch. Links Verlag, S. 94–121.
Sternberg, Jan (2020): Urteil im Halle-Prozess: Einer ist schuldig – wir alle sind verantwortlich. Hg. v. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Online verfügbar unter https://www.rnd.de/politik/urteil-im-halle-prozess-einer-ist-schuldig-wir-alle-sind-verantwortlich-html, zuletzt geprüft am 27.12.2020.
Thüringer Landtag (2014): Drucksache 5/8080. Bericht des Untersuchungsausschusses 5/1 „Rechtsterrorismus und Behördenhandeln“.
Tribunal „NSU-Komplex auflösen“ (2017): Wir klagen an! Köln: Lückenlos e.V.
Wetzel, Wolf (2015): Der NSU-VS-KOMPLEX. Wo beginnt der Nationalsozialistische Untergrund – wo hört der Staat auf? 3. aktualisierte und erweiterte Auflage. Münster: UNRAST-Verlag.
Winkelmann, Thorsten; Ruch, Hermann (2018): Extremismus in Deutschland. Rechtsextremismus. In: Tom Mannewitz, Hermann Ruch, Tom Thieme und Thorsten Winkelmann (Hg.): Was ist politischer Extremismus? Grundlagen – Erscheinungsformen – Interventionsansätze. Berlin: Wochenschau Verlag, S. 47–80.