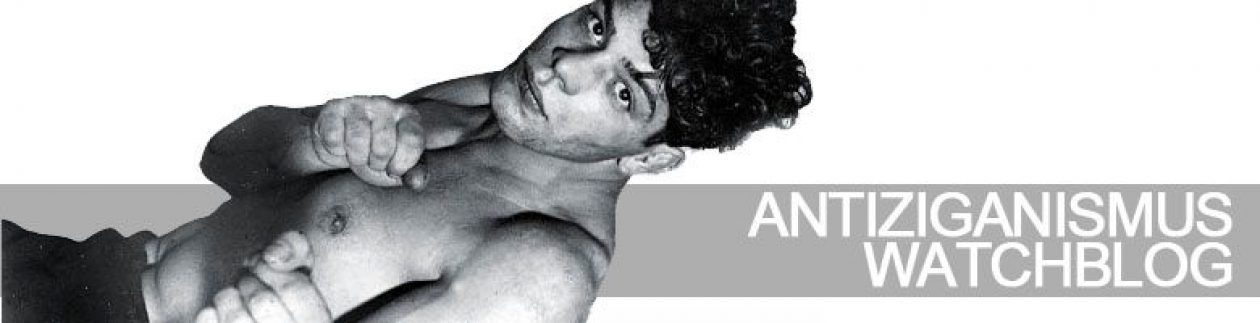It seems that the denial of genocide and the denial of racism are communicating vessels. An ethnic group whose genocide is denied continues to be targeted with racism. Conversely, the recognition of genocide can start a healing process in society that can help it overcome racism. The Romani Holocaust, called the „porajmos“ (destruction) in Romanes, is a part of history that is not only forgotten today, it is even denied. We do not know much about this aspect of the Holocaust. There are just a few books about it, and very little historical research. Be that as it may, some forgotten parts of the Romani Holocaust really deserve commemoration. Romani people did not always play the role of passive victims during that era. What happened on 16 May 1944? In the extermination camp of Auschwitz II – Birkenau, section BIIe was called the „Gypsy Camp“ (Zigeuner Lager). Some of the Romani people transported into the hell of Auschwitz by the Nazis were not gassed immediately upon arrival, but were placed in the Zigeuner Lager. BIIe was a „mixed“ camp, which meant children, men and women were imprisoned there together. The Romani prisoners were forced into slave labor, observed and subjected to medical tests, and tortured. Dr Josef Mengele of the SS, a sadistic psychopath known as the „Angel of Death“, chose Romani individuals, most of them children, to subject to perverse experiments. During the night of 2 August and the early morning of 3 August 1944, all of the prisoners of the camp, without exception, were murdered in the gas chambers. Because of this known, official history, 2 August has been commemorated as Romani Holocaust Day. Continue reading 16 May 1944: Romani Resistance Day
Category Archives: Geschichte des Antiziganismus
J. Tatarinov: Zigeuner- und Wandergewerbepolitik im späten Kaiserreich
Für die nationalsozialistische Verfolgung von als „Zigeuner“ stigmatisierten Menschen sind in den letzten Jahren mehrfach die auffallend breiten Entscheidungsspielräume lokaler Akteure betont worden.[1] Dass sich dies auch für das Kaiserreich und die Weimarer Republik konstatieren lässt, verdeutlicht Juliane Tatarinovs lokalhistorische Dissertation auf anschauliche Weise. Innovativ ist jedoch etwas anderes an ihrer Arbeit: Sie fragt nach Aushandlungsprozessen und Handlungsstrategien im Umgang mit Wandergewerbetreibenden zwischen 1890 und 1933. Dabei ist insbesondere von Interesse, wie und warum sich der Begriff des „Wandergewerbes“ mit dem des „Zigeuners“ überschnitt und wie sich das in der lokalen Praxis äußerte. Hierbei profitiert Tatarinovs Arbeit von der Anbindung an den Trierer Sonderforschungsbereich „Fremdheit und Armut“, der zwischen 2002 und 2012 die historische Armutsforschung wesentlich vorangetrieben und eine beispielhafte Verknüpfung sozial- und kulturgeschichtlicher Zugriffe auf das Thema erzielt hat. Wie fruchtbar im Kontext der Armutsforschung die Beschäftigung mit dem Wandergewerbe und der Zigeunerpolitik ist, zeigt die 2014 an der Universität Trier verteidigte Dissertation.
Tatarinov konzentriert sich auf das Wandergewerbe in den Regierungsbezirken Trier und Koblenz, ausgehend davon, dass mobile Armut in den Regionen Eifel und Hunsrück eine „alltägliche Erscheinung“ (S. 14) darstellten. Zudem verfolgt sie einen akteurszentrierten Ansatz. Hervorzuheben ist ihr Blick auf den ländlichen Raum sowie ihre mit den Akteuren verbundene Frage „nach dem lebensweltlichen Kontext der ambulanten Familien und ihrer Selbstrepräsentation vor den Behörden“ (S. 12). Mittels der Auswertung von Polizeiakten und -verordnungen, juristischen und sozialpolitischen Texten, Reichstagsprotokollen, Statistiken, Hausiererzeitschriften, Wandergewerbeakten, Beschwerdeschreiben von Betroffenen und vereinzelt auch Presseartikeln veranschaulicht Tatarinov, dass Wandergewerbepolitik und Zigeunerpolitik zunächst parallel als Problemfelder entworfen wurden, sie sich jedoch zunehmend überschnitten. In der Weimarer Republik radikalisierte sich die Verfolgung des ambulanten Gewerbes, was wesentlich mit einer Kategorisierung der Wandergewerbetreibenden als „Zigeuner“ einherging. Continue reading J. Tatarinov: Zigeuner- und Wandergewerbepolitik im späten Kaiserreich
Gedenken an Holocaust-Überlebende: Bayern will Sinti- und Roma-Gräber erhalten
Bayern stellt 40.000 Euro für den dauerhaften Erhalt der Grabstätten verfolgter Sinti und Roma, die den Holocaust überlebten. Seit vier Jahren wartet der Freistaat auf eine offizielle Regelung des Bundes – jetzt will man handeln.
Seit 2012 liegt auf Initiative Bayerns bei der Bundesregierung eine Entschließung der Länder, den Erhalt der Gräber von Holocaustüberlebender der Sinti und Roma zu sichern. Bis heute ist nichts passiert. Deshalb hat Bayern jetzt für den Erhalt von rund 500 im Freistaat liegenden Gräbern 40.000 Euro zugesagt, berichtete Staatskanzleiminister Marcel Huber nach einem Gespräch mit Vertretern Deutscher Sinti und Roma. Die bayerische Regelung sei zudem eine Aufforderung an den Bund, seiner Verantwortung für die Opfer des NS-Regimes in diesem Bereich nachzukommen, so Huber weiter.
Jedes Grab ein Gedenken
Bayern wolle nicht mehr so lange warten, bis sich der Bund zu einer Regelung entschließe, sondern handele jetzt, damit offene Grabgebühren bezahlt werden könnten, sagte Huber dem Bayerischen Rundfunk.
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, lobte die bayerische Initiative als wichtigen Druck auf die Bundesregierung. Denn jedes Grab eines Holocaustüberlebenden sei eine Gedächtnisstätte und ein Lernort.
Denkmal geplant
Mitorganisiert werden soll der Erhalt der Gräber von Sinti und Roma auf diversen Friedhöfen in Bayern von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Zudem soll noch in diesem Jahr im ehemaligen Konzentrationslager Flossenbürg ein Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma entstehen, die vorwiegend aus Osteuropa kamen.
Vom NS-Regime verfolgt
Die Nürnberger Rassengesetze von 1935 führten zur Verfolgung und Ermordung von etwa 24.000 Sinti und Roma in Deutschland. Die meisten der bayerischen Sinti und Roma wurden direkt ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht.
Quelle: Bayrischer Rundfunk
Stand: 11.03.2016
1938-1940: Deportation of the Roma and Sinti
Hitler’s pseudoscientific attack on the „Gypsies“ of Europe
In 1938, there were approximately 35,000 so-called Gypsies living in Germany and Austria. Named for their supposed origin in Egypt (the ethnic group actually originated in northern India), most of the “Gypsies” belonged to the Roma and Sinti tribes.
The Roma and Sinti in Europe had long suffered from discrimination and ostracism, which only worsened under the Third Reich. With the rise of Nazism came an obsession with racial purity and eugenics.
Hitler’s regime charged Dr. Robert Ritter, Dr. Sophie Ehrhardt and nurse Eva Justin with conducting extensive pseudoscientific research into the genealogies of Roma and Sinti communities. In 1940, Ritter claimed that 90% of “Gypsies” in Germany were “of mixed blood,” and “the products of matings with the German criminal asocial subproletariat.”
By this logic, anyone with a drop of Roma or Sinti blood was deemed alien, prone to criminality and unsuited for society. Tens of thousands of Roma and Sinti were deported to concentration camps, where they were subjected to forced labor, medical experimentation and extermination. Historians estimate that the Nazi regime and its allies killed around 25% of all European Roma, possibly as many as 220,000.
Pictures & Soure: Retronaut
Date: 29.12.2015
Papuşa survived the Romani Holocaust – now she begs in Stockholm
Papuşa Ciuraru, 81, survived the genocide of the Roma people during the Second World War. She is now a beggar on the streets of Stockholm. It’s freezing. But I do it for my dear grandchildren, she says.
An old woman is begging by the entrance to Kungshallen, a food court at Hötorget in central Stockholm. Her face is wrinkled and her body is weighed down under her two coats. The old woman would like enter the food court to warm up her frozen fingers. Approach the guests with her empty coffee cup and ask for some coins. But every time she has tried to enter, a waiter or a guard has come up to her:
– You have to leave!
– You scare our guests!
The woman’s name is Papuşa Ciuraru and what neither the restaurant guests, nor the waiters know is that she is one of the great survivors of the 20 century. Looking at her ID, you would think that Papuşa is born in 1945. That is not true. The date was set by Romanian authorities at the end of the Second World War, when there was chaos in Europe with far more refugees than today. In fact Papuşa Ciuraru was born several years earlier. Around 1934, according to people close to her. That means that Papuşa – her name means „doll“ in Romanian – is around 81 years old. She grew up close to the town of Buhuși in northeastern Romania. Her father and grandfather were skilled metal workers and the family were nomads, travelling from village to village with their horse and wagon selling copper kettles. On a winter day in 1942, Romanian policemen approached their camp and started shooting. Continue reading Papuşa survived the Romani Holocaust – now she begs in Stockholm
„Vergasen“ – Wir haben ein zunehmendes Problem: Antiziganismus
Die Schändung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma mit einem Hakenkreuz und dem Wort „Vergasen“ ist die jüngste Eskalationsstufe des alltäglichen Antiziganismus. Dieser wird vor allem von Vertretern der bürgerlichen Mitte geschürt.
Das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma im Zentrum wurde mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Täter hinterließen unter anderem den Schriftzug „Vergasen“. Dies teilte die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas Ende Oktober 2015 in Berlin mit.
Im Jahr 1992 beschloss die damalige Bundesregierung nach jahrelangem Druck verschiedener Selbstorganisationen, ein „Denkmal für die Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes an den Sinti und Roma“ zu errichten. Um den Text einer zunächst geplanten Widmung des Denkmals gab es zwischen den beiden von der Bundesregierung in die Vorbereitungen einbezogenen Opferverbänden Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und Sinti Allianz Deutschland sowie der Bundesregierung jahrelange einen unwürdigen Streit.
Die Bundesregierung hatte die stigmatisierende Bezeichnung der Mehrheitsgesellschaft „Zigeuner“ für den Denkmaltext vorgesehen, was der Zentralrat als unwürdig und unzumutbar ablehnte. Hier zeigte sich mindestens eine fehlende Sensibilisierung, die neues Vertrauen in die Lernfähigkeit des deutschen Staates zerstörte.
Widerstand gegen den Bau des Denkmals gab es aus den Reihen der Berliner CDU. Der damalige Bürgermeister Eberhard Diepgen meinte, in der Stadt gebe es „keinen Platz für ein weiteres Mahnmal.“ Der damalige CDU-Fraktionschef Klaus Landowsky erklärte, „wir müssen noch erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen können.“ Die durch die Meinungsverschiedenheiten verzögerten Bauarbeiten zum Denkmal begannen dann symbolisch am 19. Dezember 2008, dem offiziellen Gedenktag des Bundesrates für die Opfer des Völkermordes an den Sinti und Roma.
Das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas wurde am 24. Oktober 2012 im Beisein der Bundeskanzlerin Angela Merkel und des Bundespräsidenten Joachim Gauck eingeweiht.5 Es befindet sich in Berlin-Mitte etwas südlich des Reichstages. Der israelische Künstler Dani Karavan schuf ein kreisrundes Wasserbecken mit zwölf Metern Durchmesser mit schwarzem Grund. In die Beckenmitte platzierte der Künstler eine dreieckige steinerne Stele, die von oben gesehen an den Winkel auf der Kleidung der KZ-Häftlinge erinnert. Auf der Stele liegt eine frische Blume. Immer wenn sie verwelkt ist, versinkt der Stein in einen Raum unter dem Becken, wo eine neue Blume auf den Stein gelegt wird, um danach wieder hochzufahren und aus dem Wasserbecken emporzusteigen.
Die Schmierereien sind inzwischen entfernt worden. Die Stiftung, die auch für die Betreuung des Denkmals zuständig ist, habe Anzeige erstattet und die Sicherheitsmaßnahmen an der Gedenkstätte nahe dem Brandenburger Tor verstärkt. Der Staatschutz wurde eingeschaltet und ermittelt nun gegen Unbekannt. Continue reading „Vergasen“ – Wir haben ein zunehmendes Problem: Antiziganismus
Fragwürdiger Armutsvoyeurismus: Das Bild des »Zigeuners«
»Wer Macht über Bilder hat, hat gleichzeitig Deutungsmacht über Menschen«, schreibt Frank Reuter in seiner hochaktuellen Studie »Der Bann des Fremden. Die fotografische Konstruktion des „Zigeuners“«. Er fordert dazu auf, die eigenen Sehgewohnheiten kritisch zu hinterfragen und statt der simplifizierenden Bildikone die Verschiedenheit innerhalb der Minderheit zu entdecken.
Es reicht ein oberflächlicher Blick auf die bundespolitische Debatte um die sogenannte »Armutsmigration«, um die Aktualität der fundamentalen und bislang einzigartigen Studie des Heidelberger Wissenschaftlers Frank Reuter vor Augen geführt zu bekommen. Glaubt man denjenigen, die diese Debatte immer wieder befeuern, sind es Sinti, Roma, Fahrende oder einfach »Zigeuner«, die vermeintlich massenhaft nach Deutschland einwandern, um in den Genuss der hiesigen Sozialleistungen zu kommen.
Dieses von konservativen, »christlichen« Politikern forcierte Bild ist Teil der Mär der »Überwanderung«, die die bundesdeutsche Debatte über Fragen der Einwanderung seit Monaten vergiftet und den Pegidisten den roten Teppich ausgerollt hat. Zu dieser Mär gehört auch das Bild der »Asylrekordzahlen«, die Monat für Monat vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vermeldet und vom Bundesinnenministerium verbreitet werden, obwohl sie weit von den tatsächlichen Rekordzahlen anno 1994 entfernt sind. Gemeinsam bilden sie das Panoptikum der sozialen Belastung durch Zuwanderung, das den kruden Scheinargumenten der Zuwanderungsgegner den Weg bereitet hat. Continue reading Fragwürdiger Armutsvoyeurismus: Das Bild des »Zigeuners«
Eine Geschichte der „Zigeuner“-Fotografie
[…] Um es gleich vorwegzunehmen: Frank Reuter hat eine hervorragende Studie zu Geschichte und Gegenwart der „Zigeuner“-Fotografie geschrieben. Der Autor, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg arbeitet, setzt sich mit seinem voluminösen Band (568 Seiten, 154 Abbildungen) zum Ziel, einen Überblick über die „fotografische Konstruktion des ‚Zigeuners’“ von den Anfängen bis in die Gegenwart zu geben. Er löst dieses Vorhaben auf exzellente Weise ein. Da es bis heute keine vergleichbare Forschungsarbeit, die die „Zigeuner“-Fotografie materialreich und fundiert in einem längeren historischen Zusammenhang verortet, wird das Buch gewiss bald zum Standardwerk avancieren.
Es gibt keine europäische Minderheit, die derart stark im Fokus der Fotografie stand und steht als die Roma und Sinti. Bereits wenige Jahre nach der öffentlichen Ankündigung des neuen fotografischen Verfahrens im Jahr 1839 entstanden die weltweit ersten „Zigeuner“-Fotografien. Sie wurden zwischen 1854 und 1856 vom österreichischen Militärapotheker und Fotografen Ludwig Angerer in Rumänien aufgenommen.[1] Um die Jahrhundertwende intensivierte sich die Begeisterung für „Zigeuner“-Motive noch einmal und erreichte um 1930 einen Höhepunkt. Seit dem späten 19. Jahrhundert sind die Bilder zum Thema auffallend zweigeteilt: Auf der einen Seite wurden die „Zigeuner“ (ein Terminus, der bis in die 1980er Jahre bedenkenlos verwendet wurde, ohne die pejorativen Zuschreibungen zu problematisieren) in fotografischen Bildern romantisiert, exotisiert, aber auch als außerhalb der bürgerlichen Zivilisation stehend abgewertet. Reuter: „Verlangen und Empörung, Faszination und Verachtung sind eng miteinander verzahnt.“ Auf der anderen Seite gerieten die „Zigeuner“ schon früh – spätestens in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts – in die Mühlen der staatlichen Repression. Die Bilder, die in diesem Kontext entstanden, zeigen die „Zigeuner“ als „gefährliche Elemente“ oder als prototypische Kriminelle. Im nationalsozialistischen Deutschland der 1930er Jahre schlug diese Repression in systematische Verfolgung und schließlich in den NS-Völkermord um. Die Bildbestände aus diesen Jahren umfassen rassenbiologische und -anthropologische Bildbestände ebenso wie Fotodokumente, die die Verfolgung und Deportation von Sinti und Roma in die NS-Konzentrations- und Vernichtungslager zeigen. Continue reading Eine Geschichte der „Zigeuner“-Fotografie
Compensation for victims of forced sterilization raised at OSCE event on Roma
Speaking at the Human Dimension Implementation Meeting in Warsaw on 1 October, two Romani civil society members raised the urgent issue of the Czech Government’s decision not to compensate the victims of forced sterilizations, human rights abuses that have taken place over the course of decades in the former Czechoslovakia and its successor states, the Czech Republic and Slovakia, including into the 21st century. Karolina Mirga of the Ternype network raised the issue as well as the continued presence of an industrial pig farm on the site of a former concentration camp for Roma at Lety in the Czech Republic.
Marek Szilvasi of ERRC dedicated his entire remarks to the issue of compensating the victims of forced sterilization, noting that the Czech Government’s rejection of the bill means that „hundreds of Romani women are going to remain without compensation for this human rights violation.“ Szilvasi urged both the Czech and Slovak Governments to immediately begin developing proper compensation schemes and the Czech Government especially to reconsider its decision.
Archived video of the session on 1 October 2016 is available here (remarks at 2:30). Today’s closing session is being broadcast live here.
On 30 September participants raised the issue of police brutality toward Roma and Sinti communities throughout the 57-state OSCE region. Speakers emphasized that negative stereotypes about Roma are widespread among law enforcement and lead to discrimination in policing.
„The police play an important role in ensuring the protection and promotion of human rights,“ said Mirjam Karoly, ODIHR Senior Advisor on Roma and Sinti Issues. „Therefore, investment in improving trust and confidence among the police and Roma and Sinti communities is crucial to combating racism and discrimination.“
Repressive police practices and a lack of effective investigation and prosecution of crimes against Roma create deep distrust among Roma and Sinti towards the criminal justice system in general. „Criminal cases against police representatives suspected of violence against Roma remain under investigation for very long periods of time, which blatantly violates the standards set by the European Court of Human Rights, related to the duty of the state authorities to conduct thorough and effective investigation within a reasonable time,“ said Oana Taba of the Romanian NGO Romani Criss.
„Investigations in such cases can be flawed, very often lacking the racial motivation of the perpetrator,“ Taba noted. Participants also discussed recent police operations targeting Roma and Sinti and their communities.
„The inhabitants of the concerned areas, mostly Roma, were intimidated and harassed by the practice of raid-like joint control activities in segregated Roma settlements by local government authorities in co-ordination with local police,“ said Szalayné Sándor, Deputy Commissioner for Fundamental Rights of Hungary. „These practices are incompatible with the principle of the rule of law and the requirement of legal certainty.“
Source: Romea.cz
Date: 02.10.2015
Kirchstettens Roma: Futschikato?
Das Wort „Futschikato“ ist mittlerweile aus dem Sprachgebrauch so verschwunden wie die Erinnerung daran, dass vor 80 Jahren mitten unter uns Roma und Sinti gelebt haben. In Kirchstetten, einer Marktgemeinde in Niederösterreich, waren es 80-100, die dann in die NS-Konzentrations- und Vernichtungslager eingeliefert wurden: “futschikato“. Die Kunstschaffende Marika Schmiedt wollte mit einer temporären Kunstinstallation in Kirchstetten an sie erinnern.
Auch der Wikipedia-Eintrag zu Kirchstetten weiß nichts über Roma und Sinti in Kirchstetten – sie sind „futschikato“, so auch der Titel der geplanten Kunstinstallation von Marika Schmiedt. Jetzt ist auch die temporäre Installation vermutlich „futschikato“, denn der Bürgermeister der Gemeinde Kirchstetten hat dem Projekt keine Genehmigung erteilt. Warum, das begründet er in einem Brief an die Künstlerin damit, dass das Zusammenleben mit Roma und Sinti, das ihm von älteren Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern berichtet wurde, „kein schlechtes war und alle miteinander gut ausgekommen sind“. Nach dieser entsetzlich verharmlosenden Anmerkung kommt aber gleich ein Satz, der verräterisch dokumentiert, dass das ‚Zusammenleben‘ doch anders war: „Es sind nun aber doch schon 70 Jahre seit diesen grauenvollen Jahren vergangen….“. Continue reading Kirchstettens Roma: Futschikato?