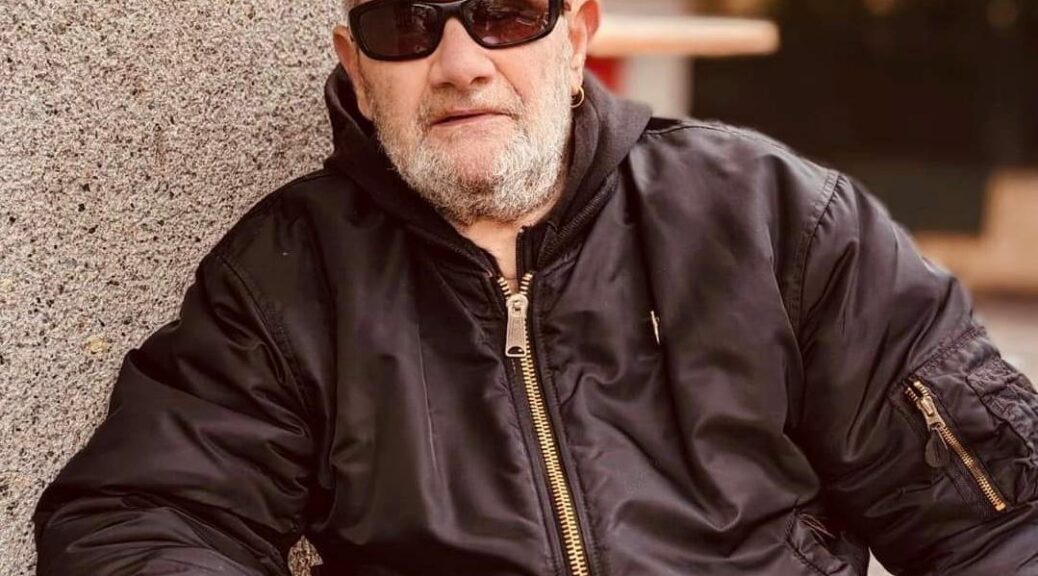Atanasio Bugliari Goggia
Morgen, am 14. März, erscheint bei ‘MachinaLibro’ der Band ‘Cronache marsigliesi – Einblicke in den Bürgerkrieg in Frankreich’, eine Textsammlung, der eine Reihe von Artikeln des verstorbenen Emilio Quadrelli über die französische Stadt zusammenfasst. Das Buch beschreibt die widersprüchliche Realität der Banlieues, die Konflikte der rassifizierten Subjekte, die Rolle der Frauen in den Kämpfen gegen Sexismus und Patriarchat und in der politischen Organisation territorialer Kollektive und zeigt, wie Marseille das fortschrittliche Labor des zeitgenössischen kapitalistischen Modells verkörpert.
Wir veröffentlichen heute einen Auszug aus dem Nachwort von Atanasio Bugliari Goggia.
Vorwort Machina
***
Sta nel mitra lucidato! Ciao Emilio!
(geschrieben für Emilio Quadrelli – mit dem Hammer- und Sichelsymbol – und am Tag nach seinem Tod in Genua erschienen, zitiert aus Ma chi ha detto che non c’è von Gianfranco Manfredi)
Acht Tage vor seinem Tod traf ich Emilio zum letzten Mal. Obwohl sein Zustand hoffnungslos war, behielt ich einen unerschütterlichen Optimismus, was seine Überlebenschancen anging, zum einen, weil ich mich nicht der Realität beugen wollte – auch wenn eine völlig materialistische Lesart jedes individuellen und kollektiven Lebensweges zu Emilios wesentlichen Lehren gehörte – und zum anderen, weil derjenige, der von klein auf nach der Devise „keinen Schritt zurück“ gehandelt hat, in den Augen derjenigen unsterblich erscheint, die aus seinen Taten gelernt haben, was es heißt, ein „Genosse“ zu sein. In den folgenden Tagen dachte ich lange über diesen letzten Besuch nach, und das Bild, mit dem Simone de Beauvoir ihren Abschied von dem an Leukämie erkrankten Frantz Fanon beschrieb, kam mir lebhaft in den Sinn: „Als ich seine fiebrige Hand drückte, schien ich die Leidenschaft zu berühren, die ihn verbrannte. Er übertrug sein Feuer auf uns“. Dieses Gespräch und die abschließende Umarmung mit Emilio vermittelten mir die gleichen Empfindungen. Emilios überwältigende politische und soziale Leidenschaft war in seinen letzten Lebensjahren völlig konzentriert in dem Bemühen, die Konturen des zeitgenössischen klassenpolitischen Labors neu zu definieren, um das Rätsel der Klassenzusammensetzung in der Epoche der Tendenz zum zwischenimperialistischen Krieg zu entschlüsseln, ein klarer Wille, die Konturen jener „Geographie des Hungers“ zu erfassen, unter anderem ging es dabei um eine Reaktualisierung des kämpferischen, politischen und militanten Fanon aus „Die Verdammten der Erde“ und „Politische Schriften“, gereinigt von jenen zahmen Interpretationen, die für eine bestimmte Kritik typisch sind, die mit der postmodernen Rhetorik vom Ende der Ideologien auf kultureller Ebene und dem Ende der Klassen auf wirtschaftlicher Ebene verbunden ist. Und gerade auf die neue Klassenzusammensetzung, auf die Beziehung zwischen der ‘farbigen Linie’ und der ‘heimatlosen (Arbeiter-)Arbeit’ und auf die zwischen dem Klassenbewusstsein des Proletariats und der Notwendigkeit einer langfristigen politischen Organisation geht die Marseiller Chronik in erster Linie ein. […]
Die Chroniken von Marseille sind nicht nur ein unverzichtbarer Entwurf für künftige militante Untersuchungen über den „Gesundheitszustand“ des westlichen Proletariats und die „Pläne“ des Kapitals, sondern stellen auch den Höhepunkt einer langen Reise dar, auf der Emilio sich mehrmals mit dem Thema der französischen Vorstädte auseinandergesetzt hat. Im Jahr 2007 erschien das Buch ‘Militanti politici di base. Banlieuesards e politica’ [1], eine kurze ethnografische Studie über die Pariser (und französischen) Unruhen im Herbst 2005, an denen Emilio zumindest als Zuschauer teilgenommen hatte. Für diejenigen, die wie ich seit einigen Jahren durch den schlechten ‘Gesundheitszustand’ der italienischen Bewegung entmutigt waren und die Ursachen in erster Linie darin sahen, dass in weiten Teilen eine solide klassenorientierte Perspektive der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen zugunsten von unwahrscheinlicher Perspektiven aufgegeben wurde, die sich auf Massen und immaterielle Arbeit konzentrierten, war dies ein Werk, das auf militanter Ebene die Züge einer echten kopernikanischen Revolution annahm.
Die Arbeiterklasse existierte, man musste nur in die Unterwelt der Produktion hinabsteigen und sie mit „einem bestimmten Blick“ suchen. Gerade indem ich dieses und andere Werke von Emilio [2] mit ‘der Chronik’ in Beziehung setze, werde ich versuchen, einige seiner Erkenntnisse, unter vielen möglichen, zum Thema Banlieue herauszuarbeiten. Dies alles im Anschluss an eine erste Überlegung: Die ‘Pariser Untersuchung’ von 2006 erweist sich als eine „Geschichte der Zukunft“, da Emilio in nuce einige wesentliche Passagen der Dialektik zwischen dem Kapital und der „Schurkenklasse“ erfasst, die sich einige Jahre später in ihrer ganzen Boshaftigkeit in Form von Disziplinierung, Ausgrenzung, Marginalisierung und Abrutschen unserer Klasse materialisieren sollte; ‘Die Chroniken’ hingegen fassen eine „Geschichte der Gegenwart“ zusammen, denn die Widersprüche des Kapitalismus und die „Positionierung der Klasse“, die Emilio im Voraus erkannt hat, sind heute, in der Zeit der – zyklischen oder unumkehrbaren – Krise und der Tendenz zum Krieg, in jedem Winkel des Westens Realität geworden.
In diesem Sinne macht Emilio mit der Chronik einen weiteren Schritt: Er skizziert nicht nur die Merkmale des neuen Großstadtproletariats, d.h. die Klassenzusammensetzung nicht in ihrer soziologischen Abstraktheit, sondern in ihrer politischen Konkretheit, sondern versucht auch, die Konturen einer möglichen politischen Projektualität für die Subalternen nachzuzeichnen, da „der Hunger der Massen nach Politik“ dringend Organisations- und Selbstorganisationsformen benötigt, die in der Lage sind, eine Weltsicht und die Ausübung von Gewalt zu konstruieren, d.h. die historische Zeit zu erfassen und mit ihr Schritt zu halten. Eine Analyse- und Vorhersagefähigkeit, die nicht von einer göttlichen Gabe herrührt, sondern von Emilios Bekenntnis zu jener leninistischen Lehre, die dazu verpflichtet, ständig am Rande der Zeit zu bleiben, um die neue Welt und damit die sich herausbildende Klassensubjektivität zu interpretieren. In dieser Perspektive bleibt Emilio stets der operaistischen Methode verhaftet, einer Praxis der kämpferischen Untersuchung, die er unermüdlich in einem neuen Kontext zu verorten versucht, um das „Wehklagen der Unterdrückten“ in den Banlieues als Paradigma einer wirtschaftlichen, sozialen und existenziellen Bedingung zu begreifen, die das Leben und das Schicksal der subalternen Massen im gesamten Westen widerspiegelt. Darüber hinaus war Maos berühmter Satz ‘Nur wer forscht, hat das Recht zu sprechen’, den Emilio immer wieder gerne wiederholte, das Markenzeichen seiner politischen und existenziellen Sphäre und ein unverzichtbarer intellektueller Kompass.
[…]
Es ist wichtig, an Emilios Affinität zur illegalen Welt zu erinnern, die es ihm ermöglichte, die Veränderungen der Arbeitswelt und damit das Hier und Jetzt der Klasse zu erfassen: In Zeiten der globalen Krise wird es für das Großstadtproletariat zur Normalität, zwischen Gelegenheitsjobs, prekären und flexiblen Jobs mit geringem Profil und den ständigen Ausflügen in die illegale Wirtschaft zu pendeln. Dies ist keine Anomalie, sondern das Modell, mit dem das Kapital die Arbeitskraft beherrscht. Emilio war im Übrigen der einzige Wissenschaftler, der in der Lage war, die émeutes des Jahres 2005 zu kartografieren, indem er sie in einen engen Zusammenhang mit den Aktivitäten der kriminellen Kreise stellte und aufzeigte, wie der soziale Frieden in Städten und Stadtvierteln herrschte, in denen das organisierte Verbrechen eine nicht gerade zweitrangige Macht hatte. In ‘den Chroniken’ hebt er hervor, dass zumindest in Marseille die Kontrolle und die Erpressung, die die kriminellen Organisationen über die Bevölkerung der Viertel ausüben konnten, verschwunden sind – „nicht unähnlich derjenigen, die der Chef über die prekär Beschäftigten ausübt“.
Wie schon erwähnt, liest er in „Militanti politici di base“ die Unruhen von 2005 als eine Geschichte der Zukunft, indem er zunächst, gestützt auf die Aussagen von Bewohnern und/oder Militanten der Pariser Banlieues, den politischen Hintergrund des Lebens dieses großen Teils der Arbeiterklasse aufzeigt und im Wesentlichen deutlich macht, wie sich die Bewohner dieser Gebiete gegen das Modell der Sozialverwaltung und der Arbeitsorganisation auflehnen. In der ‘Pariser Untersuchung’ wurde die Idee dargelegt, dass die Entstehung neuer Arbeitsbedingungen in den Banlieues einen Versuch des Kapitals darstellte, vor Ort ein Modell zu erproben, das auf völlig prekären und ungeschützten Arbeitsformen und auf extremen Formen der sozialen Kontrolle beruht. Ein Paradigma, das es seinerzeit weltweit durchsetzen wollte. Die Banlieue war also kein Beispiel für die Racaille, das Lumpenproletariat, sondern vielmehr die Summe der Widersprüche des zeitgenössischen Produktionsmodells, das dessen Folgen für nicht unwesentliche Teile der Bevölkerung vorwegnahm und vorwegnahm. Emilio machte so aus dem gesamten Kulturalismus eine Tabula rasa, indem er hervorhob, wie analytische Kategorien, die behaupteten, der Vergangenheit angehören zu müssen, stattdessen den begrifflichen und analytischen Rahmen darstellten, um die Merkmale der Gegenwärtigkeit zu erfassen, die ideologische Hülle, durch die man versuchte, einen rein materiellen Konflikt zu interpretieren.
Der Lauf der Jahre scheint ihm Recht zu geben, und in diesem Sinne wiederholte er oft, dass „Fakten einen harten Kopf haben“. Diese frühen Werke über die Banlieue – die Emilio immer wieder mit Kampfphasen aus der Vergangenheit in Verbindung bringt: von der Arbeiterautonomie bis zum algerischen Befreiungskampf, von der russischen bis zur chinesischen Revolution – setzen sich mit den Veränderungen des kapitalistischen Systems und den Umwälzungen auseinander, die den Hintergrund des proletarischen Lebens bilden. Ausgehend von einer präzisen Tatsache: Im Zeitalter des Liberalismus bleiben die Produktion von materiellen Gütern und die Höhe des Mehrwerts, der aus ihnen herausgeholt werden kann, zentral. Die Unruhen in den Banlieues sind kein Beispiel für eine Verzweiflungstat, die aus sozialer Degradierung und Unwohlsein geboren wurde, sondern sie enthalten den reinsten Keim des Klassenbewusstseins. Die ‘Chroniken von Marseille’, das Ergebnis eines einmonatigen Aufenthalts in der Stadt des Mistral, wurden zwischen Anfang April und Mitte Juli 2023 geschrieben, auf dem Höhepunkt der französischen Proteste gegen das vorgeschlagene Gesetz zur Verlängerung des Erwerbsalters, und berühren im Schlussteil die émeutes von 2023. Anhand von „Lebensgeschichten“ und ausführlichen Interviews untersuchte Emilio zwei Realitäten: das Collectif Boxe Marseille, das sich sowohl sportlich als auch gewerkschaftlich und politisch in der Koordination der Kollektive der nördlichen Viertel engagiert, und das Collectif Autonome Précaires et Chȏmeurs Marseille.
Der erste Teil besteht fast ausschließlich aus Interviewauszügen, wobei die Interaktion des Autors minimal ist, gemäß der Hypothese, dass die empirische Wiederherstellung der sozialen Akteure von grundlegender Bedeutung ist, abgesehen davon, dass sie die Autoren des Textes sind, gemäß dem Prinzip, dass „das Phänomen immer reicher ist als das Gesetz“. In den letzten beiden Teilen befasst sich das Werk auch mit den Unruhen, die Frankreich nach der Hinrichtung des jungen Nahel in Nanterre durch die Polizei erschütterten, und geht dabei erneut auf die Klassenzusammensetzung und das soziale Profil dieser neuen Arbeiterklasse der Vorstädte ein, die in den Strudel der neuen kapitalistischen Produktionsparadigmen, die die heutige Welt kennzeichnen, und der Prozesse der Disziplinierung und der sozialen Kontrolle geraten ist, die teilweise angepasst wurden, um die sozialen Auswirkungen einer hoffnungslosen Wirtschaftskrise einzudämmen und gleichzeitig eine Arbeitskraft zu schaffen, die auf die Anforderungen des Zeitalters der Krise vorbereitet ist. In diesem Sinne verkörpert Marseille das fortschrittliche Labor des zeitgenössischen kapitalistischen Modells.
Während Emilio in seinen ‘Überlegungen zur Banlieue’ auf zweifellos originelle Weise – gestützt auf das Instrumentarium des italienischen Operaismus und des leninistischen Denkens sowie auf die Methode der militanten Untersuchung (und zuweilen auf die mündliche Überlieferung nach dem Vorbild von Revelli, Bermani und Portelli) – versuchte, den aktuellen „Plan des Kapitals“ zu skizzieren, konzentrierte er sich in ‘den Chroniken’, wie bereits erwähnt, mehr auf die Subjektivität der Klasse und versuchte, die Möglichkeiten der politischen Organisation dieses „heimatlosen Arbeiters“ zu umreißen: „von der Partei der Mirafiori zur Partei der Banlieue“, oder besser gesagt, von der historischen Partei zur formalen Partei. Ein theoretischer Übergang, der in einem Kontext der Proletarisierung der Massen und einer Tendenz zum zwischenimperialistischen Krieg, der den kapitalistischen Akkumulationszyklus wieder in Gang setzen soll, nicht länger aufgeschoben werden kann.
Der Krieg als Instrument, das durch eine gewaltige Zerstörung von konstantem und variablem Kapital die Wiedergeburt und den Aufschwung des Kapitalismus ermöglicht. Emilios Bestreben, mögliche Szenarien des Klassenkampfes und der Organisation aufzuzeigen – ein ständiges Thema in seiner Produktion über die Banlieue, die in diesem Sinne als Paradigma einer sozialen und existenziellen Bedingung verstanden wird, die nicht allein der französischen Welt zugeschrieben werden kann -, kommt in seinen späteren Werken besonders zur Geltung, und in diesem Sinne sollte ‘die Chronik’ von der Lektüre der Bücher ‘L’altro bolscevismo’ und ‘Le problème n’est pas la chute mais l’atterrissage’ [3] begleitet werden, die verdeutlichen, dass der Standpunkt der Klasse in dieser historischen Phase viel weiter fortgeschritten ist als ihre Organisation, auch aufgrund der Tatsache, dass nicht nur die Erinnerung an die Kämpfe und die Aufteilung der Gesellschaft in Klassen aus dem zeitgenössischen Horizont zu verschwinden scheint, sondern auch die Legitimität der gesichtslosen Massen und ihrer Handlungsrepertoires. Die herrschende Ideologie scheint die Idee des Konflikts als legitimes Mittel des sozialen Wandels auszulöschen und alles auf das klassische Thema der gefährlichen Klassen zurückzuführen, ein Paradigma der Macht, das Opfer zu Tätern macht.
Der hier vorgelegte Text ist besonders wertvoll, weil er von jenen Militanten an der Basis spricht, die ständig versuchen, das Proletariat der Banlieues zu organisieren. Es handelt sich ganz allgemein um jene organisierten Gruppen, die unermüdlich daran arbeiten, das politische Bewusstsein jener „petits protagonistes“ der Aufstände zu formen, die, während sie nach politischer, organisatorischer und programmatischer Einheit streben, versuchen, die „émeutiers“ und potenziellen „émeutiers“ auf ihre Seite zu ziehen und sie in eine umfassende politische Militanz einzubinden. Denn wir müssen uns immer vor Augen halten, dass in den Banlieues das neue Proletariat lebt, „die am weitesten fortgeschrittene Frucht des kapitalistischen Modells, sicherlich kein Überbleibsel der Vergangenheit“. Es handelt sich um einen Prozess der Bewusstseinsbildung der Jugend der Vorstädte, der „Erziehung“ zur kollektiven Aktion, der Weitergabe des Gedächtnisses der Kämpfe, Prozesse, die unabdingbar sind, um die Wut der ‘Petits’ – das Klassenbewusstsein – in politisches Bewusstsein zu verwandeln, damit ein langfristiges Engagement mit der Revolte Hand in Hand gehen kann. Um mögliche Wege der Organisation und des Kampfes dieses Proletariats zu entwerfen, ist es zunächst notwendig, es von all der kulturalistischen Rhetorik und den diskursiven Ordnungen zu emanzipieren, die auf es niedergegangen sind.
In diesem Sinne sind die Chroniken von unschätzbarem Wert, denn die Akteure, die sich zu Wort melden, sind Angehörige jener Klasse, die sich ständig zwischen Prekarität, Arbeitslosigkeit, halber Legalität und totaler Illegalität bewegt und die den gegenwärtigen kapitalistischen Akkumulationszyklus zunehmend kennzeichnet. Eine Arbeiterklasse und proletarische Masse, der die Arbeitsbeziehungen des 20. Jahrhunderts völlig fremd ist und deren Zustand in vielerlei Hinsicht sogar Züge und Merkmale des 19. Jahrhunderts aufweist. Eine gesichtslose Masse der Vorstädte, die wenig mit dem zu tun hat, was sich außerhalb dieser Gebiete oder vielmehr dieser Klassenzugehörigkeit befindet: die „weißen“ Bewegungen der Stadt, die linken und linksextremen politischen Parteien, die immer durch Spaltung und Kooptation agiert haben, ein gewisser Banlieue-Assoziationismus mit dem Ziel der Klassenkontrolle, die garantierten Klassensektoren, die gegen die Rentenreform gekämpft haben, die Erfahrung der Gilets Jaunes, „eine große Bewegung des Volkes, aber nicht der Klasse“. Eine neue Klassenzusammensetzung, die sich in Anlehnung an die Lehren Lenins um eine Ideenkraft organisieren muss, auf der eine neue Hypothese der Macht aufgebaut werden kann.
Der Standpunkt der Arbeiter, sagt Emilio, muss wieder zum Kompass für die Ausarbeitung einer Organisationstaktik werden. Von der Klasse zur Partei und nicht andersherum. Von der Unterwelt der Fabrik und nicht vom Himmel der Ideen. Es geht um die Notwendigkeit der Hegemonie der fortschrittlichsten Fraktion des Proletariats, die durch ihre Linie „in der Praxis die Zeiten und Rhythmen des Klassenkampfes durchsetzt“. In diesem Sinne wird die Banlieue zum politischen Laboratorium der zeitgenössischen Klasse: „Der objektive Zustand der Ausgrenzung und Marginalität der Bevölkerungen, die im Kontext der Banlieues leben, d.h. in den Randgebieten der globalen Metropolen, präfiguriert das Schicksal eines großen Teils der zeitgenössischen subalternen sozialen Klassen und repräsentiert somit die Geschichte unserer Gegenwart. Mit anderen Worten, die Banlieue ist die exakte Kristallisation der gegenwärtigen proletarischen Bedingung, einer Bedingung, die das Ergebnis jener Praktiken der kolonialen Herrschaft ist, die das strategische Projekt par excellence des gegenwärtigen kapitalistischen Kommandos darstellen. Aus dieser Perspektive sind die Banlieues also unsere Putilow-Werke“ [4].
[1] E. Quadrelli, Militanti politici di base. Banlieuesards e politica, in M.Callari Galli, a cura di, Mappe urbane. Per un’etnografia della città, Guaraldi, Rimini 2007.
(Auszugsweise auf deutsch https://bonustracks.blackblogs.org/2024/07/21/politische-militante-an-der-basis-die-banlieusards-und-die-politik-2005/)
[2] Ich verweise insbesondere auf: Algerien 1962-2012: eine Geschichte der Gegenwart. Dalla guerra di liberazione alla „guerra asimmetrica“, La casa Usher, Florenz 2012.
Siehe auch: Black, blanc, beur. Lotta e resistenza nelle periferie globali, «Infoxoa», n. 020, Roma 2006 e Burn baby burn. Guerra e politica dei banlieuesards, «Wobbly», n. 10, Genova 2006.
[3] E. Quadrelli, L’altro bolscevismo. Lenin, l’uomo di Kamo, DeriveApprodi, Bologna 2024 und Id., Le problème n’est pas la chute mais l’atterrissage. Lotte e organizzazione dei dannati di Marsiglia, «Carmilla online», 1-4 (26. marzo 2023-22.aprile 2023).
(Auszugsweise auf deutsch https://bonustracks.blackblogs.org/2023/04/04/die-chroniken-von-marseille-es-ist-nicht-alles-gold-was-glaenzt/ )
[4] E. Quadrelli, L’altro bolscevismo (Der andere Bolschewismus,) a.a.O., S. 188.
Dieser Beitrag wurde am 13. März 2025 auf Machina veröffentlicht und von Bonustracks ins Deutsche übersetzt.