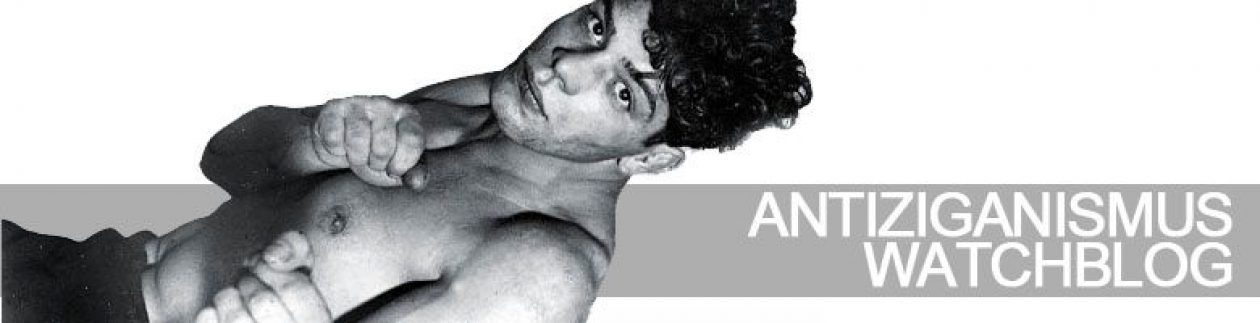Antiziganismus hat eine lange europäische Tradition. Gleichzeitig steht die Erforschung dieses Phänomens und seine Auswirkungen noch in den Anfängen. Auch der Begriff selber ist noch recht unbekannt.
Das Seminar soll in die Geschichte der Beziehungen zwischen sogenannten „Zigeunern“ und nicht-„Zigeunern“ einführen. Anhand konkreter Beispiele möchten wir uns mit der gegenwärtigen Situation von Roma, Sinti und anderen Gruppen beschäftigen. Auf einer eher theoretischen Ebene wollen wir mit dem Antiziganismus Begriff den Blick auf die Vorurteile, Stereotype und Motive der Mehrheitsgesellschaft richten. Auch die Anknüpfungspunkte zu und Abgrenzungen von andern Ausgrenzungsformen sollen eine Rolle spielen.
Im Anschluss wollen wir gemeinsam erarbeiten, was jeder und jede praktisch tun kann. Denn es geht auch anders.
Wochenendseminar: Samstag 20. Okt 2012 und Sonntag 21. Okt, jeweils 10 – 15 Uhr
Förderung: Landeszentrale für politische Bildung Hamburg
Veranstalter: Miteinander Organisiert Bilden (Mobi e.V.), Rosa Luxemburg Stiftung HH
Anmeldung erforderlich: [email protected]
Ort: W3, Seminarraum 1. OG, Hamburg
Eintritt: frei
Category Archives: Geschichte des Antiziganismus
Porrajmos: Remembering Dark Times
At the commemoration ceremony for the Romani victims of the Holocaust in Budapest yesterday, Rita Izsák, United Nations Independent Expert on minority issues, herself of Hungarian Roma origin, reminded those in attendance that it was three years ago to the day since Maria Balogh was murdered in her bed, and her 13-year-old daughter seriously wounded, in a gun attack by neo-Nazis in the village of Kisléta. Izsák called on states to do more to challenge “a rising tide of hostility and discrimination against Roma in Europe that shames societies.”
This theme was echoed in commemorations right across Europe paying tribute to victims such as Maria Settele Steinbach. The haunting image of nine-year-old Settele, as she peered out of the cattle car of a train bound for Aushwitz-Birkenau, moments before the doors were locked and bolted, was captured on film in May 1944. This became one of the most reproduced, tragic iconic images of the Holocaust. For decades, Settele was described in the literature as the unnamed Jewish girl in a headscarf. Continue reading Porrajmos: Remembering Dark Times
“Zick zack Zigeunerpack” – Rassismus gegen Sinti und Roma heute
Heute jährt sich der Gedenktag für die ermordeten Sinti und Roma. Während Sie diesen Text lesen, besucht eine 70-köpfige Delegation des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma mit den noch wenigen Holocaust-Überlebenden das ehemalige Lager Auschwitz-Birkenau.
Sie gedenken am der Opfer des systematischen und rassistisch motivierten Völkermords an den Sinti und Roma. In Auschwitz-Birkenau sind ganze Familien der Sinti und Roma separiert von anderen KZ-Häftlingen interniert worden. Das Lager sollte am 15. Mai 1944 komplett aufgelöst und die noch verbliebenen Familien ermordet werden. Die Inhaftierten weigerten sich jedoch, aus ihren Baracken herauszukommen. Denn in ihren Reihen befanden sich Sinti und Roma, die in der Wehrmacht gedient hatten und den Plan durchschauten. Verunsichert von der Situation, unterbrachen die SS-Männer ihr Mordvorhaben. Stattdessen entschied sich die Lagerleitung für eine schrittweise Auflösung. Zunächst wurden die ehemaligen Wehrmachtsangehörigen nach und nach in andere Lager deportiert. Die verbliebenen Menschen wurden in der Nacht vom 2. August zur Ermordung in die Gaskammer getrieben. Daher hat dieser Tag den Status eines Gedenktages. Continue reading “Zick zack Zigeunerpack” – Rassismus gegen Sinti und Roma heute
Schweinefarm blockiert Mahnmal für Sinti und Roma
Premier Necas erklärt kurz vor dem Gedenktag für ermordete Sinti und Roma, man habe kein Geld für ein Mahnmal. Dass Tschechen ein Konzentrationslager in Lety betrieben, ist bis heute ein Tabu.
Sie hatten nichts anderes erwartet, die wenigen politisch engagierten Roma in Tschechien. Dennoch hinterlässt die Absage von Premier Petr Necas so kurz vor dem 2. August bei ihnen Bitterkeit. Jenes Datum bleibt für das Minderheitenvolk in ganz Europa unauslöschlich. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden in Auschwitz die letzten 2900 Sinti und Roma, die bis dahin überlebt hatten, in die Gaskammern getrieben. Insgesamt ermordeten die Nationalsozialisten vermutlich eine halbe Million von ihnen.
Kurz vor diesem furchtbaren Jahrestag nun verkündete Necas, dass es auch unter seiner bürgerlichen Regierung keine Lösung für ein würdiges Gedenken an das Schicksal der Inhaftierten im früheren Roma-Konzentrationslager in Lety geben wird. Continue reading Schweinefarm blockiert Mahnmal für Sinti und Roma
Sie wollten nicht kampflos sterben
GEDENKEN
Über den Widerstand deutscher Sinti und Roma gegen den Naziterror ist noch wenig bekannt. Romani Rose erinnerte zum 20. Juli an den Aufstand im „Zigeunerlager“ Auschwitz-BirkenauDer Widerstand gegen die Nazis wurde in der deutschen Nachkriegsgesellschaft lange beschwiegen. Auch der Widerstand von Sinti und Roma. „Viele von uns kannten die Aufstände von Sobibor und Treblinka“, sagte am Donnerstag Johannes Tuchel, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Der bewaffnete Aufstand vom 16. Mai 1944 im „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau aber sei in Vergessenheit geraten. Deswegen hat die Gedenkstätte Deutscher Widerstand den Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, eingeladen, anlässlich des 68. Jahrestags des Umsturzversuchs vom 20.
Juli 1944 über den Widerstand von Sinti und Roma zu sprechen. Rund 120 Interessierte sind in die St.-Matthäus-Kirche gekommen.„Von Anfang an haben Sinti und Roma versucht, sich gegen Entrechtung und Ausgrenzung zur Wehr zu setzen“, sagt Rose. „Sie konnten nicht begreifen, dass sie von Bürgerrechten ausgeschlossen waren.“ 36.000 „Rassegutachten“ der Rassenhygienischen Forschungsstelle bildeten die Grundlage für die systematische Ermordung von Sinti und Roma. Die Kirchen überließen die Daten und Stammbäume ihrer Mitglieder bereitwillig den Nazis. „Selbst sogenannte Achtelzigeuner wurden erfasst.“ Rose zitiert aus Dokumenten, die die Verweigerung der Erfassung belegen, das Aufbegehren gegen Schulverbot und Zwangssterilisation, Fluchthilfe, das Leben im Untergrund. „In diesen Zeugnissen spiegelt sich die systematische Ausgrenzung von uns aus nahezu allen Bereichen“, sagt Rose.
Mit den Nürnberger Gesetzen wurde auch Sinti und Roma die Heirat mit von den Nazis als arisch Eingestuften untersagt. Christine Lehmann, deren Familie 1940 nach Polen deportiert worden war, lebte mit einem „arischen“ Deutschen zusammen. Sie wurde verhaftet, tauchte unter, wurde wieder verhaftet. Die Nazis ermordeten sie und ihre Kinder in Auschwitz.
Im Zweiten Weltkrieg intensivierten die Nazis ihre Mordpolitik. Tausende wurden zur Zwangsarbeit nach Polen verschleppt. Nur wenige konnten fliehen. Zeitgleich machten Einsatzkommandos in der Sowjetunion Jagd auf Sinti und Roma: „Ganze Viertel wurden so ausgelöscht.“
Über den bewaffneten Widerstand von Sinti und Roma – in der Résistance, bei den Partisanen, in der Roten Armee – ist wenig bekannt. Der Aufstand im sogenannten Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau aber ist gut belegt. Rose bezeichnet ihn als „Höhepunkt“ des Widerstands. 23.000 Sinti und Roma waren in das Lager deportiert worden. Ein SS-Mann hatte verraten,
dass die Liquidierung des Lagers bevorstand. Und als am 16. Mai 1944 die SS anrückte, waren die Häftlinge – viele von ihnen ehemalige Soldaten mit Fronterfahrung – vorbereitet. Sie warteten in ihren verriegelten Baracken, bewaffnet mit Schaufeln, Stöcken und selbst geschliffenen Messern. „Ich selbst besaß ein Messer. Wir wollten nicht kampflos in die Gaskammer gehen“, heißt es im Bericht des Aufständischen Willi Ernst.Es geschah das Unglaubliche: Die SS brach, wohl aus Angst vor eigenen Verlusten, die Aktion ab. Bis heute ist dies für die überlebenden Sinti und Roma bedeutend. „Sie gingen nicht wie die Schafe zur Schlachtbank“, sagt Romani Rose.
Immer wieder an diese vergessene Episode des Widerstands zu erinnern, ist besonders wichtig. Schließlich dauerte es Jahrzehnte, bis Deutschland den NS-Völkermord an einer halben Million Sinti und Roma überhaupt anerkannte.
Quelle: TAZ
Stand: 30.07.2012
Als Sinti am Deutschen Eck
Der Filmtitel ist zweisprachig, aber die O-Töne fast nur deutsch – bis auf die Lieder, die auf Romanes gesungen werden. Die besingen keine Lagerfeuerromantik: Eine Frau verlässt in einem Lied ihren Mann und die Kinder.–
Von Gaston Kirsche
Bawo Reinhardt singt in „Illusionen“: „Sie haben uns verfolgt, sie haben uns eingesperrt“. Seine Tochter Heidi sitzt im Publikum und kann dabei nur schwer die Tränen halten, während sie gefilmt wird. Ihr Vater hat seine ersten Lebensjahre in KZ verbringen müssen, die Deutschen haben ihn zusammen mit den Eltern eingesperrt. Zuletzt war er in Auschwitz. Je älter er wird, desto mehr kommt die Erinnerung daran aus dem Unterbewusstsein hoch. Täglich muss er Tabletten nehmen und in kleinen Räumen hält er es nicht aus. Bawo Reinhardt sitzt, als er dies den Filmleuten schildert, auf einem Ausflugsboot, dass das „deutsche Eck“ ansteuert, am malerischen Rheinufer voller Weinberge. Ein Kontrast, durch den die Kamera das zusammenbringt, was zusammengehört und so schwer auszuhalten ist: deutsche Gemütlichkeit und die Vernichtungslager, die KZ.
Newo Ziro porträtiert drei Sinti, die in Koblenz leben: Bawo Reinhardt, den Opa, seine Enkelin Sibel Mercan, ihren Onkel und Bawos Sohn Lulo Reinhardt. Alle drei wirken mit beim jährlichen Musikfestival „Djangos Erben“, dass bei der Siedlung „Unterer Asterstein“ stattfindet – dort, wo die meisten Sinti leben, am Stadtrand. Deutsche sagen oft, dort leben „die Asozialen“, ohne uns zu kennen, erklärt eine junge Frau. Vom „sozialen Brennpunkt“ heißt die Siedlung einfacher, mehrgeschossiger Mietshäuser oft auch, oder Ghetto. Aber ein Ghetto ist es nicht, erklärt Bawo Reinhardt, es ist weder eingezäunt noch abgesperrt. Ohne es zu sagen ist klar, aus welcher Zeit seine Definition kommt.
Dabei haben sie einen Fußballverein, grillen am Wochenende, für die Kinder gibt es im Sommer ein Planschbecken. Die Eltern ermahnen die Kinder, das Wasser im Planschbecken zu lassen. Alltag. Continue reading Als Sinti am Deutschen Eck
»Das Denkmal bedeutet ein großes Stück Verantwortung«
Der israelische Künstler und Bildhauer Dani Karavan hofft, dass das von ihm entworfene Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma noch in diesem Jahr fertiggestellt wird, und kritisiert die schleppende Zusammenarbeit mit dem Bauministerium in Berlin.
1992 beschloss die Bundesregierung den Bau eines nationalen Denkmals in Erinnerung an die Ermordung der europäischen Sinti und Roma. Das Denkmal des israelischen Künstlers Dani Karavan soll im Tiergarten errichtet werden und besteht aus einem Brunnen mit einer versenkbaren Stele, auf der täglich eine frische Blume liegt. Es wird durch Texttafeln ergänzt, die über Ausgrenzung und Massenmord an den Sinti und Roman während des Nationalsozialismus informieren.
Dani Karavan, 1930 in Tel Aviv geboren, realisierte weltweit zahlreiche spektakuläre Kunstwerke, die der Land Art zugerechnet werden, darunter die Straße der Menschenrechte als Kunst am Bau des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Continue reading »Das Denkmal bedeutet ein großes Stück Verantwortung«
16. Mai 1944: Aufstand im Zigeunerlager
Am 16. Mai 1944 erblickt im sogenannten Zigeunerlager von Auschwitz Birkenau ein Kind das Licht der Welt: Edmund Weiss. Auch am Tag zuvor wird dort ein Junge geboren: Oskar Broschinski. Doch die beiden Jungen haben keine Überlebenschance. Mager, klein, untergewichtig – sie bräuchten besondere Fürsorge, aber im „Zigeunerlager“ gibt es kaum Nahrung für sie: Ihre Mütter sind selbst halb verhungert und dem Tode nahe. Es ist, wie für alle Neugeborenen im Zigeunerlager, eine Frage von Stunden, Tagen, höchstens Wochen bis zu ihrem Tod. Continue reading 16. Mai 1944: Aufstand im Zigeunerlager
Post navigation ← Previous Next → Film: Willkommen Zuhause; Ein Dokumentarfilm von Eliza Petkova
Mi, 30. Mai 2012, 19 h Landesmedienzentrum Rotenbergstraße 111 Stuttgart-Ost
Die AnStifter in der DenkMacherei Werastraße 10 D 70182 Stuttgart Bei dem Staffeln
Willkommen Zuhause
Sinti und Roma wurden und werden lebenslang verfolgt.
Das Romanes-Wort Porajmos (auch Porrajmos, deutsch: „das Verschlingen“) bezeichnet den Völkermord an den europäischen Roma in der NS-Zeit und ist Höhepunkt einer langen Geschichte von Diskriminierung und Verfolgung. Die Zahl der Opfer ist nicht bekannt. Nach unterschiedlichen Schätzungen ist sie bei einer großen Spannbreite jedoch sechsstellig.
Aktuell, mitten in Europa, werden auch heute noch Roma verfolgt, gedemütigt, verletzt, vertrieben, diskriminiert, nicht zuletzt auch von Behörden. Im Frankreich des Sarkosy, in Italien leben sie in Isolation, Unsicherheit und Angst vor Abschiebung, in Ungarn, Rumänien, Tschechien und im Kosovo fehlt ihnen der Schutz der Behörden und der demokratischen Öffentlichkeit.
Aktuell, im März 2012 beschloss der Stuttgarter Landtag die Wiederaufnahme der Abschiebungen von Roma in den Kosovo – denn dort gäbe es keine Diskriminierung von Roma – und somit auch keine Abschiebehindernisse.
Aktuell, heute also, können Menschen in Baden-Württemberg nicht mehr ruhig schlafen, weil sie Angst haben, abgeschoben zu werden, weil sie wissen, daß es im Kosovo keinen Schutz vor rassistischen Übergriffen, vor Verfolgung gibt.
Willkommen Zuhause zeigt, wie „abgeschobene“ Roma im Kosovo leben, wie verunsichert jene sind, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind – und wie sie jetzt, in der neuen Fremde, in Verzweiflung leben…
Willkommen Zuhause von Eliza Petkova (Buch und Regie) Anschließend Gespräch
Eintritt frei – Unkostenbeitrag erwünscht Bitte weitersagen / weitergeben / posten www.die-anstifter.de www.cinemanda.com ViSdP: Peter Grohmann, [email protected]
Quelle: die AnStifter
Stand: 14.05.2012
Ausstellung erinnert an Leiden der Sinti und Roma während der NS-Zeit
Moringen. „Aus Niedersachsen nach Auschwitz – die Verfolgung der Sinti und Roma in der NS-Zeit“ – unter diesem Motto ist im Mai in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Moringen eine Wanderausstellung zu sehen, die über das Schicksal der 27 Sinti- und Romajungen informiert, die im Jugend-KZ Moringen inhaftiert waren.
Wie die anderen Häftlinge waren sie hier völlig entrechtet dem Terror der SS ausgesetzt und mussten bei unzureichender Ernährung und mangelnder Hygiene mehr als zehnstündige tägliche Arbeitseinsätze leisten.
Am 24. März 1943 wurden 21 von ihnen nach Auschwitz deportiert. Die waren im Lager gestorben oder später deportiert worden. Die Ausstellung wurde im Rahmen eines Kooperationsprojektes der KGS und der KZ-Gedenkstätte organisiert.
Die Eröffnungsveranstaltung, die am Donnerstag, 3. Mai, stattfindet und um 15 Uhr in der Mensa der KGS beginnt, soll zugleich erstmalig eine Gedenkveranstaltung für die aus Moringen deportierten Sinti und Roma sein. An diesem Tag ist die Ausstellung öffentlich zu sehen. Weitere Besichtigungen sind bis zum 12. Mai nach Anmeldung möglich. Die Führung durch die Ausstellung übernehmen dann Schüler der zwölften Jahrgangsstufe.
Quelle: HNA
Stand: 26.04.2012