„Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen“
– Max Horkheimer
Seit einiger Zeit erleben wir einen globalen Rechtsruck. Die neoliberale Weltordnung bröckelt. Von Rechts wird meist ein völkischer autoritärer Kapitalismus als „Alternative“ dargeboten. Das Wiedererstarken von Rechtspopulist*innen und Neonazis in Deutschland und Europa, die Begeisterung für Erdogan, Putin und Trump, die Wahl Bolsonaros in Brasilien, das Auftreten islamistischer Bewegungen oder der Erfolg der Hindu-Nationalist*innen in Indien sind dafür nur einige Beispiele. Eingesessene autoritäre Regime halten sich hartnäckig durch Repressionen, aber auch durch relative Zustimmung in der Bevölkerung. Aktuell gelten nur 60% der Staaten als demokratisch. Doch wieso sind autoritäre Bewegungen auch im 21. Jahrhundert weltweit noch immer so erfolgreich? Aus welchen gesellschaftlichen Grundbedingungen erwachsen sie?

Autoritäre Ideologien
Was die sehr verschiedenen autoritären Bewegungen eint sind starke ideologische Ähnlichkeiten. So wird meist eine Gemeinschaft konstruiert, die sich auf nationale oder religiöse Identitäten bezieht. Diese sei stark, relativ einheitlich und zeichne sich durch gemeinsame Interessen aus. Klassenunterschiede werden dabei meist verschleiert. Das “Wir” werde bedroht durch “die Anderen” – äußere Feinde, Flüchtlinge, Globalisierung und Moderne, religiöse Minderheiten oder eine (meist mit Jüd*innen verbundene) Verschwörung. Außerdem werden traditionelle Werte, Gehorsam und Konformität geschätzt. Die Agitator*innen solcher Ideologien stellen sich oft als „große kleine“ Männer oder Frauen dar, um Identifikation zu ermöglichen und gleichzeitig Macht zu verkörpern. Sie binden die Anhänger*innen durch die ständige Erzeugung innerer Aufregung an sich.
Aufklärung und Freiheit
Die Gedanken der Aufklärung sind bis heute sehr wichtig für die Entwicklung von Wohlstand und Freiheit. Doch dieses Denken beinhaltet auch die Tendenz, alles Natürliche und Menschliche zum Objekt zu erklären. Die Objekte werden einer Zweckrationalität, wie der Maximierung eines Nutzens, untergeordnet. Der Geist wird als Verstand zum bloßen Werkzeug. In der modernen bürgerlichen Gesellschaft, der verwalteten Welt, wurden die kritischen Ideen der Aufklärung auch zur Ideologie, also Schleier und Rechtfertigung, bestehender Herrschaftsverhältnisse. Der Gedanke, dass Fortschritt – Bildung, Forschung und technische Innovationen praktisch automatisch zu einer freien Gesellschaft führen, sei, so könnte Mensch meinen, in sowjetischen Gulags und vor allem in nationalsozialistischen Konzentrationslagern begraben worden.
Totalität des Kapitalismus
Der Kapitalismus erscheint uns heute oft nicht als historisch gewachsen und vergänglich, sondern verdinglicht – selbstverständlich, gar als einziges der “menschlichen Natur” entsprechendes System. Allerdings war die Herausbildung dieser Gesellschaftsordnung ein Jahrhunderte dauernder und oft brutaler Prozess. In feudalen Systemen wurde gearbeitet, um die Gemeinschaft zu versorgen und unter Androhung von Gewalt den Machthaber*innen einen Teil zu überlassen. Der Tausch von Waren spielte eine andere Rolle.
Eine Grundbedingung der Herausbildung des Kapitalismus lag in der Trennung der Arbeiter*innen von den Produktionsmitteln. Zynisch schreibt Marx von „doppelt freien“ Lohnarbeiter*innen. Frei von feudaler Herrschaft, aber auch frei von dem Besitz an Kapital (Produktionsmittel, Boden etc.). Bis heute können die meisten Menschen nicht allein von ihrem Kapitalvermögen leben, und sind gezwungen ihre Arbeitskraft als Ware auf dem Markt zu verkaufen. In diesem Sinne kann auch dieser Tage noch von einer Arbeiter*innenklasse als analytische Kategorie und Interessengemeinschaft gesprochen werden.
Die Arbeitskräfte werden auf dem Markt ungefragt zu Konkurrent*innen gemacht. Doch auch die Kapitalist*innen stehen unter Konkurrenzdruck. Können sie ihre Marktanteile und Produktion nicht ausweiten, tun es andere und sie werden vom Markt gedrängt. Die Konkurrenz führt so zu einem Akkumulationszwang (Anhäufung von Kapital und Waren), Monopolisierung, Expansionszwang und zur ständigen Beschleunigung des wirtschaftlichen Prozesses. Kredit und Zins verstärken diese Tendenzen.
Dem wirtschaftlichen Wachstum wird im Zweifel alles – auch die Zukunft – untergeordnet. Ein Ausbleiben des Wachstums führt zu weniger Investitionen, der Schließung von Firmen, schwächerer Kaufkraft, erhöhter Arbeitslosigkeit, zu steigenden Staatsausgaben bei sinkenden Steuereinnahmen – und schließlich zu einer allumfassende Krise. Der systemimmanente Zwang zum Wachsen durch die Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft und natürlichen Ressourcen macht den Kapitalismus praktisch unvereinbar mit Friedensbestrebungen, Natur- und Klimaschutz. Die Ausweitung des kapitalistischen Systems während des Kolonialismus und Imperialismus verbreitete die bürgerliche Eigentums- und Staatsordnung auf der ganzen Welt.
Das Besondere und das Allgemeine
Produziert wird in dieser Wirtschaftsordnung oft nur aus dem Zwang, Waren mit Gewinn zu verkaufen. Der wirtschaftliche Prozess wird zum Selbstzweck. Der Gebrauchswert rückt auf dem Markt in den Hintergrund. Vor allem der abstrakte und variable Tauschwert zählt. So werden Tausch und Warenform zum durchdringenden, allgemeinen Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft. Kapitalist*innen und Arbeitskräfte verlieren den Bezug zu ihren Produkten und zum Sinn ihrer Arbeit. Die Warenförmigkeit droht nicht nur die Arbeitskraft und ihre Produkte, sondern das gesamte Individuum zu erfassen. Die Folgen sind unter anderem der Druck zur ständigen „Selbstoptimierung“ und Anpassung. Die Totalität der kapitalistischen Verhältnisse erfasst auch Bereiche der Lebenswelt, die Sinn und Solidarität stiften. Für den Markt produzierte Waren werden fetischisiert, ihnen also göttliche Eigenschaften, gar die Verkörperung eines ganzen Lebensgefühls zugesprochen.
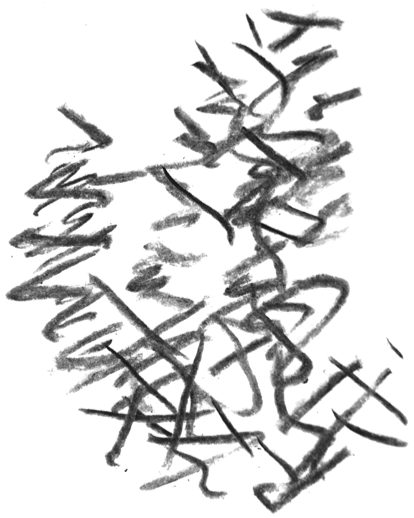
Kalte Gemeinschaft
Der Staat sichert das Eigentum an Kapital und verwaltet die Rahmenbedingungen des sich verselbstständigenden Akkumulationsprozesses. Die Arbeiter*innenbewegung hat in einigen Staaten Klassenkompromisse erkämpft, die zum sozialen Ausgleich und besseren Arbeitsbedingungen führten. Diese sind aber abhängig von der unkontrollierbaren wirtschaftlichen Lage. Neoliberale Regierungen in Europa und den USA setzten seit den 1970ern eine Liberalisierung der Märkte durch. Die damit einhergehende Verschärfung der Standortkonkurrenz stumpfte die gewerkschaftlichen und sozialstaatlichen Werkzeuge, die eher auf nationale Ebene ausgerichteten waren, ab. Die Position der Arbeiter*innen im globalen Norden wurde geschwächt. Der Entstehung starker unabhängigerer Wirtschaften im globalen Süden wurden durch ungleiche Handelsbeziehungen gehemmt.
Da der Kapitalismus die Menschen zur Konkurrenz verdammt, fördert er die Entstehung von berechnenden, manipulativen Charakteren und Masken. Die Verhältnisse erzeugen zwischenmenschliche Kälte und Gefühllosigkeit gegenüber Leidenden und Verfolgten.
Unter den Arbeiter*innen kommt es immer wieder zu Momenten der Abgrenzung. Durch Betonung von geographischen, ethnischen, geschlechtlichen oder kulturellen, oft konstruierten, Besonderheiten versuchen sich Teile der Arbeiter*innenklasse vor dem Mahlstrom der Verwertungsmaschinerie zu schützen. Diese Umstände fördern das Auftreten von Ideologien wie Nationalismus, Rassismus oder des patriarchalen Geschlechterverhältnisses.
In autoritären Bewegungen werden solche Ideologien meist befürwortet. Sie reden von Ordnung und Sicherheit, doch meinen die Erhaltung von Herrschaft und sozialer Ungleichheiten durch zum Teil tödliche Repressionen.

Furcht vor der Freiheit
In der modernen Gesellschaft sind Menschen generell frei von direkter Gewalt und der Bevormundung durch „absolute“ Autoritäten. Die Einzelnen sind auch nicht mehr zwangsläufig auf ihre Familien angewiesen. Daraus resultiert Eigenverantwortung, Innerlichkeit und Subjektivierung, also eine eigenständige Handlungsfähigkeit. Aber es folgt auch der Verlust eines festen und sicheren (mehr oder weniger privilegierten) Platzes in der Welt.
In der kapitalistischen Gesellschaft sind die Individuen von Erfolgsversprechen, aber auch wirtschaftlichen Zwängen getrieben. Dabei bestimmen oft Vorgesetzte, oder einfach die Verhältnisse, über sie. Auch die Demokratie wird durch vermeintliche “Sachzwänge”, die gar mit autoritären Mitteln durchgesetzt werden, ausgehöhlt.
Die möglichen Überforderungen der bürgerlichen „Freiheit“ veranlassen Gefühle der Bedeutungslosigkeit, Ohnmacht, Einsamkeit und Isolation. Einige Menschen versuchen diesem Unbehagen zu entrinnen durch eine “Flucht” in Konformität, Destruktivität oder das Autoritäre.
Letzteres spricht vor allem Bedürfnisse nach Bindung, Sicherheit und Ermächtigung an. Diese Bedürfnisse werden durch die sadomasochistische Aufgabe des unabhängigen Selbst und der lustvollen Unterwerfung unter eine größere Macht oder durch die Beherrschung Anderer, um mit ihnen eine Bindung einzugehen, zumindest scheinbar befriedigt. Die Überbetonung des eigenen Leids, die Verachtung von allem Schwachen und Bewunderung des Mächtigen sind nach Fromm typische Ausdrücke einer relativ starren Persönlichkeitsstruktur, die er den autoritären Charakter nennt.
Der Kapitalismus birgt also autoritäre Dynamiken. Ob sozialdemokratisch, liberal oder autoritär formiert, kann diese Gesellschaftsordnung den Menschen nur wenig Kontrolle über den Produktionsprozess und ihr vom Einzelkampf geprägtes Leben geben. Bevor die Barbarei vollends ausbricht, müssen wir uns von der Herrschaft der Verhältnisse befreien.
B.R. 2019